
Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Dieses Mal mit Logos, Prins Thomas, Suso Sáiz und satten 16 weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.
Agoria – Drift (Sapiens)

Agoraphobie ist bekanntermaßen die Angst vor großen Plätzen. Agoriaphobie ist hingegen die Angst vor Electro-Pop. Stimmt natürlich nicht, aber würde einem der straightesten Poppisten unter den Housern in gebührendem Maße Respekt zollen. Das insgesamt fünfte Album – zugleich das erste seit acht Jahren – möchte mal wieder Agorias Rolle unterstreichen. Konsequent wie nie verfolgt der Franzose dafür seinen Ansatz der größtmöglichen Massentauglichkeit bei gleichzeitigem Realness-Überschuss. Selbstbewusst wird hier den modernen Tanzflächen Material geboten und im nächsten Moment Chartpotenzial ausgespielt. Drift, so der Name dieser Pop-Compilation, umarmt den Hörer sogleich mit den beiden Nummern „Embrace“ und „You Are Not Alone“, für die er sich Phoebe Killer bzw. Blasé vor das Mikro holte. Während der Opener eine Post-Dubstep-Hommage englischer Art ist, darf „You Are Not Alone“ ganz klar als Verneigung vor Metronomy in erster Linie und Phoenix in zweiter gedeutet werden. Sommerhitverdacht inklusive. Doch wer glaubt, dass es allein um „EDM, but in a good way“ geht, mag sich täuschen. Schon „Arêg“, das dritte Stück, kommt als waschechter, kosmischer Soundtrack angeschossen, der mit seinem schneller drehenden, analogen Synth-Arpeggio große Kinomomente erzeugt. Und immerhin hat hier auch der Sound Engineer Nicholas Becker vom Hollywoodblockbuster Gravity mitgearbeitet. Lars Fleischmann
Amnesia Scanner & Bill Kouligas – Lexachast (PAN)

Ein auditiver Meltdown, an dem sich die Geister scheiden? Amnesia Scanner aus Finnland ist mit PAN-Kurator Bill Kouligas zumindest eine ebenso reduzierte und ausufernde Variation dessen gelungen, was seit ein paar Jahren als Deconstructed Club die Runde macht und von den beiden als „a sonic reference to the fallouts of avant-EDM and cyberdrone“ beschrieben wird. Deconstructed what? Die Elemente von Techno und House, von Noise und Glitch dekonstruieren, entfremden, halb intuitiv, halb kalkuliert wieder zusammensetzen – das ist nicht unbedingt eine neue Idee. Aber was auf Lexachast passiert, klingt in seiner schroffen Erregung so künstlich, so futuristisch und bedrohlich zugleich, dass dem mit orthodoxem Vokabular kaum noch beizukommen ist.
Was soll das sein? Post-Industrial versetzt mit dröhnender Musique concrète? Glitch-Trap und Spoken-Word-Gebete durch einen defekten Noise-Filter geschossen? Eine postapokalyptische Soundcollage für Saunapartys größenwahnsinniger Yuppies im Silicon Valley? Spätestens bei den entrückenden Pitch-Kaskaden von „Lexachast IV“ und dem ominös flirrenden Aufbäumen in „Lexachast VI“ drängen sich diese Bilder auf. Einerseits, weil die Musik durchweg eine ziemlich andersartige, transhumane Tonalität verfolgt. Alles auf Lexachast, das eigentlich schon 2015 aus einer improvisierten Live-Performance entstanden ist, klingt scharf konturiert, erlischt abrupt, schreit maschinenartig in eine undefinierbare Leere – oder aus ihr hinaus. Andererseits auch, weil das Cover nur bedingt eine menschliche Idee ist. Entworfen wurde es vom niederländischen Konzeptkünstler Harm van den Dorpel mittels eines Algorithmus, der tausende Bilder von DeviantArt und Flickr visuell ineinanderphrasiert. Zu sehen: Die surreale Überblendung einer lächelnden Mutter samt Kind und Pustefix mit einem fletschenden Pavianmaul. Cover und Album wirken so fremd und zugleich faszinierend wie vieles, was wir gegenwärtig mit der Hilfe schnell lernender Systeme entwickeln. Nils Schlechtriemen
Amon Tobin – Fear In A Handful Of Dust (Nomark)

Der erste vollwertige Studio-Release seit acht Jahren und ein weiteres Mal wagt das musikalische Facettenauge Amon Tobins einen anderen Blick auf Gehör und Geräusch. Hyperakustische Glitch-Collagen aus endlos prozessierten Field Recordings wie auf ISAM (2011) oder die geisterhaft abstrahierten Analog-Synth-Studien Electronic Music for the Sydney Opera House (2017) liegen hinter ihm. Mit Bass und Rhythmus hat der Brasilianer so ziemlich alles gemacht, was modernes Gerät hergibt, ob analog oder digital. Auch komplexe Harmonien und irisierende Pad-Flächen entwarf Tobin in der Vergangenheit auf konkurrenzlos vielseitigem Niveau. Jetzt taucht er mit Fear In A Handful Of Dust noch tiefer ins Amorphe ein und entfernt dabei der Natur der Sache nach alle perkussiven Elemente aus seinem Sound, die besonders die frühen Werke auszeichneten. In seiner elektro-akustischen Diversität ist dieses Album daher wahrscheinlich am nächsten mit dem Sample-Fest Foley Room (2007) verwandt, wirkt aber durchkomponierter und konsistenter. Von den zischenden und schnalzenden Saiten in „Vipers Follow You“ über die berauscht dröhnenden Prog-Electronics von „Pale Forms Run By“ oder das sorgsam übersteuerte „Velvet Owl“ bis zum experimentell klirrenden „Milk Millionaire“ bietet Tobin eine beeindruckende Reizvielfalt fürs Trommelfell, die kein Ding für zwischendurch ist. Eingängig klingt hier nämlich fast nichts – generisch aber auch nicht. Nils Schlechtriemen
Bibio – Ribbons (Warp)

Stephen Wilkinson klingt als Bibio ja irgendwie immer nach Bibio, ganz gleich, in welche Richtung er sein Projekt von Album zu Album gerade zu steuern beliebt. Dieser aktuelle Bibio ist wieder ein bisschen wie der von Ambivalence Avenue, und das ist allemal eine gute Nachricht, war sein Warp-Einstand von vor zehn Jahren doch ein besonders frischer Nostalgie-Wurf des Musikers aus den Midlands. Folk ist auf Ribbons sein bevorzugtes Ausdrucksmittel, meistens mit dieser beruhigend-gefassten Gitarre, zu der er zart, fast klagend, aber immer mit typisch britischer Zurückhaltung singt. Manchmal unterstützt ihn Thomas Dwyer an Geige, Mandoline oder Banjo. An anderer Stelle nutzt Wilkinson die irgendwo mit dem Mikrofon eingefangenen Klänge aus der Umgebung, Stimmen von Vögeln etwa wie im programmatisch betitelten „Ode to a Nuthatch“ – auf Deutsch heißt dieser mit einem Lobgesang bedachte Vogel Kleiber. Doch das bedeutet nicht, dass hier durchgehend Naturverbundenheit simuliert würde. In „Pretty Ribbons and Lovely Flowers“ regieren die Synthesizer, ganz sacht klickende Beats und nach gutem elektronischen Handwerk bearbeitete Stimmen. Die nächste Flöte ist nicht weit, dezent psychedelisch wird es bald darauf ebenfalls und alles erweckt den Eindruck, dass Wilkinson es dorthin getan hat, wo es fortan hingehört. Tim Caspar Boehme
DJ Nate – Take Off Mode (Planet Mu)

Fast zehn Jahre ist es her, dass Footwork auch international Beachtung fand, woran Planet Mu bekanntlich nicht ganz unschuldig war. Michael Paradinas Label machte die schnellen Breakbeats aus Chicago einem breiteren Publikum schon früh bekannt. Mit Compilations und Releases von RP Boo, Traxman oder eben DJ Nate, der dort 2010 sein erstes Album veröffentlichte. Seitdem ist viel passiert: Als Genre gehört Footwork zum festen Inventar der Clubmusik, eine neue Generation von Produzent*innen – allen voran natürlich Jlin – arbeiten an seiner steten Weiterentwicklung. Nate erweist sich auf Take Off Mode aber lieber als wahrer True Schooler, dessen Musik sich vor allem als Futter für die klassischen Dance Battles versteht. Das Album ist eigentlich eine Zusammenstellung von Stücken der vergangenen neun Jahre, es setzt auf besonders euphorische Tracks und eingängige Samples. Selbst „Come Back“, die Halftime-Ballade des Albums, kickt ordentlich. Der infizierende Übermut dieses Albums hat vielleicht noch einen anderen Grund, denn für Nate dürfte dieser Release mehr markieren als nur ein zweites Album. In den letzten Jahren kämpfte er gegen die Folgen eine Erkrankung, die zur Lähmung seiner Beine führte. Das ist für jede und jeden furchtbar, für einen Footwork-Artist dürfte es die schiere Hölle sein. Mit Take Off Mode steppt Nate jetzt zurück ins Game: Welcome Back! Christian Blumberg
FBK – More Stories From The Future (Rekids)

Wer sich als Produzent und DJ über drei Jahrzehnte im Haifischpool der weltweiten House- und Technoszene halten kann, sich ständig neu erfindet, jedoch nie seine Wurzeln vergisst, der hat es wohl auch irgendwo verdient, zu den Großen gezählt zu werden. Der Amerikaner Kevin Kennedy, der sich nur FBK nennt, veröffentlicht auf Rekids mit More Stories From The Future sein – man kann es eigentlich bei dieser Zeitspanne kaum glauben – allererstes Album. Gleich der erste Titel „Modular Life“ fühlt sich an, als würde man nach einer langen Reise nun endlich wieder nach Hause kommen (sofern das Zuhause Detroit heißt). Nur allzu gerne lässt man sich von den ach so schönen Synth Pads davontragen. Untermalt wird das Ganze noch von einem effektvollen 808-Drum-Workout und mehr braucht ein Track manchmal gar nicht, um gelungen zu sein. Motor City in full effect. Überhaupt hat man das Gefühl, das Album wäre eine Hommage an diese Stadt oder zumindest Kennedys eigene Wahrnehmung von dieser. Dann gibt es da aber auch noch den Dance Mania–esquen Track „I’ll Sit Back, You’ll Jack“, der sich fast ganz auf Drums und eingängige Vocals fokussiert und somit perfekt für den Dancefloor geeignet ist. Noch ein, zwei weitere House-Hymnen folgen, und plötzlich sieht man sich mit Dettmann-Techno konfrontiert. Wer gerne zu harten Beats, reduzierten Mono-Synth-Lines und Vocal-Samples seine Füße in den Boden hämmert, der freut sich bestimmt darüber. Andererseits hat man das auch schon irgendwie zu oft gehört und bahnbrechend ist es wirklich nicht. Trotzdem dürfte es für die meisten funktionieren. Andreas Cevatli
Girl Unit – Song Feel (Night Slugs)

Im Jahr 2010 schickte sich das Londoner Label Night Slugs an, aus den freudlosen Resten von Dubstep einen frischen Sound zu erschaffen. Night Slugs-Tracks waren von Grime, Dirty South Rap, Footwork, Dance Mania-Produktionen, modernem R&B, diversen Rave-Spielarten und allerhand mehr inspiriert. Damit hat das von L-Vis 1990 und Bok Bok gegründete Label einige Türen zwischen Urban-Genres und der Techno-Welt geöffnet. Zur ersten Generation der Night Slugs-Produzenten zählte neben Mosca und den Labelmachern auch Philip Gamble mit seinem Projekt Girl Unit. 2010 war da der Underground-Banger “Wut”, 2015 landete er mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin Kelela den Hit “Rewind”. Seitdem hat der Londoner nur sporadisch von sich hören lassen. Nun ist nach jahrelanger Arbeit das erste Girl Unit-Album Song Feel fertig. Man kann es sich denken: Im Vordergrund stehen Songs. Es ist in weiten Teilen ein R&B-Album geworden, das von den Beiträgen der beteiligten Gäste lebt, darunter sind Kelela (mit dem an 80s-R&B angelehnten Opener “WWYD”), die Debütantin Brook Baili, die US-amerikanische Transgender-Rapperin Ms. Boogie oder die Londoner Sängerin Taliwhoah. Letztere hat auf “Stuck” mitgewirkt, dieses Stück mit seinen üppigen Synth-Kaskaden zählt zu den Highlights eines Albums, das einen je nach Erwartungshaltung erstmal tendenziell enttäuscht. Im Vergleich zu früher wirken Philip Gambles Produktionen konventionell, gemessen an der aktuell aufblühenden, jungen R&B-Szene klingt mancher Track altbacken. Als Einflüsse tauchen hier immer wieder Jam & Lewis oder Babyface auf, also die R&B-Erneuerer der Achtziger und Neunziger. Doch Phillip Gamble hat ein Gespür für Melodien, die sich festsetzen. Instrumental-Tracks wie “B.A.C.K.” oder “Roll” sind da keine Ausnahme. Und so schließt man Song Feel am Ende doch noch ins Herz. Holger Klein
Jan Jelinek & Asuna – Signals Bulletin (Faitiche)

Es gibt Kooperationen, die auf der Hand liegen, und Kooperationen, die unwahrscheinlich wirken. Signals Bulletin von Asuna und Jan Jelinek darf gerne zur zweiten Kategorie gezählt werden. Der Japaner Naoyuki Arashi ist vor allen Dingen für seine Klangexperimente bekannt, die meist mit dem Drone-haften Charakter stetig produzierender Keyboards und Orgeln arbeiten. Auf der Grenze (oder darüber hinweg) zur Klangkunst klebt Asuna in Performances und Produktionen Klebestreifen auf Klaviaturen und erzeugt, wie er sagt, „Klang-Moirés“ überwältigender Einfachheit und sublimer Schönheit. Das bekommt man sogleich nicht ganz zusammen mit den minimalistischen Field Recording-Kompositionen und klackernden Electronica-Loops Jelineks. Doch gerade in diesem Zusammenhang darf und kann er seine Beweglichkeit und Virtuosität beweisen. Während Asunas Ansatz und Sound in gewisser Weise inert ist, lag es an Jelinek, die Aufnahmesessions zwischen 2014 und 2017 durch Struktur, „Non-Beats“ und Collagen zu unterfüttern. Auf diesem Gobelin der Soundkreation finden die Klangexperimente genügend Platz, um sich auszubreiten. Leichtes Pulsieren hier, feine Glöckchen dort und darüber, darunter und mittendrin die langen Töne, die mit ihren (mikro-)tonalen Veränderungen berühren. Signals Bulletin ist weniger verkopft als vielmehr ein ambientes Werk extremer Klasse, das sich aus der Spannung dieser beiden Künstler speist. Lars Fleischmann
Johanna Knutsson – Tollarp Transmission (Kontra-Musik)

Googelt man das neue Album von Johanna Knutsson und liest auf den einschlägigen Shop-Plattformen den Werbetext zur Veröffentlichung, während gleichzeitig der erste Track der Platte läuft, könnte der Eindruck entstehen, es hier mit klanggewordener neuer Befindlichkeit zu tun zu haben: Familiäres und Etappen aus Kindheit und Jugend in sanften Ambient gegossen. Diesem Eindruck wird aber nur der*diejenige aufsitzen, der*die das Album nicht weiter hört, denn schon das zweite Stück schlägt einen anderen Ton an, klöppelt unruhig, rauscht verzerrt und koppelt dieses Anti-Wohlfühl-Programm mit augenzwinkernden Analogsynthiesounds. In einem ähnlichen Spannungsfeld läuft das Album weiter, die Stücke wollen weder beruhigen noch verklären und beinhalten immer mehrere und vor allem gegenläufige Gefühlsebenen. Die Frage stellt sich, ob Künstler*innen sich einen Gefallen tun, ihre Musik in Infotexten oder Linernotes auf Covern derart explizit zu erläutern und so eine Vorabinterpretation zu liefern, die beim Hören nur noch schwer auszublenden ist. Aber diese Frage ist so alt wie das Genre Programmmusik und ihre Beantwortung ein typischer Diskussions-Loop. Tollarp Transmission jedenfalls kann hervorragend ohne jede Erklärung als zeitgemäßes Electronica-Album gehört werden, das weder lieblich noch gewollt anstrengend ist, sondern vielschichtig, inspiriert und sympathisch eigenwillig. Mathias Schaffhäuser
Kornél Kovács – Stockholm Marathon (Studio Barnhus)
Eins sei vorweggenommen: Stockholm Marathon fiel an einem geselligen Couchabend voll durch. Viel zu nett, viel zu beliebig, lautete das Fazit der Gäste. Einerseits stimmt das, andererseits kommen mit “Club Notes” und “Baltzar” die besten Stücke von Kornél Kovács‘ zweitem Longplayer erst auf Position sieben und acht. Und okay, da war ja noch der vorab veröffentlichte Track “Marathon”, ein total charmanter Pop-Song mit R&B-Einflüssen und Vocals vom EDM-Pop-Duo Rebecca & Fiona. Selbstverständlich inszeniert Kovács die Stimmen der beiden Schwedinnen ganz anders, sie sind kein bisschen EDM-expressiv und recht weit in den Hintergrund gemischt. Die zwei Sängerinnen sind noch einige Male mehr auf dem Album zu vertreten. Wenn man das tolle “Club Notes” mit seiner beiläufigen Grandezza hört, ahnt man nicht, dass Rebecca & Fiona auf Fotos mit Buffalo-Plateaus posieren. Dass Stockholm Marathon einen nicht zu packen vermag, liegt jedoch nicht an den beiden. Man fragt sich leider immer wieder, wo Kovács´ zündende Ideen dieses Mal geblieben sind. “Ducks” klingt in seiner leicht trancigen Seligkeit beispielsweise ärgerlich gestrig, sagen wir nach 2012. Doch dann kommt der Schwede ganz zum Schluss mit “Baltzar” um die Ecke – zerhackstückte Vocals sorgen für echte, tief empfundene Emotionen. Holger Klein
Logos – Imperial Flood (Different Circles)

Bald schon wieder sechs Jahre her, dass James Parker alias Logos sein Debütalbum Cold Mission vorgelegt hat. Großartig, wie er darauf das Jahrzehnt der Bassmusik zum Nachhallen brachte. Er ließ einfach sehr viel Raum für Leere und lud sie zugleich mit so viel Spannung auf, dass man in den Pausen gebannt auf das nächste Klirren und all die anderen digital-klaren Klänge wartete. Recht ähnlich geht Logos auf Imperial Flood jetzt wieder vor. Die Pausen sind immer noch da, auch scheint er erneut vor allem digitale Geräte genutzt zu haben. Der Effekt ist jedoch heute anders. Wo 2013 noch eine Art Clubmusik in Zeitlupe den Rahmen setzte, entfernt sich Parker diesmal stärker von der Erdung durch den Beat, lässt den Klängen mehr Freilauf. Das ist durchaus gekonnt gestaltet, sein Stilwillen behauptet sich allemal. Den Elementen fehlt auf Imperial Flood aber ein wenig das Zwingende. Wo sich früher aus Tönen und Stille ganz von selbst ein Fließen ergab, pluckern die Sounds heute eher vor sich hin, so als seien sie ihrer eigentlichen Bestimmung unschlüssig oder vielmehr sich selbst überlassen worden. Höhepunkt ist das zusammen mit Parkers Kollegen Mumdance produzierte „Zoned In“, in dem der Beat vorübergehend die Herrschaft und mit so einfachen wie effektiven Mitteln den Energiepegel übernimmt. Der Rest ist oft eine Spur zu sehr vom Verfall fasziniert. Tim Caspar Boehme
Mana – Seven Steps Behind (Hyperdub)

Viele Jahre war er unter dem Alias Vaghe Stelle in Erscheinung getreten, jetzt legt Daniele Mana seine Debüt-LP für Hyperdub als Mana vor. Seven Steps Behind ist über weite Strecken ein Fluß aus semi-digitaler Kammermusik, die meistens ohne Beats auskommt und manchmal viel mit den Produktionen von Arca gemeinsam hat. Die Flüchtigkeit dieser Musik ist durchaus reizvoll und offensichtlich auch gewollt – vieles hier klingt bewusst nicht komponiert: Ohne Thema und scheinbar ohne Anfang oder Ende fließen die Melodien, ziellos, als würden Algorithmen vor sich hin summen. Das fast schon banale Geklöppel in „Swordsmanship“ scheint so intuitiv, als hätten Kleinkinder nicht mit Rasseln, sondern mit Ableton gespielt. Als Produzent tritt Mana in solchen fast generisch wirkenden Passagen in den Hintergrund. Aber vielleicht wollte er dann doch nicht so ganz hinter den Sounds verschwinden, denn gelegentlich steuert er sehr viel greifbarere, aber auch weniger interessante Gefilde an: Das Auftauchen von leicht vernebeltem Vocoder-Pop oder gefühligem Ambient macht Seven Steps Behind in seiner Gesamtheit zu einer etwas holprigen Angelegenheit. Nicht weil Mana diese Stile nicht beherrscht, sondern weil der Eindruck entsteht, dass hier jemand seinem eigenen Konzept nicht wirklich traut. Dennoch ist das hier eine mindestens bemerkenswerte Platte – auch im Kontext der Diskographie des sich gerade wieder erneuernden Hyperdub-Labels. Christian Blumberg
Minimal Violence – InDreams (Technicolour)
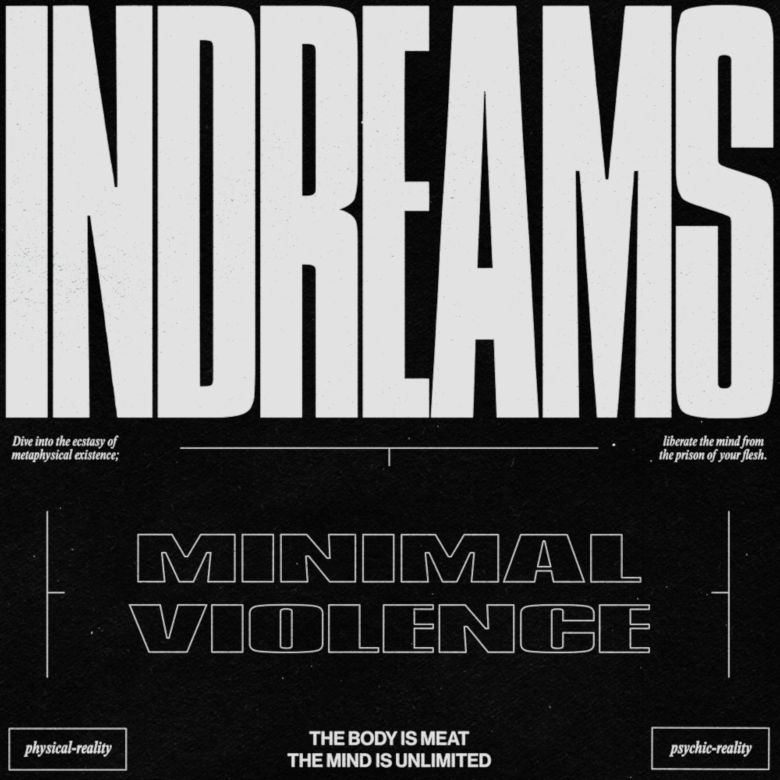
Angesichts des ungestümen Techno-Orkans, den das aus Vancouver stammende Duo Minimal Violence auf seinem Debütalbum entfacht, wirkt der von ihm gewählte Projektname doch arg untertrieben. Minimal ist hier wirklich gar nichts, stattdessen wird mit maximalem Einsatz auf die elektronische Pauke gehauen, und zwar mit entsprechender Punk-Attitüde. Da rast die verzerrte 909-Kick durch ein undurchdringliches Klanggestrüpp aus sich überschlagenden Claps und Snares, hyperventilierenden Hi-Hats und verqueren Percussion-Sequenzen, zwischen welchen sich dann wiederum schief daher leiernde Melodie-Artefakte ihren Weg bahnen. Und ein ums andere Mal stolpern die Maschinen oder verschlucken sich, denn funktionieren tut hier nichts so richtig, und das mit Vorsatz. Zusammengerührt ergibt das ein schräg nach vorne treibendes Gebräu aus Gabba, Hardtrance, Techno und Punk, welches auf progressiven Technofloors wie auch aufgeschlossenen Goa-Sandgruben willige Tänzer finden dürfte, und dabei stets knapp und gekonnt am Ironieabgrund vorbeischrammt – zum Glück. Tim Lorenz
Noriko Tujiko – Kuro OST (Pan)

Noriko Tujiko veröffentlicht gemeinsam mit Joji Koyama ihren ersten Spielfilm namens Kuro, der vom Leben von Romi (gespielt von Tujiko und angelehnt an sie selbst) und ihrem querschnittsgelähmten Mann Milou in der Peripherie von Paris erzählt. Indem sie Reminiszenzen an die gemeinsame Vergangenheit in Osaka einspeist und über die gezeigten Bilder eine parallele, davon abweichende Erzählung legt, baut sie Spannung auf. Die von ihr (unter anderem mit Hilfe von Will Worsley) für den Film komponierte Musik funktioniert dann nicht als Hintergrundrauschen oder Begleitung des Geschehens, sondern als ein Kitt, der den Innenraum zwischen der visuellen Story und der darüber liegenden Erzählung zusammenbringt. Musik ist hier ein Stück Realität, das sich nicht mehr weiter reduzieren lässt und den Mittel- und Ausgangspunkt des Geschehens ausmacht, also der Ort, wo sich Bilder und Worte treffen und Empfindungen evozieren. Diese Realität ist nichtsdestotrotz recht unspezifisch: Manchmal sind das abstrakte Atmosphären oder Gefühle. Ganz zu Beginn, bei „Rooftop”, kann man das Zwielicht von Angelo Badalamenti heraushören. Düster minimalistische Klaviertöne, überlagert von kurzen Eindrücken, rasch auftauchenden Erinnerungsfetzen. Wie auch in ihren früheren Produktionen arbeitet sie mit der Überlagerung von Glitch-Elementen, die eine klaustrophobische, der Großstadt entsprechende Stimmung erzeugen. In manchen Momenten blitzt da wahre Schönheit auf, die nur kurz und momenthaft bleiben soll, wie in einem Blinzeln wahrgenommen. Auf dem äußerst melancholischen Stück „Cyclamen” wirkt das Schöne und Harmonische weit entfernt, irgendwo verborgen im Nebel des Rausches und ist doch spürbar. Bei „Night Park” etwa sind es der Hall und die Wiederholung eines Tones, die Vergangenheit und Gegenwart vereinen, und dabei diese schmerzhafte, aber bittersüße Melancholie zum Ausdruck bringen. Viele der Stücke lassen, wieder nur bruchstückhaft, Erinnerungen an andere Ambient-Künstler*innen aufsteigen. Das Nautische, klassischer Bilderbereich für den Ausdruck von Sehnsucht, zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Musik. Bei „At The Sea” etwa meint man das Klackern und Krachen der Schiffe unter Wasser im Hafen von Osaka zu hören, bis einen erneut gefühlvolle Ambient-Flächen aus der Gegenwart reißen. Lutz Vössing
Prins Thomas – Ambitions (Smalltown Supersound)

Sein sechstes Soloalbum als Prins Thomas habe er nicht geplant, lässt Thomas Moen Hermansen verlauten. Skizzen, die in den letzten zwei Jahren in Hotelzimmern in San Francisco, Backstage in Osaka oder während eines Fluges von Miami nach Chicago entstanden sind, seien unter den kritischen Ohren von Smalltown Supersound-CEO Joakim Haugland überarbeitet worden, während er mit der Abmischung seiner Kollaboration mit dem norwegischen Jazzpianisten Bugge Wesseltoft befasst war. Herausgekommen sind sieben Tracks, die erfrischender kaum sein könnten. Und auf „Sakral“, dem letzten Stück des neuen Prins-Thomas-Albums, ist Wesseltoft auch zu hören. Beginnend vom Vogelgezwitscher des balearischen Openers „Foreplay“ über den entspannten Disco-Groove von „XSB“, dessen String-Arrangement zum Ausklang Reminiszenzen an Massive Attack weckt, bis hin zu „Feel The Love“, der um ein Vocalsample von Alex Naumik kreisenden Midtempo-Hitsingle, begeistert auf Ambitions der inspirierteste Prins Thomas seit langem. Epische Ambient-Soundscapes, wie sie die Produktionen der vergangenen Jahre dominierten, finden sich auf Ambitions nur noch mit dem Titeltrack und dem anschließenden „Fra Miami Til Chicago“, im Zentrum der Platte. Hermansen dankt Jon Christensen, Jaki Liebezeit, Haroumi Hosono, Daniel Lanois, Eberhard Weber, Shinichi Atobe und Ricardo Villalobos – jede dieser Widmungen wird auf Ambitions exemplifiziert und nachvollziehbar. Zumindest für „Urmannen“, das am weitesten vorausweisende Highlight des ausgezeichneten Albums, werden sich kommende Producergenerationen wiederum bei Prins Thomas zu bedanken haben. Harry Schmidt
Shlohmo – The End (Friends of Friends)

Auf seinem dritten Album wendet sich Henry Laufer wieder dem zu, was ihn zu Anfang seiner Karriere ausgemacht hat: düster-melancholischen Glitch-Elegien. Nach dem zu viel wollenden und zu wenig erfüllenden Zweitling Dark Red wirkt The End wie der würdige Nachfolger seines großartigen Debüts Bad Vibes von 2011. Nahm sich Shlohmo auf Dark Red vor vier Jahren in dunkler Romantik ein Stückchen zu ernst, ist jetzt wieder die nötige Balance zwischen bittersüßer Seriosität und verschmitzter Ironie hergestellt. Das macht schon seine Aussage deutlich, auf The End ginge es „irgendwie um das Ende der Welt, aber aus der Perspektive von jemandem, der währenddessen auf der Couch sitzt und raucht.“ Das Album bietet wohldosierte Überraschungen, wie das rastlos-technoide „Panic Attack“ und das housige „By Myself“. In den besten Momenten aber sind die Bad Vibes wieder da: Verzerrte Gitarren, fette Basslines und glitchige Beats verweben sich zu Soundgebilden, die in Zeitlupe explodieren und auseinanderstieben: Das Ende der Welt in Zigarettenlänge, stimmt schon. Steffen Kolberg
Suso Sáiz – Nothing Is Objective (Music From Memory)
„Nothing Ends 2018“, lässt uns der spanische Ambientdröhner Suso Sáiz auf seinem neuen Album Nothing Is Objective wissen. Und er sollte recht behalten. Schließlich sind wir noch da, die meisten anderen auch. Jetzt müssen wir uns bloß noch überlegen, was wir draus machen. Immerhin: So schlecht kann die Welt nicht sein, wenn das wiedererlangte „kreative Erwachen“ eines 62-jährigen Musikers dazu führt, dass wir uns für eineinhalb Stunden an die Hand nehmen lassen können und nichts außer uns selbst fühlen sollen. Geht nicht, weil Insta-Story? Von wegen. Seit den frühen 80er-Jahren hat Suso Sáiz derart viele Alben veröffentlicht, dass sogar eingefleischte Hobbypsychonauten und Fans des spanischen Musikers den Überblick über sein Schaffen verloren haben. Außerdem brachte das Amsterdamer Label Music From Memory mit Odisea und Rainworks allein in den letzten drei Jahren zwei Werkschauen von Sáiz raus. Gut möglich, dass in nach Bergamotte oder Lavendel duftenden Yoga-Studios in Kreuzberg einige seiner CDs rumliegen oder bei der Zahnärztin als Hintergrundgedudel vom Kreischen des Bohrers ablenken. Schließlich hat man Sáiz jahrelang als New Age-Musik verballhornt. Das verkauft sich in esoterisch angehauchten Kreisen gut, hängt ihm aber bis heute nach. Dabei schwingen in seinen Drones die frühen Ambient-Experimente von Brian Eno genauso mit wie die nächtlichen Ausflüge von Stars Of The Lid. Nothing Is Objective entstand 2018 in Madrid, jener Stadt, in der Sáiz seit Ende der Franco-Diktatur 1975 lebt. Für ihn sei Madrid, wie er in einem Interview sagt, immer noch ein Zentrum der Neugier und des Respekts für Unterschiede. Diese Unterschiede sind der Antrieb für schwebende Drones, mit denen uns Sáiz zum imaginären Sonnengruß ausholen lässt. Ganz ohne New Age-Hintergedanken. Christoph Benkeser
Tiger & Woods – A.O.D. (Running Back)

Für ihr drittes Album hatten Marco Passarani und Valerio Del Prete Zugriff auf den Katalog der italienischen Labels Full Time und Goodymusic. Mit diesen Labels versorgte Claudio Donato seit Ende der 70er-Jahre die Dancefloors von Rom zunächst mit aus der New Yorker Discoszene importierter, später selbstproduzierter Tanzmusik. Acts wie Kano, Tom Hooker, George Aaron oder Jago hatten hier ihre ersten Veröffentlichungen. Die populärste der genutzten Vorlagen dürfte M & Gs „When I Let You Down“ sein, das als „The Bad Boys“ dann auch den designierten Hit des überaus gelungenen Longplayers markiert. Ansonsten haben sich Tiger & Woods eher an Unoffensichtliches gehalten und Figuren aus der zweiten Reihe gesamplet, etwa Orlando Johnsons „Turn The Music On“ auf dem Opener „Forever Summer“. Mit dessen Titel ist auch der Ton für den kompletten Longplayer gesetzt: Subtropische Sommernacht-Vibes all over the place. Da passt die lediglich halbironische Anlehnung des Albumtitels an die auch als Yacht-Rock geläufige Genrebezeichnung A.O.R. (Adult Oriented Rock) nur zu gut ins Bild. Besonders bemerkenswert ist, wie unverkrampft Passarani und Del Prete hier zu Werke gegangen sind. Für „1:00 AM“, den Gipfeltrack kurz vor Ende, haben sie dann gar kein Sample mehr benötigt. Die acht Tracks von A.O.D. klingen – das kommt nicht allzu häufig vor – ebenso entspannt wie souverän. Harry Schmidt
Tommy Four Seven – Veer (47)
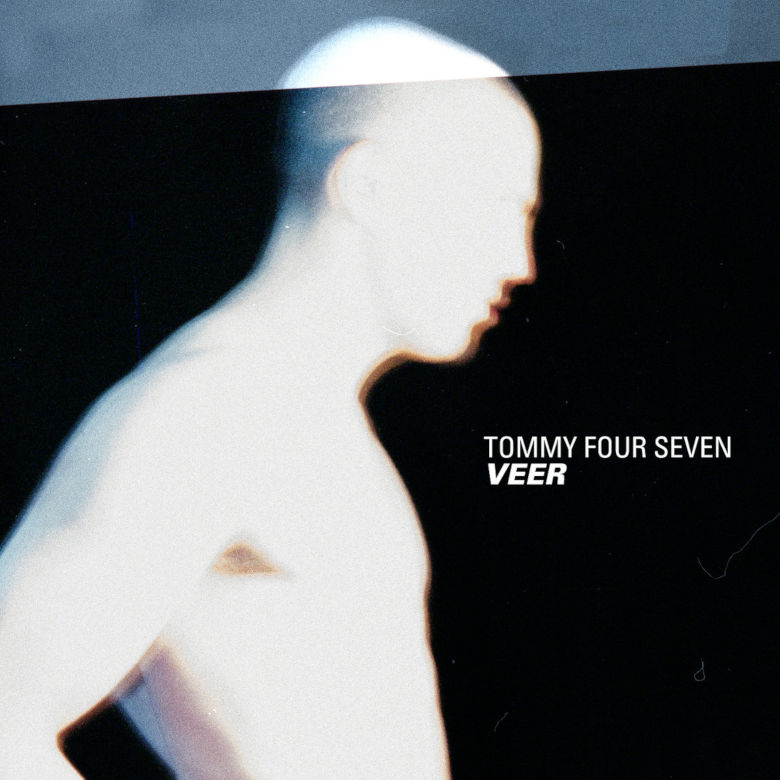
Tommy Four Seven hat sich einmal mehr abgewandt. Von einem Techno, der zu sehr nach Bootsparty auf Ibiza und weniger nach Technologie aus abgefuckten Kellerlöchern klingt. Auf Veer, seinem ersten Solo-Album seit dem 2011 auf Chris Liebings Label erschienenen Primate, prügelt er deshalb geistlose Seelen mit einem Waffenarsenal aus übersteuerten Kicks und ramponierten Hi-Hats durch verlassene Fabrikanlagen, die irgendwann für etwas standen, das die Menschen einmal Zukunft nannten. Und im Gegensatz zu „OX1“, jenem Track von ihm, der gerade in einer Folge von „Love, Death & Robots“ auf Netflix lief, haben die Menschen hier schon länger nichts mehr zu sagen. Veer ist vielmehr der Versuch weniger Abtrünniger, ihre eigene Zukunft zurückzuerobern. Mit Maschinen, die sich nach und nach selbst zum Leben erwecken, gesteuert aus einer unkontrollierbaren Vergangenheit, die in ihnen ruht und niemals vergeht. Manchmal, wie auf „The Virus“ und „Veer“, mischen sich entfremdete, von allem Menschlichen gelöste Stimmen unter die zerhackten Beats, die paradoxerweise genau dann so etwas Ähnliches wie einen menschlichen Bezug herstellen wollen. Sie spuken herum in einer Welt des Postspektakels, die jenseits des Tipping-Points der Singularität auf Maschinen aufbaut, ja, von ihnen übernommen wurde. Was wollen uns die Stimmfetzen sagen? Wie der Mensch sich selbst ausgelöscht hat? Oder wie er es geschafft hat, sich auslöschen zu lassen? Vielleicht finden wir ja in „2084“ als postapokalyptischen Dystopiegedanken mit Orwell-Anspielung eine Antwort. Ansonsten bleibt Tommy Four Seven so vage, wie harter Techno sein kann, der seine ästhetischen Wurzeln im Industrial-inspirierten Sound der Neunziger hat. Roh wie männliche Geschlechterrollen aus den 19. Jahrhundert und brutal wie körperliche Arbeit zu Zeiten der Industrialisierung. Christoph Benkeser




