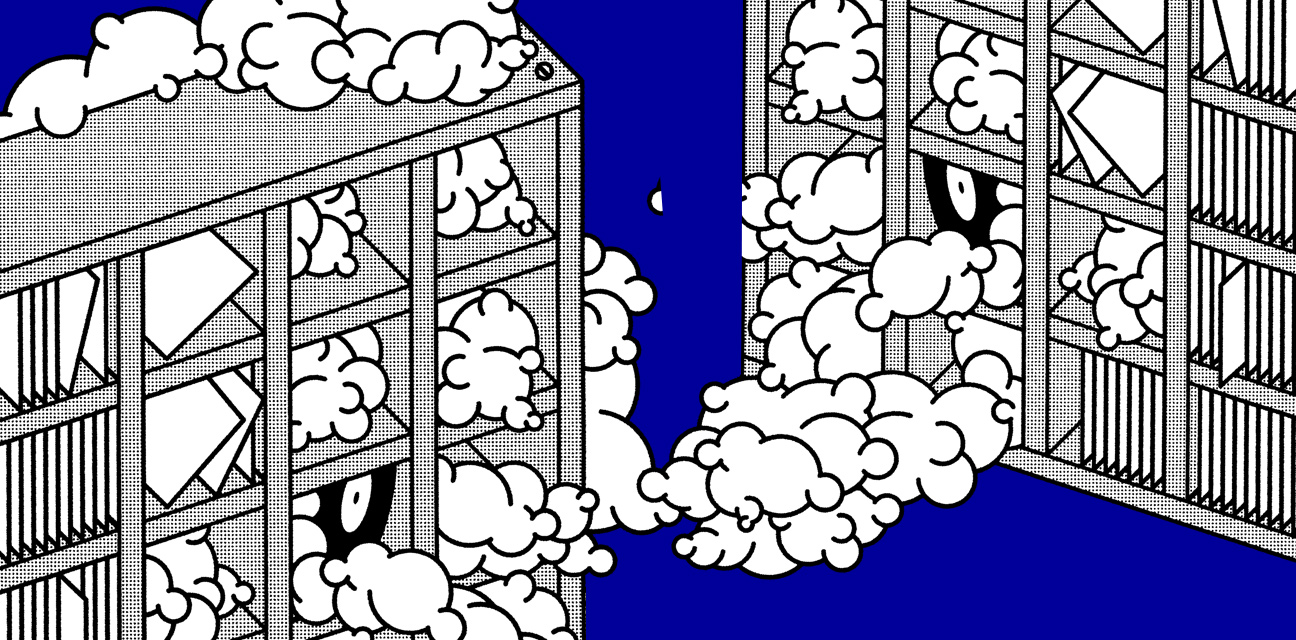Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Club-freie Zeit zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im zweiten Teil des Juli-Rückblicks mit Jon Hassell, Lamin Fofana, Nicolás Jaar und sieben weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.
Für mehr Alben-Reviews folgt diesem Link zu Teil 1.
Jay Glass Dubs – Soma (Berceuse Heroique)

Dub hat seit seiner Entstehung in den frühen 70ern etliche Transformationen und vor allem auch Aneignungen erlebt, und zeitweilig werden seine konstituierenden Prinzipien – tiefe Bässe und jede Menge Delay, um es bewusst verkürzt auf den Punkt zu bringen –, auch nervig-inflationär ge-, wenn nicht missbraucht. Dimitris Papadatos kann man Respektlosigkeit allerdings in keinster Weise vorwerfen, mit seinem Projekt Jay Glass Dubs fügt er dem Genre im Gegenteil eine funkelnde und vor Einfallsreichtum sprühende Facette hinzu. Im Pressetext zum Album benutzt die Plattenfirma ein wirklich schönes Bild zur Beschreibung von Papadatos’ Arbeitsweise: „Stellen Sie sich das Gegenteil einer Schlange vor”, also einen Körper, der beim Gleiten durch die Musikgeschichte überall Partikel aufnimmt und sich dadurch eine neue Schale, ein ganz eigenes Antlitz verschafft. Tatsächlich ist Dub auf Soma nur ein Aspekt unter vielen, wenn auch der, der sich am kontinuierlichsten durch das Album hindurchzieht. Pop, Indie, Hip- und Trip-Hop, Noise und orchestrale, Filmscore-artige Elemente fließen neben etlichen Spielarten der musikalischen Elektronik in Jay Glass Dubs’ Kosmos ein. Werden angesaugt, transformiert und integriert. Im vorletzten Track „Suffix Harness” steigen dann auch noch Spurenelemente von Can aus dem Dub-Nebel, aber bevor sich so etwas wie eklektische Glückseligkeit einstellen kann, grätscht „Invar” mit verzerrtem Orgel-Bordun und Dur-Terror (ja, sowas gibt’s auch) in die Wohlfühlblase. Und lässt nach drei Minuten finalem Zuckerguss erschöpft, aber glücklich zurück in dem Bewusstsein, ein außergewöhnliches Album gehört zu haben, das einen Platz in der Top Fifty dieses Jahres verdient hätte. Und jetzt: Rewind! Mathias Schaffhäuser
John Beltran – The Season Series (Delsin)

Ziemlich wetterfühlig waren Alben von John Beltran schon immer, egal ob er sich Ambient, flockigem Sommer-Techno, Downtempo, IDM oder etwa progressiver Elektronik widmete wie zuletzt auf Hallo Androiden. Stets beschwören seine Arbeiten ausufernde Panoramen in Naturkulisse, die mal einem Emporgleiten durch warme Wolkenfelder am Julihimmel ähneln, mal eher einem sonnigen Novembertag im Wald. Nach Best Of: Ambient Selections 1995-2011 und dem Sampler Music For Machines, auf dem Beltran fantastische Untergrund-Künstler des Ambient-Sektors vorstellt, ist The Season Diaries schon die dritte Kompilation für Delsin Records und ein weiterer Beleg der Qualität seiner Produktionen. Sicher ließe sich berechtigt einwenden, dass deren Formel nach einem guten Vierteljahrhundert mit jedem Release ein Stückchen redundanter werde, doch im Sound des Texturtänzers ist nach wie vor eine Leichtigkeit, ein ehrlicher Optimismus hörbar, an dem Mensch sich noch immer – und gerade 2020 – kaum satthören kann. Da wäre der etwas biedere, aber immerhin sensible Piano-Beat von „Touch The Blooms”, die kühlen Synth-Buildups und Choräle eines „Tundra” oder das akustische Schimmern in „Sunflower” und „Euphoric Dream Ocean”, die beide unwillkürlich Erinnerungen an Beltrans paradiesischen Klassiker Ten Days Of Blue von 1996 wecken. Und das nicht nur wegen der Titel. Es träufeln ebenso sanfte wie schnelle Rhythmen aus Hi-Hats, Snares und Minimal-Bässen über euphorisierende Strings, ultra harmonische Loops entwickeln sich zwischen Meditation und Euphorie, ohne ins Kitschige zu gleiten – das gelingt diesem Album zwar an einigen Stellen bravourös, aber leider nicht an allen. Muss es vielleicht auch nicht. Nils Schlechtriemen
Jon Hassell – Seeing Through Sound (Pentimento Volume Two) (Ndeya)

Verwegene und nicht minder geniale Kunstfälscher wie Wolfgang Beltracchi nutzten das Pentiment eines alten Gemäldes, um ihren eigenen Übermalungen gesteigerte Plastizität zu verleihen. Pentimenti sind dabei Änderungen, die der*die Künstler*in während des ursprünglichen Schaffensprozesses am Werk vornimmt, um dem eigentlichen Bild-Gedanken näherzukommen. Entwerfen, verwerfen, alternieren, übertünchen, ausspachteln – Jon Hassell ist zwar kein Fälscher von Gemälden, doch wirken die surrealen Kompositionen seiner Fourth World Music seit jeher wie aus einer anderen Zeit, einer Paralleldimension gechannelt. Zusammenkomponiert und bearbeitet zwischen Echos einer noch exzentrisch fernen Zukunft. Als postmoderner Eklektiker und Trompeten-Virtuose gelingt es ihm jedoch schon seit Ende der 70er, elektronische Musik, Jazz jedweder Couleur und indigene Klänge aus der ganzen Welt in fremdartigen audiovisuellen Collagen zu verschmelzen, so weit, dass er heute völlig zu Recht als Lichtgestalt exotischer Spielarten wie Acid Jazz oder Tribal Ambient gilt. Auf der Warp-Tochter Ndeya Records erschien 2018 mit Listening To Pictures bereits der erste Teil einer neuen Projektreihe, die seine offenbar endlose Lust am Destillieren und erneuten Vereinen von Musiktraditionen zur Schau stellt. Eingebungen kommen auch bei der zweiten Pentimento-Volume Seeing Through Sound allem Anschein nach direkt aus Hassells Zirbeldrüse, im Taumel von Halbschlaf und Wachtraum realisiert. Schon das einleitende „Fearless” bewegt sich mit Can-artiger Metronom-Rhythmik nebst milchverglasten Texturen auf diesem Grat zwischen Bewusstsein und Delirium, klingt verführerisch schräg, fast schon schalkhaft. Über das tribal-sphärische „Moons Of Titan” führt der Weg durch die Neo-Noir-Atmosphäre von „Delicado” hin zu viszeralen Layern aus Bläsern, Kontrabässen und diffusen Pads in „Lunar”. Zuweilen wirken die Stücke, als würden sie gerade per Satellit aus einer verquarzten Spelunke auf Ganymed übertragen. Auch dem finalen „Timeless” gelingt die Beschwörung solch urban-futuristischer Szenarien auf eine Weise, die immer noch absolut einzigartig ist. Hassell zeigt hier abermals, was Sehen durch Hören tatsächlich bedeuten kann. Nils Schlechtriemen
Kamaal Williams – Wu Hen (Black Focus Records/ Rough Trade)

Kamaal Williams wurde während der UK-Jazz-Welle vor circa vier Jahren von Gilles Peterson in die Gewässer des Re-Rebirth of Cool gespült. Im Gegensatz zur Londoner NuJazz-, Brokenbeats- und Acid-Jazz-Szene, die ebenfalls Mitte der 1990er Jahre stark von Petersons Worldwide-Radioshow verbreitet wurde, steht bei Wu Hen nicht die Elektronik, das Sampling und die Drum Machine im Vordergrund. Leicht konservativ jammt die Komposition in harmonischer Perfektion dahin. Vom wabernden Rhodes-Piano („1989”) über Streicher und Flügel („Toulouse”), Saxophon („Big Rick”) bis zum scheppernden Drumkit-Groove ist alles enthalten, was dem Fusion und Britfunk der 1970er Jahre ebenfalls gut stand. Zum Album sagt Kamaal: „To reach new heights requires separating ourselves from the material world and finding power in what’s intangible. That’s what music and art is for (…) If you’re painting, it’s what you’re feeling as you’re painting. And the person looking at that artwork or listening to that music, they can feel it too, because it’s sincere.” Das ist spätestens seit Roland Barthes und dem Buch Der Tod des Autors in gewisser Weise Bullshit. Denn der*die Rezipient*in stellt auch einen Zusammenhang bezüglich der je spezifisch lesbaren Zeichen her. Die Welt wäre anders, könnten acht Milliarden Menschen genau das fühlen was ein anderer Mensch – nach seinem Dafürhalten – in verschiedene tradierte Zeichensysteme überführt. Thukydides erkannte vor über 2000 Jahren, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Der Poststrukturalismus und die Semiotik hatten ihre Probleme mit Prädikaten wie „aufrichtig”, „echt” und „wahr” im Kontext bürgerlicher Kunst. Es sind sprachliche Distinktions-Versuche – Machtdiskurse – gegenüber anderen, vermeintlich un-/ehrlichen Kulturprodukten bzw. gesellschaftlichen Kreisen. Ähnlich wie das Virtuose der geniale, bürgerliche Shortcut war, um das gottgegebene Genie gegen die Gott-Jesus-Christus-Stammbaum-Machtlinie des mittelalterlichen Adels in Stellung zu bringen (vgl. Giorgio Agamben Was ist ein Dispositiv). Unscharf – entsprechend dem Begriff sincere im Kontext der Kulturproduktion – könnte das bürgerliche Status-Quo-Können von Kamaal Williams auch als handwerklich okay und schöner Retro-Kitsch abgetan werden. Mirko Hecktor
Lamin Fofana – Blues (Black Studies)

Nach dem Regen singen die Vögel. Das ist auch im Eröffnungsstück von Blues so, es regnet, und Vögel singen. Damit deutet Lamin Fofana die derzeitigen Geschehnisse um die Bewegung Black Lives Matter optimistisch: Zeit für einen Neuanfang. Fofana, der in Berlin lebende Produzent, verkörpert selbst die Erfahrung des Black Atlantic: geboren in Sierra Leone an der Küste im Nordosten Afrikas, aufgewachsen im Nachbarstaat Guinea, Übersiedlung in die USA. Und auch in den liner notes zu Blues lässt er einen Schlüsseltext der Black.Atlantic-Theorie zu Wort kommen: Amiri Barakas Blues People aus dem Jahr 1963. Darin erhebt der Dichter seine Stimme für ein neues Selbstbewusstsein afro-amerikanischer Menschen. „(…) tatsächlich ist die amerikanische Kultur geformt von vielen Afrikanismen und enthält diese auch”, so Baraka darin. Auf die Vögel Fofanas folgen weitere Klangcollagen. In „Emanation” glitcht es, „In the Ravine” lässt die Tiere wieder auftauchen und ein Banjo, das Titel- ist ein Meisterstück in Suspense. Musik zur Zeit! Damit beschließt Fofana eine Album-Trilogie, deren Höhepunkt das stärker auf die Sinne ausgerichtete Album Black Studies bildet. Christoph Braun
Luke Vibert – Rave Hop (Hypercolour)
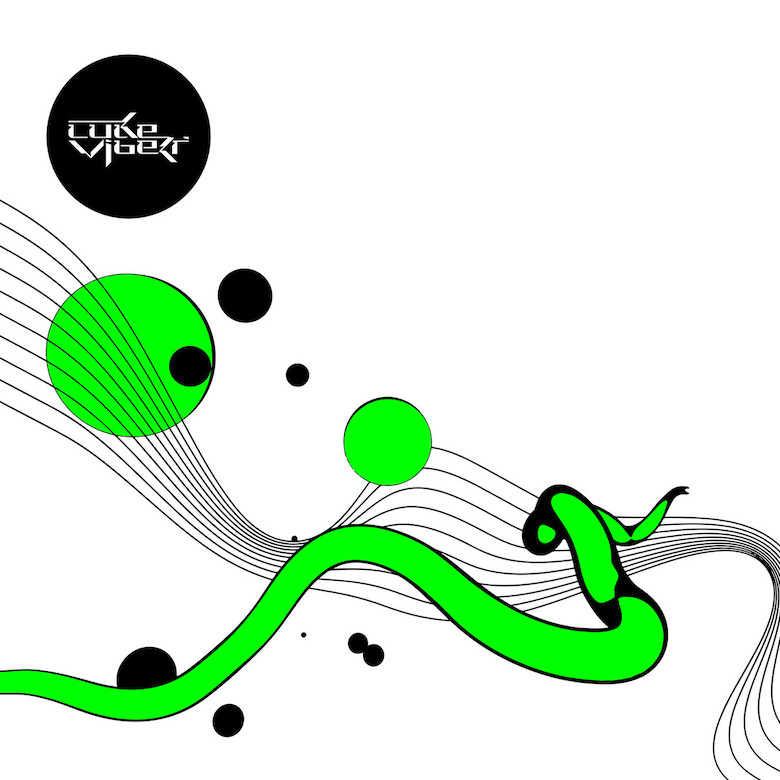
Luke Vibert ist ein vielbeschäftigter Mann. Und ein hoch-kreativer Kopf noch dazu. Anders kann man sich kaum den stetigen, über alle Maße ergiebigen Output dieses britischen Veteranen-Produzenten erklären. Seit den 90ern auf Labels wie Planet Mu oder Mo Wax aktiv, nun im letzten Jahrzehnt besonders beim Vorzeige-Imprint, was Entwicklungen im UK-Hardcore Continuum angeht: Hypercolour. Im Mai erschien Teil eins seiner aktuellen Trilogie für die Londoner, auf der er in jeweils einer bestimmten Ära der Dance Music nach Inspiration und Samples gegraben hat. Während Amen Andrews zunächst das Thema Jungle behandelte und Modern Rave sich mit den Samples und Sounds der frühen Rave- und Breakbeat-Szene auseinandersetzte, widmet Vibert den letzten, nun erschienenen Teil der Trilogie dem Breakbeat-Hip-Hop. Das deutlich farbenfrohere Schlusslicht der Trilogie ist ein atemloser Ritt durch Beats und Vocal-Samples, viele davon bekannt und jahrzehntelang erprobt, andere frisch aus den Archiven gegraben. Funky Riffs reihen sich an souligen Sprechgesang, während die Boombox gehörig herumbassen darf. So lose die Storyline des Albums (eine Aneinanderreihung verschiedener Tracks, ohne sichtbaren Bezug aufeinander), so knackig der schnörkellose Vortrag. Neben aller Hip-Hop-Hommage ist die Rave-Anlehnung mit fetten Synth-Stabs und der gelegentlichen Portion Acid aber auch hier noch zu spüren. Insgesamt ein unterhaltsamer Exkurs, der uns aufzeigt, wie die Geschichte wohl verlaufen wäre, hätten Rave und Hip-Hop Anfang der 90er-Jahre ein gemeinsames Kind gezeugt. Da man mit beiden Genres aber auch heute noch jede Menge Spaß haben kann, kommt dieses Gedankenspiel gerade richtig. Leopold Hutter
Luomo – Vocalcity (20th Anniversary Re-Master) (Ripatti)

Der finnische Produzent Sasu Ripatti, vielen einfach nur als Vladislav Delay bekannt, führt keine glückliche Beziehung mit seinem Alter Ego Luomo. Vor allem mit seinem erfolgreichsten Album Vocalcity aus dem Jahr 2000 hadert er. Ja, er hasst es sogar regelrecht, bringt nun aber in neu gemasterter Fassung eine Wiederveröffentlichung heraus. Wie schlimm war wohl der Mastering-Prozess für ihn? Man muss in diesem Zusammenhang wissen, dass Ripatti ansonsten in doch deutlich experimentelleren Gefilden unterwegs war und ist. Rückblick ins Jahr 2000: Das neue Jahrtausend hatte, je nach mathematischem Blickwinkel, gerade begonnen oder stand kurz bevor. Minimal war eines der Buzzwords der Zeit, man redete über clicks and cuts. Im Mai 2000 erschien auf dem Force Inc.-Sublabel Force Tracks Vocalcity. Ein Album, das einschlug wie eine Bombe. Kaum eine Platte war zeitgeistiger, was irgendwie sehr schnell zum Fluch ebendieses Albums wurde. House-Puristen rümpften angewidert die Nase. Dabei erledigte Ripatti sich hier etwas, das bitter nötig war: Er erneuerte House, griff dabei aber durchaus Elemente des New Yorker Sounds der Neunziger auf (Wild Pitch etwa) oder begab sich in den Schnittmengenbereich zu Dub (Basic Channel/Main Street, Prescription). So sehr Vocalcity damals im Minimal-Kontext betrachtet wurde, so wenig erscheint das heute plausibel. Das Album steht für musikalische Opulenz und Sinnlichkeit, repetitiv zwar, aber wir reden hier ja auch über HOUSE. Dass daraus bald irgendwelcher Microhouse-Quatsch abgeleitet wurde, ist doch nicht die Schuld dieser wunderbaren Musik. Die knappen, aber umso großartigeren Vocal-Parts stehen dabei in der afroamerikanischen House-Tradition, die ihrerseits wiederum eine weltliche Antwort auf Gospel war. Geht es erhebender, als es etwa in „Tessio”, einem der großen, endlos langen Hits dieser Platte, formuliert wird? „Baby, it’s okay, we’ll make it better”, heißt es da. Ist es verwegen, Vocalcity zu einem der besten House-Alben aller Zeiten zu erheben? Eigentlich nicht, denn viele große Alben hat das Genre ja nicht hervorgebracht. Dieses hier ist in den letzten 20 Jahren gewachsen. Man würde sich wünschen, dass dieses seltsame Jahr auf Pause wieder einen ähnlich großen und neuen Entwurf von Clubmusik hervorbringen würde. Denn mal Hand aufs Herz: Dem Sound, der bis zum Lockdown das Geschehen in real existierenden Clubs beherrschte, konnte man doch nur noch mit Zynismus begegnen. Da wäre sogar eine Neuauflage von Microhouse-Derivaten eine Erlösung. Holger Klein
Max Loderbauer – Donnerwetter (Non Standard Productions)

Von frühen Veröffentlichungen auf Teutonic Beats und R&S Records mit Fischerman’s Friend und Sun Electric über zahlreiche ältere und jüngere Projekte wie Ambiq, NSI, Moritz von Oswald Trio, Chica And The Folder oder dem Vladislav Delay Quintet bis hin zu Zusammenarbeiten mit Jacek Sienkiewicz oder immer wieder Ricardo Villalobos: seit mehr als drei Dekaden trägt Max Loderbauer als ruhiger Geist Elementares zur globalen elektronischen Musikkultur bei. Nun Donnerwetter, sein zweites Solo-Album auf Non Standard Productions, dem stets freigeistigen Label seines alten Kumpels Tobias Freund. Neun kurze bis lange Arrangements, die atmosphärisch an die experimentelle Ambient-EP Greyland aus dem Jahr 2017 anschließen. Gespenstische Synth-Welten, feinteilig editiert, ohne dass die Seele auf der Strecke bleibt. Leichte Stücke wie das kurze melodiöse „Lichtmeer” oder das verspulte Auf und Ab der Synth-Schleifen in Die Zeit spenden leuchtende Töne in einem sonst dunklen Reigen aus vernebelten Ambient-Kathedralen, unheilschwangerem Roger-Corman-Drone-Industrial und sensibel blubbernden Lava-Electronics. Ein Album, das beeindruckend unterstreicht, wie sich tatsächlich neu klingende Arrangements mit gekonntem Spiel und tief empfundener Retusche aus analogen Synthesizern hervorzaubern lassen. Dass Max Loderbauer seine Geräte spürt, in ihnen zu leben scheint und ihre geheimsten psychologischen Gemütszustände kennt, zeigt sich nicht allein durch sein emotionales Spiel. Auch die Art, wie seine Stücke aufgebaut sind, sich dramaturgisch entwickeln und kaum spürbar enden, macht ihn zu einem der vielleicht wissensreichsten Synthesizer-Wissenschaftler unserer Zeit, der es versteht, Musik zu kreieren, deren schleierhafter Äther eine unmittelbare Sogwirkung ausbreitet. Vorausgesetzt, das Hi-Fi-Set-Up stimmt und darf ausgereizt werden! Michael Leuffen
Nicolás Jaar – Telas (Other People Digital)
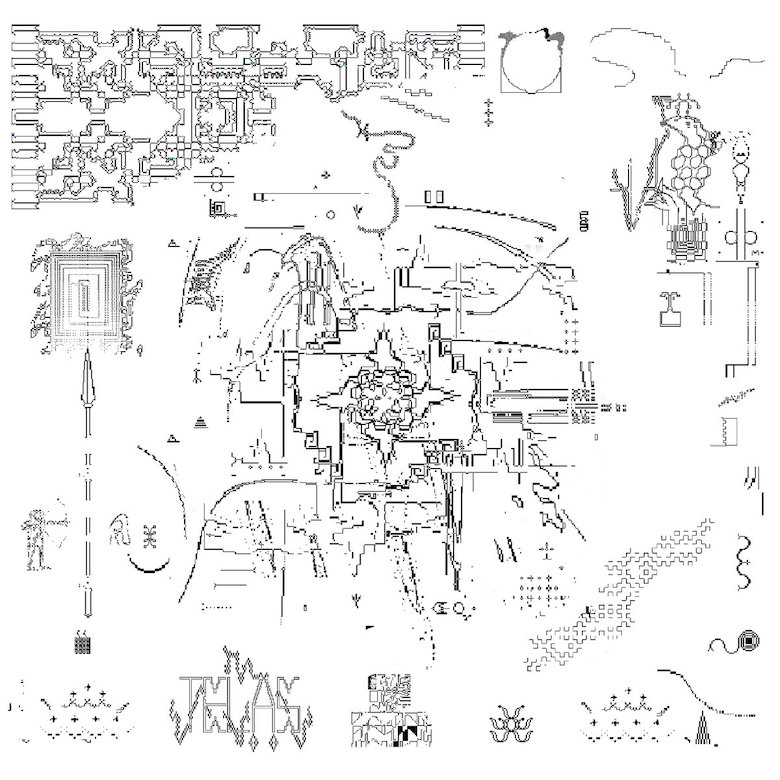
2009 debütierte Nicolás Jaar auf dem New Yorker Label Wolf & Lamb, 2011 erschien sein erstes Album Space is Only Noise, und spätestens ab da wanderte das Bild eines wuschelköpfigen Elektro-Wunderkinds durch die Feuilletons. Die Musik: Ein Konglomerat aus Satie-ähnlichem Piano, Kinderspielplatz-Stimmung, lyrischen Spoken-Word-Einsprengseln, wackligen Beats. Nur wunderte man sich, wie bedingungslos dieser gravitätisch vor sich hin trabende Sound rezipiert wurde. Die wehklagenden Vocals, der ach so traurige Jazz: Schwoll hier nicht einfach eine Überdosis an jugendlichem Weltschmerz aus den Synthies? Es fiel einem nicht schwer, Nicolás Jaar mental in einer Abstellkammer zu parkieren. Aber zehn Jahre später die Überraschung: der chilenisch-amerikanische Künstler holte einen ein. Er überraschte. Sein Album 2012 – 2017 als A.A.L. (Against All Logic) bestach durch eine schartige, dreckige Ästhetik. Die Ohren spitzen darf man jetzt auch bei Telas, das Jaar als bereits drittes Album dieses Jahres veröffentlicht. Die vier Stücke, je fast 15 Minuten lang, zeigen, wie wandlungsfähig seine Musik ist. Was vordergründig in einer schimmernden Fourth-World-Landschaft wurzelt, zirpt, wuselt und vermorpht sich ständig, ist eigentümlich ort-, zeit- und Genre-los. Ein cineastisches Auf und Ab, raschelnd und rauschend, getragen von einem wohlfeil austarierten Spannungsbogen. Bjørn Schaeffner
Nullptr – Future World (CPU)
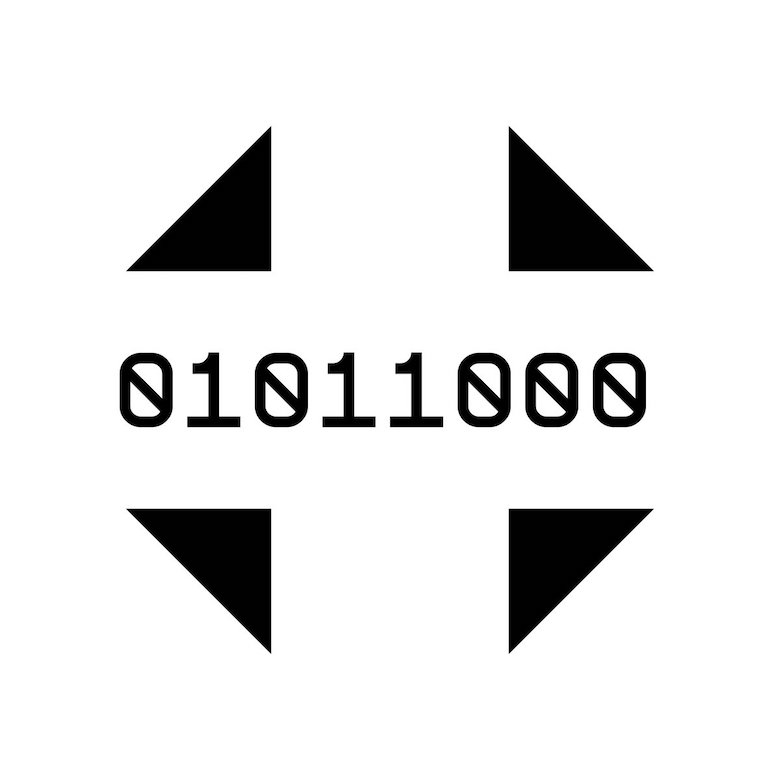
Sheffield hat einiges an prägenden Einflüssen auf die elektronische Musik als Weltkulturerbe zu bewahren. Das Label Central Processing Unit, im Jahr 2012 dort gegründet, mag zwar vielleicht nicht die gleiche Wirkmacht entfalten wie einst Cabaret Voltaire oder Warp Records, doch versammelt diese Plattform eine Vielzahl an Künstler*innen, die Electro aus Jetztzeit-Perspektive produzieren und der Tradition der Stadt zugleich eingedenk sind. Eddie Symons alias Nullptr gehört dazu. Sein zweites Album Future World macht fast schon mustergültig vor, wie man Detroit-Fundamente mit Acid- und Bleep-Ansätzen kombiniert oder ganz einfach gelehrig der Drexciya-Formel folgt. Die schwierige Bezeichnung IDM drängt sich ein wenig auf, Artificial Intelligence ist in diesem Prozessor fest verlötet. Dass die Rechner hier sehr nervös zu zappeln scheinen, wie der starr-aufgekratzte Rhythmus suggeriert, ist kein Wunder bei dem Tempo, in dem sie zwischen an und aus wechseln müssen. Für Entspannung ist in diesem Datenverarbeitungsrhythmus kein Raum. Für Melancholie der Maschinen umso mehr. Eine vertraute Zukunftswelt. Und eine schöne. Tim Caspar Boehme