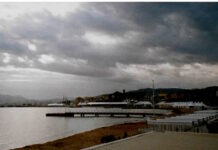Foto: Frank P. Eckert
Die Orgel als historisch immobiles, ortsfestes und wohl wortwörtlich sperrigstes Instrumente der Musikgeschichte des vergangenen Jahrtausends übt eine bleibende Faszination auf vor allem elektronische Künstler*innen und Komponist*innen aus. Der unmittelbar christlichen Konnotation entledigt, bleibt dennoch ein immenser spiritueller Rest, der sich allein schon aus den Räumen ergibt, in denen Orgeln installiert sind. Eben die religiösen und säkularen Kathedralen: Kirchen, Konzerthallen und Philharmonien des 19. und 20. Jahrhunderts.
Wenn nun mit Claire M Singer eine der profiliertesten Komponistinnen der neuen Orgel-Drone-Szene die französische Elektronikpionierin Éliane Radigue, die im Januar 90 wurde, einlädt, ein Stück und ihre erste Komposition für Orgel überhaupt für das Festival Organ Reframed zu schreiben, das kurz vor der Pandemie noch vom Jazzpianisten und Physiker Frédéric Blondy in London aufgeführt werden konnte, dann ist das einfach ein ungeheurer Glücksfall, in dem drei Generationen und drei Zugänge zu Klang sinnstiftend zusammenfanden.
Das gemeinsame Fundament ist einerseits der Minimalismus, der sich im Titel des knapp einstündigen Stücks Occam XXV (Organ Reframed, 5. März) bereits andeutet: eine Referenz auf William von Ockham, der im 13. Jahrhundert eine der Prämissen der modernen Wissenschaft, Theorien und Lösungsansätze nicht unnötig zu vervielfachen und zu verkomplizieren, ausformuliert und popularisiert hat. Zudem der unmittelbare Bezug auf die grundlegendsten Bausteine von Musik, auf Wellen und Resonanzen. Radigue experimentierte mit diesen grundlegenden Zusammenhängen seit mehr als 60 Jahren, lange Zeit an modularem Synthesizer und Tape, später mit dem Sampler und in jüngerer Zeit an akustischen Instrumenten. Radikale Klarheit und Einfachheit, Spiritualität und Körperlichkeit, die Physikalität von Klang an sich finden bei Éliane Radigue schon immer und noch immer auf absolut einzigartige Weise zusammen. Radigues umfangreicher Werkkatalog wird übrigens aktuell von der Groupe de Recherches Musicales (Ina GRM) digital neu aufgelegt. Ein absolut essenzielles, unvergleichliches Hörerlebnis.
Die Harfe, elektrisch verstärkt oder nicht, elektronisch bearbeitet oder nicht, zählt wie die Orgel zu den eigenwilligen Instrumenten mit tiefer Geschichte von der Archaik bis heute und noch reicheren vielfältigeren Assoziationen im Spektrum zwischen spiritueller und hedonistischer Ekstase. Im westlichen Kulturkreis mit einer Tradition, die seit dem späten Mittelalter sowohl im Folk wie in der Klassik ihren unverwechselbaren Eindruck hinterlassen hat. Die Kanadierin Ellen Gibling weiß beides zu verbinden. Sie nutzt ihre klassische Ausbildung am Instrument für erstaunliche Freiheiten. Ihr Debüt The Bend in the Light (Ellen Gibling, 4. März) verbindet klassisch-moderne Virtuosität des Spiels mit Strukturen und Klangbildern, die archaisch wirken, aus uralten Traditionals und Volksweisen stammen könnten. Die besonders im Zusammenhang mit Harfenmusik ein wenig ausgeleierte Metapher des Webens und Knüpfens von Klängen trifft hier tatsächlich den Kern der Musik. Quilts und Wandteppiche mit schwer symbolischen Erzählungen aus fernen oder doch gar nicht so fernen Vergangenheiten.
Der Berliner Harfenist Andy Aquarius bedient optisch ein ähnliches Mittelalter-Klischee, musikalisch allerdings keineswegs. Er nutzt sein Instrument, um der Stille und inneren Versenkung näherzukommen. Sein bereits im vergangenen November erschienenes Debüt Chapel (Hush Hush Records) verbindet auf zartestmögliche Weise wenige wohlüberlegte Tonakzente auf der Harfe mit seiner sparsam eingesetzten Stimme zu einem Album voll von elegischem Ambient-Folk.
Ein anderes schräg-spannendes wie sperriges Instrument ist die Bassklarinette, die Susanna Gartmayer im Wien-Düsseldorfer-Duett SO SNER spielt. Mit Stefan „Mapstation” Schneider an den pluckernden Maschinen entfaltet das seit 2015 in konstitutivem Fluss befindliche Debüt Reime (TAL Music, 25. Februar) lockere Sofa-Grooves, von Gartmayers freejazziger Klarinette auf angenehmste Weise umflattert, umflittert und umbrummt. Toll, dass eine so tief experimentelle und freie Musik so konkret körperlich und doch entspannt und krampflos daherkommen kann.
Sowieso speziell die Klarinette, selbst in ihrer herkömmlich schlanken Form. Das Berliner Duo The International Nothing nimmt zwei Klarinetten streng getrennt in die zwei Stereo-Kanäle und macht damit interessante elektronische und elektroakustische Dinge. Manchmal darf das Instrument dabei klanglich nah am Holz bleiben, öfter werden daraus jedoch Feedback und mikrotonaler Drone. Auf Just None of These Things (Ftarri/Nichts.Klingt.Org) auf 45 faszinierende Minuten ausgebreitet. Die Vinylversion des Albums auf dem japanischen Label Ftarri wird übrigens wohl erst im Herbst dieses Jahres erscheinen.
Und die menschliche Stimme ist das abgefahrenste aller Instrumente, zumindest so, wie Kee Avil sie auf Crease (Constellation, 11. März) einsetzt. Ganz schön scary und in einem losen Zusammenhang collagierter Soundsplitter, kommt das Soloprojekt der kanadischen Free-Improv und Noise-Rock-Gitarristin Vicky Mettler bemerkenswert unversöhnlich daher und findet doch immer zu Songs im weitesten Sinne. Hochspannend, wie sich das Album tendenziell querlegt zu allen Rock- oder Jazz-Avantgarde-Traditionen und Abstammungslinien von Industrial oder Noise, wahlweise Diamanda Galás, Meredith Monk, John Zorn, Chris & Cosey oder Coil. Diese und viele mehr lassen sich eventuell heraushören, sind aber in ein crunchy-digitales Sounddesign eingebettet, das etwas anderes vermittelt. Und im nächsten Stück dann akustische Gitarre und unverzerrte Stimme, ein purer, klarer Song, das passt ebenso. Musik, die obenrum und untenrum freier ist als so Manches.