Rewind 2022: Jedes Jahr das gleiche Spiel – alle überbieten sich kurz vor Schluss nochmal mit Superlativen. Wir ziehen mit, möchten dabei aber deutlich machen: Es war unmöglich und wird es auch in Zukunft bleiben, sich auf auf eine Zahl X an Platten zu begrenzen, die ein ganzes Jahr zu dem gemacht haben sollen, was es war. Trotzdem denken wir, dass die folgenden Alben etwas über das Musikjahr aussagen. Darüber, welche Sounds und Themen wichtig waren, welche Produzent:innen die Szene besonders prägten, oder sogar, welche Aspekte im Hintergrundrauschen zu kurz kamen.
Weil das an sich schon erschlagend genug ist, begnügen wir uns mit einer alphabetischen Auflistung und beschränken uns auf nur 20 Alben. Dabei haben wir alleine in unseren monatlichen Reviews jeweils zehn bis 20 Alben besprochen, euch außerdem zwölf Alben des Monats präsentiert. Musik lässt sich in keine geordnete, verknappte Reihenfolge bringen. Sie ist ein lautes Miteinander von Stimmen, wie es diese 20 Alben des Jahres 2022 hoffentlich erneut exemplarisch zum Ausdruck bringen.
Sämtliche Features, Listen und Best ofs aus dem diesjährigen Jahresrückblick findet ihr hier.
Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – Topical Dancer (DEEWEE)
Charlotte Adigéry und ihr Musik-Kompagnon Bolis Pupul bilden den Kern von WWWater, einem gnadenbringenden Riot-R’n’B-Outfit. Nur zu zweit veröffentlichen die beiden nun ihr Debütalbum Topical Dancer, das von Soulwax (auch in WWWater involviert) produziert worden ist. Wo dort Selbstbehauptung und Stärke die Hashtags stellen, ist es unter den beiden Eigennamen das Zwinkern. Das Blinzelauge ist das Medium.
„Hallo, Charlotte”, hebt das Intro an, und wir hören zig Telefonbegrüßungen von der und für die Sängerin. In „Esperanto” thematisiert die Sängerin einen Haufen Zuschreibungen, denen sie weder zu- noch entgegenstimmen möchte. „Blenda” greift das thematisch auf und erzählt von den Mutmaßungen und rassistischen Aussagen, mit denen sich die junge, belgisch-afrokaribische Frau in ihrem Alltag konfrontiert sieht. Dabei singt Adigéry mit einem Spiel in der Stimme, sie zitiert die Dumpfies und macht gleichzeitig easy swingenden Electro-Pop daraus. „Making Sense Stop” etwa spielt an auf den poststrukturalistischen Titel unter den Konzertfilmen, nämlich Stop Making Sense der Talking Heads aus dem Jahr 1984. Quiekende Gitarren und manipulierte Stimmen steigen hier in ein Yellow Cab der beschworenen Dekade. Mit „HAHA” und seinen Lach-Variationen schafft das Album abermals einen Topic-Hit (hahaha), und „Thank You” beendet die Sammlung mit ausgebreiteten Armen. Christoph Braun

Fort Romeau – Beings Of Light (Ghostly International)
Projektionen sind es, die den Kern von Beings Of Light, Michael Greenes drittem Album, seinem zweiten für Ghostly International, ausmachen. Blitzlichtschnappschüsse aus der New Yorker Clublandschaft ziehen in „Spotlights” vor dem inneren Auge vorbei, während „Ramona” sich ganz explizit auf das Robert Johnson bezieht: Den Groove habe er mit dem Soundsystem des Offenbacher Clubs im Hinterkopf entwickelt, so Greene, „auch mit einer starken Anlehnung an die modernere Linie der außergewöhnlichen Minimal-House-Musik aus Frankfurt”.
Tatsächlich orientiert sich die Digitalästhetik des britischen Producers stark an den Reduktions- und Redundanzverschaltungen des Genres. Spezifisch ist indes sein Umgang mit Harmoniewechseln, mit am schönsten gleich im Opener „Untitled IV”. In vielen der acht neuen Tracks beschäftigt sich Fort Romeau auch mit der menschlichen Stimme: Chorfragmente, geloopte Interjektionen („The Truth”) oder auch Spoken-Word-Lyrics wie in „Power of Grace”, das seinen Titel dem Covermotiv, einer Fotoarbeit des US-amerikanischen Künstlers Steven F. Arnold, entlehnt.
Der darin aufgerufene Hedonismus (Formentera, Dalí, The Cockettes) wird durch die melancholische Grundstimmung, die das Album durchzieht, gleichsam moderiert. Mit „(In The) Rain” und „Porta Coeli” unterstreicht Greene seine Ambient-Kompetenz. Wenn auch kein komplettes Meisterwerk, gelingt Fort Romeau mit Beings Of Light doch ein ausgesprochen bemerkenswertes, wohltemperiertes Minimal-House-Album. Harry Schmidt

Huerco S. – Plonk (Incienso)
Wenn Incienso eine neue Veröffentlichung ankündigt, ist es an der Zeit aufzuhorchen. Das New Yorker Label liefert konstante Sensationen, seien es die Nene-H-Auskopplungen oder DJ Pythons Traumexpeditionen. Jetzt ist Brian Leeds an der Reihe, der unter seinem Pseudonym Huerco S. nach sechs Jahren ein neues Album vorstellt.
Während das letzte Werk von 2016 von weichen Ambient-Drones ummantelt war, konzentriert sich Plonk klar auf maschinelle Aspekte und entstammt laut Aussage des Künstlers seiner jugendlichen Leidenschaft für Rallyeautos, was in diesem Zusammenhang wahrscheinlich allegorisch verstanden werden soll. Sehr konzeptig angelegt wirkt das Ganze wie eine Art Installationsmusik und passt sich damit ästhetisch gut in einen kontemporären Rahmen ein.
Hervorragend produziert, wuseln verschiedenartigste Synth-Stimmen durcheinander, begleitet von groovigen Orgeln oder fluoreszierenden Strings wie in „Plonk VI”. Es wirkt, als würden emaillierte Schalentiere weich abgegossen, um später als feine Späne behutsam in die Umgebung zu diffundieren. Nach vorrangig drahtigen, kühleren Klängen überrascht das Finale ab „Plonk IX” mit krabbeliger Urbanität, die von der ein oder anderen Actress-EP inspiriert sein dürfte. Wesentlich sind dabei auch die konstant schimmernden Flächen, die bei fast allen Tracks irgendwann die Überhand gewinnen und eine Atmosphäre schaffen, die anregt aber nie überfordert. Lucas Hösel

Melchior Productions Ltd – Vulnerabilities (Perlon)
Für sein zweites Album hat sich Thomas Melchior ganze 15 Jahre Zeit gelassen. Eine lange Zeit, über die sich eingefleischte Fans leider nur mit sehr wenigen 12-Inches des Wahlberliners und Perlon-Familienmitglieds retten konnten. Daher ist die Freude groß, ein 3×12-Inch-Paket in Händen halten zu können. Das heißt: Es ist genug Platz für die elf Tracks, um sich klanglich auf Vinyl zu entfalten.
Der Titel greift Melchiors Affinität zu feinstofflichen Ebenen hinter den mit unseren fünf Sinnen wahrnehmbaren Realitäten auf. Auch die Liedtitel deuten verschiedene Introspektionen und Zustände des Geistes wie „Catharsis”, „Depressed Fun Seekers”, „Mind Diving” und „Adriana’s Anxieties” an. Die Verletzlichkeit der Seele ist in Wirklichkeit ihre größte, alles überstrahlende Stärke. In der Limitierung und Reduktion liegt ein Schatz der Freiheit des Geistes. Sie räumt auf und schafft Platz für das Neue.
Die Hingabe und Konzentration auf wenige Elemente findet sich in Melchiors Produktionen immer wieder, das Wesentliche bekommt in seinen Tracks viel Platz und Freiheit, um zu wirken. So entstehen Stücke, die es schaffen, leichte und luftige Strukturen und Texturen mit einer ungeheuren Klangdichte zu verbinden. Schönes Beispiel ist das bereits 2021 erschienene „Closer”. Zart gehauchte, fast flüchtige Melodien umgarnen einen sanft hüpfenden Housebeat und lassen eine Zerbrechlichkeit entstehen, deren elegische Schönheit wiederum Kraft und Stärke formt. Robert Gobler

Shinichi Atobe – Love of Plastic (DDS)
Schon von der im Jahr 2001 veröffentlichten Debüt-EP von Shinichi Atobe auf Chain Reaction ging ein sonderbarer Glanz aus. Ship-Scope war das perfekte Chain-Reaction-Release, weil es den knisternden Dub Techno des von Mark Ernestus und Moritz von Oswald betriebenen Labels als Ausgangspunkt dafür nahm, das Leben nicht einfach nur zu abstrahieren, sondern zu bejahen.
Der Rest der Geschichte ist bekannt, der Rest der Geschichte ist verworren: 13 Jahre lang war nichts mehr von dem angeblich in Saitama lebenden Japaner zu hören, bis ihn Miles Whittaker und Sean Canty nach ein paar E-Mails wieder dazu bewegen konnten, neues Material einzusenden. Seitdem erscheinen regelmäßig neue Alben von ihm. Sogar ein Bild wurde veröffentlicht, das scheinbar die Zweifel über seine Identität – gemutmaßt wurde unter anderem, es handle sich lediglich um ein Nebenprojekt anderer Artists aus dem Chain-Reaction-Umfeld, vielleicht sogar um Demdike Stare selbst – aus dem Weg räumten.
Ein neues Album von Shinichi Atobe ist Anfang 2022 nicht mehr das Event, das die Veröffentlichung von Butterfly Effect vor acht Jahren darstellte. Zwischen der Rückkehr des Produzenten, die gleichermaßen fulminant wie understated wirkte, und Love of Plastic liegen schließlich vier weitere LPs, und in einer Musikwelt, in der die Affekte gemeinhin durch Verknappung geregelt werden, kühlen sie angesichts einer solchen Schlagdichte merklich ab.
Das macht es allerdings auch einfacher, sich auf die Musik zu konzentrieren. Nachdem Atobe mit Yes einen großen Trostspender in den ersten Pandemiesommer entließ und dafür seinen Sound merklich aufpolierte, führt Love of Plastic dies nun mit bescheidenen Gesten fort. Die Aufgekratztheit früherer Releases ist ab dem dubbigen Intro spürbar, doch weicht die noch bis Heat so dominante Klangsignatur – rostig, porös, angestaubte Hardware – zunehmend dem wohligen Hochglanz, der schon Yes zu einem besonderen Album machte.
„Love of Plastic 1” bietet nach dem kurzen Auftakt bouncigen House mit donnernden und doch wabernden Chords, einer sonderbaren Spielautomatenmelodie und schließlich käsigen Pianosplittern, die eher an Robert Miles’ „Children”, denn an Marshall Jeffersons „Move Your Body” denken lassen. Das weitschweifige Pathos Atobes nämlich ist kein nostalgisches. Es richtet sich nicht in die Vergangenheit zurück, sondern in den Raum.
Das neuneinhalbminütige „Love of Plastic 5” beispielsweise tuckert, von scharfkantigen Hi-Hats akzentuiert, gleichermaßen schleppend wie rasend von einem emotionalen Plateau zum nächsten. Atobe lässt eine repetitive Melodie über einem eng verzahnten Miteinander von Chords und Bass schweben und ausfaden, damit die nächste übernehmen und die Sache in eine andere Richtung führen kann. Der Sound treibt diesen Track in beiden Bedeutungen dieses Worts.
So lässt Atobe selbst rumorenden Quasi-Acid („Love of Plastic 8”) unbeschwert klingen, ein knapp zweiminütiges, auf einer einzigen zittrigen Chordsequenz basierendes Stück („Loop 6”) wie eine halbe Ewigkeit scheinen. Selbst wenn die Preset-Trompeten quietschen („Love of Plastic 6”) oder die Keys Melodien spielen, die in ihrem dilettantischen Übermut an schiefe Synth-Pop-Heimaufnahmen aus den frühen Achtzigern denken lassen („Ocean 2”), verstecken sich dahinter keine ironischen Gesten. Sondern ein Angebot, sich darauf einzulassen.
Die Liebe zum Plastik, zum billigen, glänzenden Material, das wir Techno nennen, sie geht auf dieser Platte tief. Auch wenn der Ton wie in den komplexen Rhythmen von „Beyond the Pale” mal rauer wird und IDM-Tropen aus den frühen Neunzigern aufruft, ändert das nichts an diesem Eindruck. Und wenn Love of Plastic schließlich mit „Severina” auf einem fast schon klassischen, von durchschneidenden Chord-Stabs kontrapunktierten Chain-Reaction-Beat endet und den aber von noch mehr Fake-Trompeten und Glockentönen, die an ein Windspiel erinnern, umspielen lässt, ist der verwirrende Gesamteindruck endgültig perfekt.
Es entsteht im Verlaufe dieses Albums kein Flow, der auf ein Ziel hinausläuft. Vermittelt wird stattdessen ein Gefühl, das jedes dieser diskret für sich stehenden Stücke durchwirkt. Eines von der Weite einer Welt, die mit dieser Musik bequem vom Bett aus vermessen werden kann. Das macht aus Love of Plastic erst recht nicht das große Event, das die überraschende Veröffentlichung des Albums im ersten Moment darzustellen schien. Was es stattdessen bietet, ist allerdings viel besser: eine Abfolge von neun in die Länge gezogenen Momenten, ein sonderbarer Glanz. Kristoffer Cornils

Space Ghost – Private Paradise (Pacific Rhythm)
Im letzten Jahr hat der aus dem kalifornischen Oakland kommende Produzent Sudi Wachspress mit Dance Planet sein bisher bestes Album veröffentlicht. Vom dänischen Label Tartelet, wo seine letzten drei Longplayer erschienen sind, hat sich der US-Amerikaner zumindest für den Moment verabschiedet. Den Zuschlag für Private Paradise hat das kanadische Label Pacific Rhythm erhalten. Dass Wachspress ein großer Fan von Larry Heard ist, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Ein Geheimnis hat der Produzent daraus auch niemals gemacht. Während sein 2019er-Album Aquarium Nightclub noch um klassische Mr.-Fingers-Tracks kreiste, erinnerte Dance Planet mit seinen gesprochenen Vocals und Frühneunziger-R’n’B-Anklängen mehr als nur ein bisschen an das völlig unterbewertete The–It-Album On Top of the World. The It wiederum ist ein weiteres Projekt von Larry Heard, der sich damals mit dem Vokalisten Harry Dennis zusammentat.
Die acht Tracks auf dem neuen Space-Ghost-Album lassen House nun recht weit hinter sich. Stattdessen folgt Wachspress auf Private Paradise dem Ruf nach innerer Einkehr, der sich hier zwischen Ambient, New Age und Deep House an der Schwelle zum Chillout-Raum manifestiert. Ohne Larry-Heard-Verweise geht es auch dieses Mal nicht. Die Spuren führen zu den beiden Sceneries-Not-Songs-Alben, mit denen Heard um 1995 herum einen ähnlichen Weg eingeschlagen hatte. Aber eine Space-Ghost-Platte wäre keine Space-Ghost-Platte, wenn man sich über zufällige Ähnlichkeiten nicht riesig freuen würde. Holger Klein

Sven Väth – Catharsis (Cocoon Recordings)
Katharsis: seelische Reinigung als Wirkung der antiken Tragödie; psychische Reinigung durch das Ausleben von inneren Konflikten und Emotionen. Die letzten beiden Corona-Jahre waren in der knapp 40-jährigen Karriere von Deutschlands einflussreichstem DJ sicherlich nicht die leichtesten. Dennoch ist Catharsis nicht einfach eine Ersatzbaustelle. Ursprünglich zur gemeinsamen Produktion der Feiern-EP zusammengekommen, hatte das Gespann aus Gregor Tresher und Sven Väth in den vergangenen Monaten einen echten Lauf und zelebriert zusammen das sechste reguläre Studioalbum von Babba Väth.
Der Opener „What I Used to Play” ist dabei als Programm zu verstehen, „my musical footprints from different decades” oszillieren durch den Klangraum, und ja, dabei darf auch wieder Sven Väths bassbetonte Stimme die besonderen Wiedererkennungswerte setzen. In diesem Sinne hatten schließlich auch die Vorauskopplungen „Mystic Voices” und vor allem „Feiern” das Feld bestellt, aber damit ist das Spektrum des Dreamteams aus Väth und Tresher im Jahr 2022 nur angerissen. Auch hochfrequente Schädeldeckenbearbeitungen wie „The Worm”, futurisch acidinspirierte Noiseattacken („Nyx”) oder tribale Vollbedienung mit orientalem Einschlag („Catharsis”) etablieren sich auf modernistischen Tanzflächen mit weniger Hang zum Song. Und nicht zuletzt machen Listening-Juwele wie die romantische Electro-Liebeshymne „The Inner Voice” oder der gravitätische Ambient-Traum „Panta Rhei” ein rundum gelungenes Album komplett. „We are what our thoughts have made us” – in der Tat, besser hätte es niemand zusammenfassen können. Jochen Ditschler

Axel Boman – LUZ / Quest For Fire (Studio Barnhus)
Neun Jahre sind vergangen, seitdem der schwedische Produzent Axel Boman sein Debütalbum Family Vacation veröffentlichte. In dieser Zeit erwies sich die Platte als ungewöhnlich langlebig und verschwand eben nicht bereits nach wenigen Wochen aus dem Wahrnehmungsfeld. Vielleicht verzichtete Boman deshalb darauf, mit Ausnahme der Serien-LP Le New Life auf Mule Musiq, allzu schnell einen Nachfolger aufs Gleis zu bringen. Jetzt sind es mit den verschwisterten Alben LUZ und Quest For Fire gleich zwei auf einen Schlag geworden. Warum der Schwede sich so entschieden hat – wir wissen es nicht. Vielleicht kann er die epische Unübersichtlichkeit von sogenannten Doppelalben einfach nicht ausstehen.
Jedenfalls unterscheiden sich LUZ und Quest For Fire nicht grundsätzlich – im Vinylformat koexistieren auch beide auf drei Platten. Wenn man will, kann man LUZ als das sonnigere von zwei ziemlich sonnigen Alben betrachten. Aber auch nur vielleicht, denn der Quest-For-Fire-Opener „Sottopassagio” kommt mit DJ-Mehdi-French-Touch-Gitarren und den zarten Vocals des schwedischen Indie-Pop-Duos Miljon maximal Tropical-Disco-mäßig daher. Dieser balearische Vibe, er zieht sich durch beide Alben.
Doch Axel Boman wäre nicht Axel Boman, wenn seine detailversessenen Tracks nicht immer auch ein wenig neben der Spur laufen würden. Insofern hat sich die Welt des Produzenten aus Stockholm seit seinem ersten Hit „Purple Drank” nicht wesentlich verändert. Die Augen, mit denen diese 18 neuen Tracks die Welt sehen, blinzeln stets ein wenig, der Blick ist oft verschwommen, was nicht zuletzt an Bomans Liebe zu Dub-Techniken und spacigen Sounds liegt. Toll ist der völlig entrückte Acid-Track „Cacti Is Plural”. Wenn im nächsten Stück plötzlich der Saxofonist Kristian Harborg seinen Auftritt hat, mag man für einen Augenblick verunsichert sein. Aber auch hier wahrt Axel Boman Haltung. Sun Ra für Anfänger:innen trifft auf einen schleppenden Breakbeat. Alles gut. Ob LUZ und Quest For Fire einen so langen Atem wie Family Vacation haben werden, wird sich zeigen. Beide Alben gehören aber zum Allerbesten, was wir in diesem Jahr gehört haben. Holger Klein

Batu – Opal (Timedance)
Nach einem Jahrzehnt des Wilderns im abseitigen Elektronik-Spektrum, nach über einem Dutzend Singles und EPs, Gigs rund um den Globus, tanzbaren wie subtileren Drops, ist Omar McCutcheon angekommen. Nicht am kreativen Schachtende, viel mehr in seiner eigenen Nische, die er akribisch aus dem Gesteinsbett moderner elektronischer Musik herausmeißelt. Den daraus resultierenden Soundskulpturen ringt er ein ums andere Mal neue Formen, neue Facetten und Brüche ab, die sich einer konkreten Taxonomie erfolgreich entziehen.
Verschiedene Stationen passierte diese Entwicklung seither. Als McCutcheon in Oxfordshire aufwuchs, waren Dub, Jazz und Punk gängiger Soundtrack im ungemein musikvernarrten Elternhaus. Während der frühen 2000er trieb er sich dann auf dubstepforum.com herum, arbeitete mit verschiedenen DAWs, feilte an Produktionsskills und begann schließlich, seinen Output unter dem Namen Streamizm direkt aus seinem Schlafzimmer in den Äther zu pusten. Dass er anschließend an der Bath Spa University einen Kurs für Music Production belegte, war technisch lehrreich, öffnete aber vor allem den Zugang zur pulsierenden Dubstep-Szene Bristols, die während der 2000er den britischen Zweig des Genres maßgeblich beeinflusste. Hier traf McCutcheon, der inzwischen den Künstlernamen Batu angenommen hat, auf gestandene Producer vom Kaliber Bruce und Ploy, Peverelist und Pinch, mit denen sich Kollaborationen und kreative Ambitionen fürs nächste Level anbahnten.
Das enterte Batu dann konsequenterweise 2015, als er sein eigenes Label Timedance ins Leben rief. „Es gibt da draußen nicht viel Raum für junge Leute, unter denen zweifellos einige der kreativsten Köpfe zu finden sind – deshalb glaube ich, das eigene Ding zu verfolgen, das eigene Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sichert die Selbstbestimmung und zahlt sich auf lange Sicht immer aus”, sagte er ein paar Jahre später im Interview mit XLR8R. Nicht nur die beiden herausragenden EPs Monolith (2016) und Murmur (2017) erschienen hier in kurzem Abstand, auch Freunde und Kollegen wie der bereits erwähnte Ploy, aber auch Lurka, Giant Swan oder Air Max ’97 veröffentlichten via Timedance, was beträchtlich zur Profilierung des Labels innerhalb der Szene Bristols beitrug. Schnell war es Teil des sich ständig neu formierenden städtischen Untergrunds, sodass Batu mit anderen Akteuren wie Deep Nalström, Ben UFO oder Objekt in Kontakt kam und den eigenen kreativen Horizont, aber ebenso sein Publikum erweitern konnte, etwa über Labels wie Hessle Audio oder XL Recordings. Trotzdem: Im Fokus blieb stets seine Heimatstadt, die Entwicklung eigener Produktionsansätze jenseits von Dubstep sowie die Kuration von Timedance, der er nach wie vor einen Großteil seiner Zeit widmet.
Hier erschien nun folgerichtig das Debüt-Album Opal, auf dem Batu Tribal-vertrackten UK Bass mit Breakbeats, kühl ausgedehnten Flächen und Techno-Sensibilitäten anreichert – einerseits klingt das wie ein Derivat bisheriger Releases, andererseits aber auch nach einer fortgesetzten Emanzipation von ebendiesen. Körperliche Samples wie im statisch schimmernden „Mineral Veins” werden in fein ziselierte Rhythmusfiguren integriert, deren gesondertes Augenmerk für Modulation und winzigste Details zu jeder Sekunde spürbar bleibt.
Ein gewisses Understatement liegt dem Album zugrunde, lässt Melodien und Beatpatterns gleichwertig ineinandergreifen, was erfolgreich jeden Anflug überproduzierter Dekonstruktion verhindert. Exemplarisch ist das im brillant sequenzierten „Atavism” hörbar, dem innerhalb eines IDM-Gerüsts säurehaltige Akkordfolgen gelingen, ohne dass die Myriaden sorgsam integrierter Samplefragmente und Shots dazwischen untergehen würden. Doch selbst aus sphärischen Tracks ” à la „Solace” (mit Vocals von serpentwithfeet) oder dem abschließenden „Always There”, denen mehr an einer delikaten Pad-Progression mittels opaleszenter Klangfarben gelegen ist, kitzelt Batu die richtige Balance aus Mikro- und Makrodesign. Dass er dieses Gespür künftig noch weiter kultiviert, ist die große Hoffnung, mit der Opal einen am Ende zurücklässt. Nils Schlechtriemen

Dopplereffekt – Neurotelepathy (Leisure System)
Mit Dopplereffekt ist es ein bisschen wie mit Drexciya, man denkt bei diesen Projekten gern in der Vergangenheit, an die heroische Phase des Techno in den Neunzigern. Dabei sind das Duo Gerald Donald alias Rudolf Klorzeiger und Michaela To-Nhan Bertel alias To-Nhan als Dopplereffekt bis heute aktiv, selbst wenn sie sich mit ihren Veröffentlichungen Zeit lassen.
Auf Neurotelepathy bleiben sie ihrem Konzept des Futurismus treu, diesmal sind es Forschungen rund um das Gehirn, die den einzelnen Nummern ihre Namen geben. Ob sich das hörbar in Musik übersetzt, sei dahingestellt, ist aber auch nicht so wichtig. Dafür klingen Titel wie „Neuroplasticity”, „Cerebral to Cerebral Interface” oder „Transcranial Magnetic Stimulation” einfach passend-cool im Sinn von distanziert-technisch. Und das findet sich in der Musik allemal wieder. Dopplereffekt hatten im Vergleich zu Drexciya immer den kantigeren Maschinen-Funk, und den gibt es auch hier, in gar nicht mal so sehr routinierter als vielmehr liebevoller Perfektion. Beatlos agieren sie lediglich in einer Handvoll Tracks, beim ersten, „Epigenetic Modulation”, hat die Komponistin Christina Vantzou für zusätzliche modulare Verschaltungen gesorgt. Musik, mit der sich die synaptische Plastizität vorzüglich anregen lässt. Tim Caspar Boehme

Innere Tueren – Opening Night (A Futura Memoria)
Das Debütalbum von Ergin Erteber auf Kann begeisterte mit einem ganz eigenen Sound zwischen großen Pop-Gesten und wunderbarer 90er-Jahre-Electronica, deren verzaubernde Romantik sich auch in den gerne mal die Grenze zum Pathos überschreitenden Titelbezeichnungen wie „In Her Wilderness Is My Shelter” Bahn brach. Das überzeugte vor allem, weil es so zwischen allen Stühlen stand und sich auch nicht vor großen Gefühlen scheute.
Auf Opening Night geht es nun wesentlich skizzenhafter zu. Getragen von Field Recordings und Samples, verwebt der Leipziger hier eine ganze Reihe von Klängen zu einem konstanten Soundteppich, der nicht nur stark nach Film Noir und Hitchcock klingt, sondern auch von John Cassavetes‘ gleichnamigem Film inspiriert wurde. Der große Pathos findet hier nur noch in den immer noch sehr schmachtenden Titelnamen statt („An Unrequited Love”) und ist ansonsten einem wesentlich weniger greifbaren Ansatz gewichen, der vor allem auf Atmosphäre, Soundfragmente und eine in sich sehr geschlossene Dichte setzt und damit mehr Raum für Interpretation und Assoziation lässt. Stefan Dietze
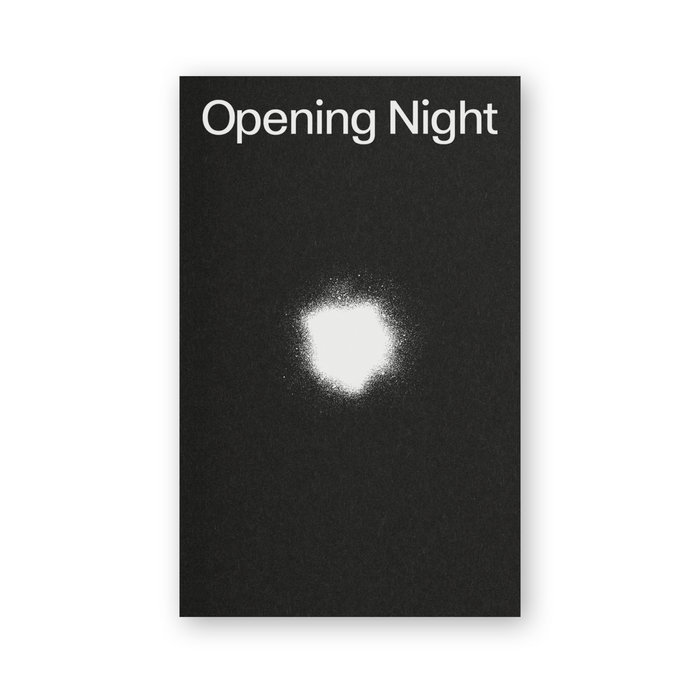
Mathilde Nobel – May + Be (Nous’klaer)
Nous’klaer wiederveröffentlichen Mathilde Nobels bereits 2019 im Eigenvertrieb veröffentlichtes Debüt-Album, ein düster schimmerndes Kleinod moderner Electronica. Nobels gelassene, mäandernd sich entwickelnde Kompositionen erinnern einerseits an klassische britische IDM-Produktionen, etwa von Autechre oder Black Dog Productions/Plaid – ohne jedoch wie bloße Kopien zu erscheinen. Dazu gesellen sich klimpernde Melodien, im Hintergrund des Hörens perlend verrauscht wie eine modernisierte Version der Gymnopédien Erik Saties.
Andererseits hat die Atmosphäre auch etwas von mittelalterlicher Folklore in modern elektrisiertem Gewand. Spätestens aber dann, wenn Nobel in der zweiten Hälfte des Albums, ab dem Titeltrack May + Be nämlich, ihre Stimme einsetzt, wird klar, durch welche gotische Kathedrale hier der Wind weht. Denn die verhallte Melancholie von Nobels Gesang, mal flüsternd, mal traurig schwelend, erinnert sicher nicht von ungefähr an Darkwave-Klassiker wie This Mortal Coil, Dead Can Dance oder Coil in ihren traurigsten Momenten. Sie komplettiert die zuvor schon erhabene Schönheit durch eine human-organische Komponente. Wie gesagt, ein düsteres Kleinod. Tim Lorenz

Perel – Jesus Was An Alien (Kompakt)
Er heißt Jesus Christus in der Theologie und Jesus von Nazareth in der weltlichen Geschichtsschreibung. Er hat schon weirde Dinge gemacht. Das ging los mit der Geburt, in einer Scheune, beleuchtet von einem enormen Kometen, beschenkt mit Weihrauch und anderem trippigen Material, sodass Hirten und Engel mitten in der kalten Bethlehemer Nacht zusammen eine Freiluft-Party feierten. Dann ist er drei Tage nach seinem Tod wieder auferstanden. Auch das war merkwürdig, seine engsten Leute erkannten ihn danach nicht wieder und statt irgendwann ins Grab hinabzusteigen, soll er in den Himmel gefahren sein. Hatte er also vielleicht ein Raumschiff? War Jesus ein Alien? Diese quatschige Frage stellt Perel. Und es ist klar, warum. Die Frage trägt einfach.
„My eyes fixated on the sky/ Dreaming …” So beginnt dieses Album, das zweite der in New York lebenden und im Erzgebirge aufgewachsenen Annegret Fiedler, die sich Perel nennt. Es ist eine Pop-Frage, und in dem Zusammenhang darf Jesus Was An Alien auch keine Frage mehr sein. Das Titelstück säuselt Wölkchen-Electro. Perel spricht über jene Human-Voice-Synthesizer, die Monty Python im Film Das Leben des Brian in der Geburtsszene des Brian ertönen lassen, und redet sich gemeinsam mit der Montréalerin Marie Davidson in einen stellaren Flow, der in Davidsons sich im Französischen praktischerweise reimenden Frage gipfelt: „Jesus, Jesus/ D’où viens-tu?”
Weitere Titel lassen sich zum Jesus-Komplex zusammenklecksen, „Religion”, „Kill The System” und „Matrix”. Im Piano-House-Stück „Religion“ gehen Claps und trockene, leicht angerauhte Bass-Linien Hand in Hand, und Perel stellt sich dazu in deutscher Sprache die Frage zwischen Realität und Traum, und die messianische Ikonografie des Wachowski-Films ist sofort da.
Sie findet eine Spiegelung in „Real”, das die gleiche Frage stellt zu einer wegbeamenden Synthie-Electro-Fuge mit enormem Sog. „Kill The System” hingegen stellt die patriarchale Frage, die unter einer Überschrift wie „Jesus Was An Alien” besonders vertrackt ist. Denn der, der für Gläubige nicht von dieser Welt gewesen ist, gerierte sich liebenswürdig und imperialismuskritisch in einer patriarchalen Welt unter römischer Dominanz, nur um in den folgenden Jahrhunderten eine ultrapatriarchale Ultramacht zu hinterlassen. Es ist einer der musikalisch besonders aufregenden Tracks dieser Sammlung: „Im Zentrum der Macht/ Erklingt ein Lied”, und es ist eben ihr Lied, und es inszeniert einen anschwellenden Aufruhr, um sich in einer Acid-Abfahrt zu ergehen, die bei allem Zorn ihre Leichtigkeit mit sich trägt und ihren fluffigen Groove.
So trägt der Albumtitel zu dieser Inszenierung bei: Das Spektakuläre an Perels kosmischer Diskothek ist der Alltag. Denn beschreibt Fiedler nicht, vielmehr öffnet sie einen Alltagsraum mit diesen Liedern, der Brötchenholen mit der Gottesfrage eins setzt (Achtung Metapher, sie singt nicht wirklich über Brötchen). Was der Tag so mit sich bringt. Und die Ikonografie: Als Himmelskönigin, als Mondsichelmadonna kennen wir Maria, und nun haben wir die Ausserirdischenmutter. Perel, auf dem Album-Cover madonnenhaft in Szene gesetzt mit raumfahrthelmartigem Heiligenschein und Jesus-Gruß, säugt ein Alien-Baby, wie es in der Techno-Welt um das Jahr 1990 oft und gerne dargestellt wurde. Sie ist vom Geist geküsst, vielleicht ist es sogar ein heiliger. Christoph Braun

Caterina Barbieri — Spirit Exit (Light-Years)
Es gibt wahrscheinlich wenige Künstler:innen, die innerhalb kurzer Zeit einen derart markanten Signature-Sound für sich entwickelt haben wie Caterina Barbieri. Die überbordenden Kompositionen der Modularsynth-Virtuosin aus Mailand stehen so sehr für sich, dass man ihnen eigentlich ein eigenes Genre widmen müsste, verarbeiten sie doch Einflüsse von Synthpionieren wie Schulze und Jarre auf eine ihr eigene, polyphone und zugleich minimalistische Weise und kombinieren sie mit großem Drama, einer kleinen Brise Ben Frost’scher Atonalität und dem verträumten Nachhall einer euphorisierten Ravenacht. Die ineinander verhakten Melodien der Wahlberlinerin bestimmen auch hier wieder die Szenerie, mäandern umeinander und konvergieren an den ein oder anderen Stellen zu einem großen Thema, nur um dann wieder in vielschichtigen Layern auseinanderzudriften.
Das Album wurde komplett im zweimonatigen Mailänder Lockdown produziert und ist auch das erste auf ihrem eigenen Label Light-Years. Mit „Terminal Clock” enthält es den ersten Sampling-basierten Track von Barbieri, der als einziger des Albums mit subtiler Rhythmik am Dancefloor schnuppert, ohne sich direkt drauf zu wagen. Spirit Exit klingt so retrofuturistisch wie zeitgemäß und steckt noch mehr als Barbieris Vorgänger voller epischer Minidramen, die wie „At Your Gamut” oder „Broken Melody” in einem Track oft so viel Dramatik wie sonst ganze Alben transportieren. Barbieri scheint hier nicht nur posthumanistische Philosophie von Rosi Braidotti und Poesie von Emily Dickinson aufzunehmen, sondern passt auch hervorragend als Soundtrack zu den visionär dystopischen Romanen von Emily St. John Mandel, die mich gerade genauso faszinieren wie Barbieris Musik. Stefan Dietze

Das Ende der Liebe – Schne*e (Anunaki Tabla)
Eine Band, deren Name die Siebziger- mit den Achtzigerjahren verschränkt, verortet in Köln und Berlin: Gäbe es einen Aggregatzustand, der die Disposition von Das Ende der Liebe angemessen beschriebe, wäre es wohl das Dazwischensein. Auch wenn das Quartett mit den acht Tracks seines zweiten Albums ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten zwischen Dark Ambient, Elektroakustik, „Alien-Jazz” – so die Definition des eigenen Labels Anunaki Tabla – und Industrial auslotet, bleibt der Einfluss von Can auf „Schne*e” im Ganzen doch unüberhörbar. Und ein Titel wie der des 13-minütigen Openers „Swansygamelan” ist natürlich gleichzeitig Programm. Auch Bands wie Throbbing Gristle oder Psychic TV scheinen Spuren im Soundverständnis von Das Ende der Liebe hinterlassen zu haben.
Allerdings handhaben Laurenz Gemmer (CP70), Kenn Hartwig (Bass), Thomas Sauerborn (Drums) und Andreas Völk (Voice/Effects) ihre Reflexionen und Meditationen über solcherart Referenzen in Echtzeit: Sowohl Improvisation als auch hypnotische Repetition gehören zu den Schlüsselfaktoren ihrer Musik. Dass man sich auf Aphex Twin, Maurice Ravel und Brad Mehldau gleichzeitig einigen kann, passt perfekt ins Bild. Mit Ingo Krauss haben Das Ende der Liebe erstmals einen externen Producer hinzugezogen, der in seinem Candy Bomber Studio in Berlin-Tempelhof bereits Kunden wie Caspar Brötzmann, Automat, Nick Cave, Moritz von Oswald oder die Einstürzenden Neubauten betreut und aufgenommen hat.
Die Spielzeit der aus den Sessions herausdestillierten Tracks variiert zwischen dreieinhalb und gut 17 Minuten (das epische, dreiteilige „Beweise”, gleichzeitig auch der am meisten in Richtung elektronische Tanzmusik ausgreifende Track), die Hallräume sind dunkel und von ungewisser Tiefe, die Atmosphäre ist vorwiegend zumindest angespannt, aufgeladen, lauernd und lastend, verdichtet und dräuend, wo nicht schon offen toxisch und bedrohlich. All das jedoch mit gewissermaßen minimalistischem Gestus präsentiert: reduziert, repetitiv, teilweise, vor allem die Stimmen, auch wie körperlos. Spannungsgeladener Soundtrack für Dystopien aller Art. Harry Schmidt

Emeka Ogboh – 6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE (Danfotronics)
Den Rhythmus im Geschnatter finden, Melodie im Hupen von Bussen hören, Verkehrsrauschen wie Synth-Pads behandeln – einen Ort in acht Tracks komprimieren. Emeka Ogbohs aktuelles Album porträtiert den Busbahnhof Ojuelegba in Nigerias größter Stadt, Lagos, klanglich.
Während sein vorheriges Album Beyond The Yellow Haze, das im letzten Jahr noch über Ostgut Ton veröffentlicht wurde, sich mit Geräuschen aus ganz Lagos beschäftigte, zoomt sein neuestes Werk von der Makro- auf die Mikroebene und steckt die Nadel genau auf 6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE – die Koordinaten besagten Busbahnhofs.
Mit künstlerischer Virtuosität formt und transkribiert Ogboh Field Recordings und Interviews aus verschiedenen Stellen in und um den Busbahnhof zu einer Art auditiver Topografie. Beim Hören entsteht ein Bild des Ortes im Kopf: Welche Menschen dort umherschwirren und welche Geschwindigkeit dort herrscht. Es ist so, als wäre man mit Ogboh dort und würde sich dem Trubel hingeben. Das Album, das über Ogbohs neu gegründetes Label Danfotronics erscheint, wird zu einer Aufzeichnung von Ogbohs Suche nach Struktur und Rhythmus in der anarchischen, großstädtischen Hektik.
6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE fügt sich geschmeidig in Ogbohs Gesamtwerk ein. Seine Arbeiten sprechen die Sinne an und befassen sich oft mit öffentlichen Räumen. In einer Installation im Gropius Bau in Berlin in diesem Jahr rekreierte der Wahlberliner das Erlebnis eines typischen Marktplatzes in nigerianischen Dörfern. Für die documenta 14 konzipierte Ogboh 2017 ein Bier, das Gemeinschaft über geteilte Erinnerungen an Geschmack symbolisieren soll. Es sind meist bestimmte Orte, die über Sinneserfahrungen greifbar gemacht werden. Private, öffentliche, kollektive Erinnerungen und Historien werden dabei in Klang oder Geschmack überführt oder kodiert. Seinem aktuellen Album ist zudem eine Karte beigefügt, auf der die genauen Aufnahmeorte mit Tracktiteln vermerkt sind.
Der Busbahnhof Ojuelegba ist der ehemalige Standort eines heiligen Schreins für Eshu, den Gott der Yoruba für Tanz und Verwirrung. An einer großen Kreuzung gelegen, ist die Haltestelle Dreh- und Angelpunkt des Geschehens in der Nachbarschaft. Mit diesem Ort als Ausgangspunkt interviewte Ogbohs verschiedene Fahrer der typisch gelben Danfo-Busse, wodurch eine verbale Abbildung der Nachbarschaft anhand mündlicher Beschreibung der Busrouten, von Essen, spiritueller Geographie, Geschichte und Prostitution entstand. Gesprochen wird in Nigerian Pidgin, einer dort dominanten Kreolsprache, die auf Tracks wie „Verbal Drift” mit seinen in mehreren Loops übereinandergelegten Interviewpassagen besonders zur Geltung kommt.
An anderer Stelle, auf „Oju 2.0”, fügt Ogboh dem ständigen Lärm des Busbahnhofs ein dezentes Knistern und Ploppen hinzu, das die Allgegenwärtigkeit und Fülle des Klangs unterstreicht. Aus dem Gemenge aus Unterhaltungen, Hupen, dem Aufheulen von Motoren und Durchsagen entsteht eine Art immersiver Ambient urbaner Klänge. Während meist der Dunst des Lärms im Vordergrund steht und die beigefügten Elemente – langsam scheppernde Drums und entzerrte Synths – das Geschehen akzentuieren anstatt überschatten, kann man aus „No Counterfeit” die Techno-Anleihen heraushören, und „We Dia Hia” winkt Dub zu.
Ogbohs Ansatz für sein aktuelles Album ist ein durchaus explorativer. Mit einer Begierde, die Wirklichkeit des Ortes zu fassen, ist eine Aufzeichnung der sozialen, kulturellen, historischen und geografischen Aspekte des Busbahnhofs Ojuelegba entstanden. 6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE ist eine auditive Topografie des Ortes, die dessen Subjekte, Objekte, Geschichte und Sprache umfasst – ein erlebbares Klangartefakt, das in persönlicher Erfahrung Ogbohs und objektiver Zugänglichkeit durch Klang aufgeht. Louisa Neitz
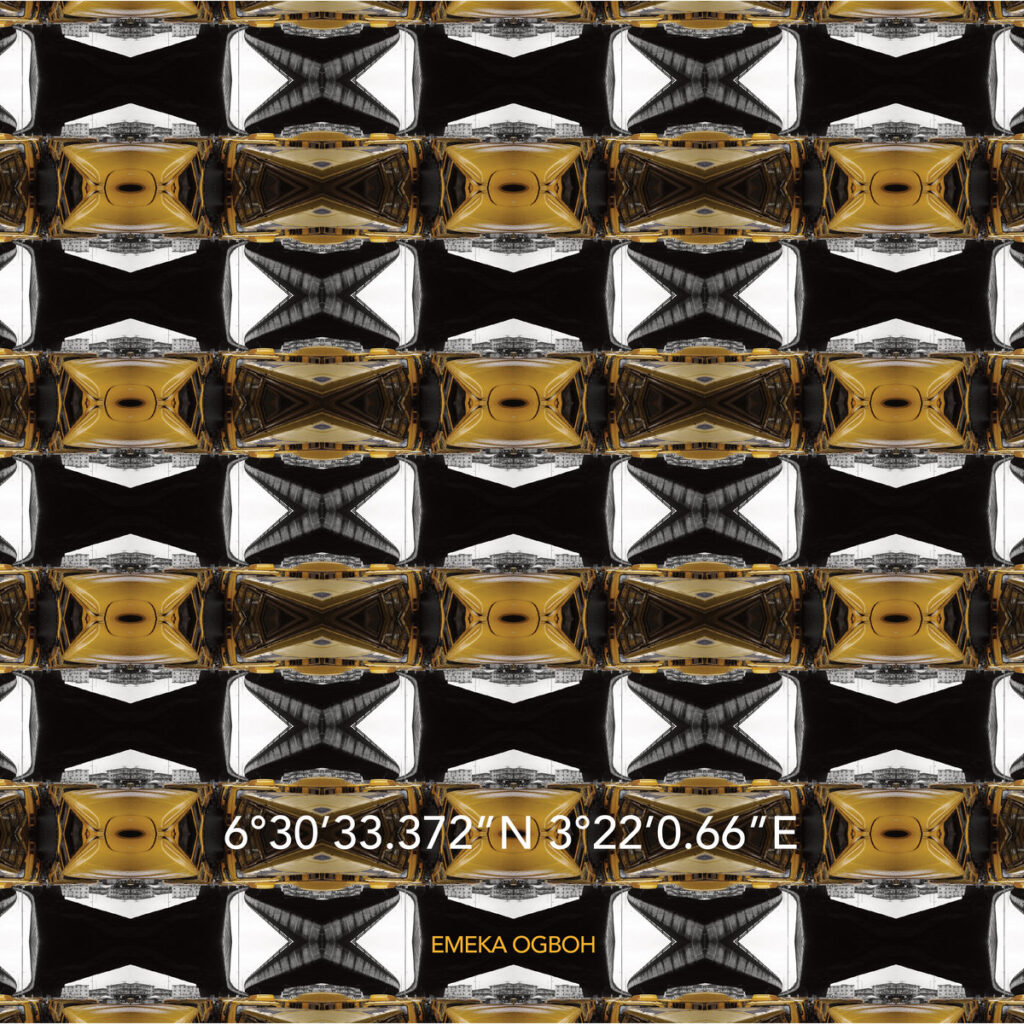
Philipp Priebe – Apparent Calm Palms (Feuilleton)
Der aus Berlin agierende Philipp Priebe hat sich in den letzten Jahren mit seinem Label Stólar einen kleinen Namen in der kontemporären Deep-House-Szene erarbeitet. Er arbeitet sauber, aber nicht so geleckt und seelenlos, wie man es manchmal am polierten Ende des Spektrums findet. Gleichzeitig gibt Priebe sich nicht dem Lo-Fi-Haze hin, sondern verleiht seinen Tracks mit gezieltem Einsatz von Effekten und Samples die nötige Tiefe.
Auf seiner zweiten LP geht es nach eigener Aussage um die Orte und Gefühle, die mit dem Partymachen verbunden sind, wenn man nicht gerade selbst in der großen Stadt und Ausgehmetropole haust; also das Vorglühen, die Hin- und Rückfahrt und so weiter. Tatsächlich hört sich Apparent Calm Palms vorzüglich auf einer urbanen Transitstrecke, sei es in der Metro oder im Flughafenterminal. Die zehn Tracks tragen sich von der ruhigen Anfangsstimmung langsam aber sicher in den Club und wieder zurück.
Stilistische Ähnlichkeiten sind etwa zu den frühen Recondite-Veröffentlichungen zu ziehen, wenn diese mystische Dörflichkeit von Nebelschwaden über dem Waldstück mit in der 303 hängt. Oder aber auch die schweren, üppig geschwungenen Drums, die an René Pawlowitz unter einem seiner vielen Aliasse erinnern. Dazwischen findet sich eine ganze Menge Groove, geschult an Deep-House-Vorbildern aus Chicago und Detroit. Das ein oder andere ambiente Interlude darf auf so einer LP natürlich auch nicht fehlen.
Was jetzt viele Referenzen aufgerufen hat, klingt aber keinesfalls nach einem Zusammenbau von Versatzstücken der Deep-House-Geschichte. Priebe hat unmissverständlich seine eigene, zwischen Melodik, Groove und Deepness ausgewogene Handschrift gefunden und diese auf dem LP-Format formvollendet zum Ausdruck gebracht. Leopold Hutter
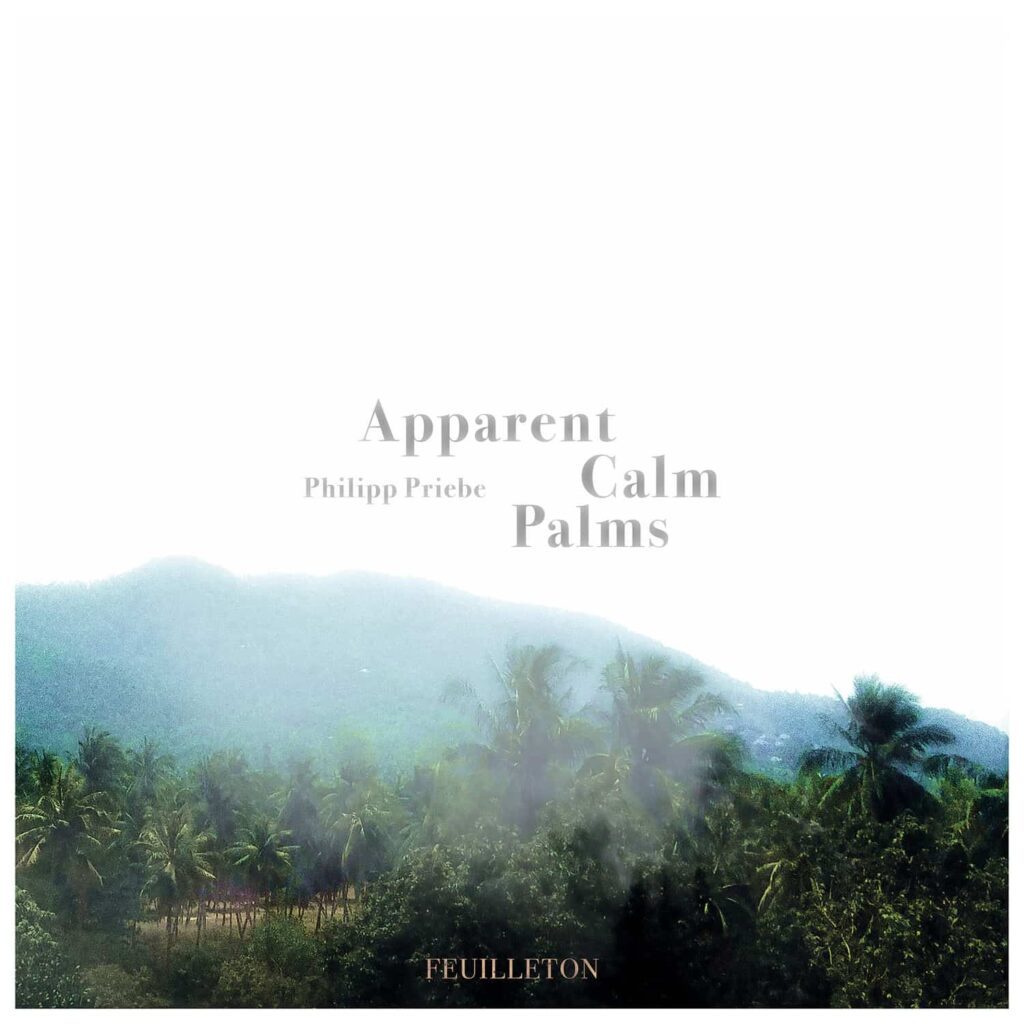
Sam Prekop and John McEntire – Sons Of (Thrill Jockey)
Hier empfehlen sich zwei Veteranen der Chicagoer Musik, die einst unter dem Namen Post-Rock antrat, den Klang der Neunziger umzukrempeln. Alte Bekannte, die eigentlich seit einer Ewigkeit als Bandkollegen zusammen spielen. Trotzdem gibt es sie jetzt zum ersten Mal als Duo. Sam Prekop, Sänger und Gitarrist von The Sea and Cake, begann später solo mit Modularsynthesizern zu arbeiten, John McEntire trommelt mit ihm seither in dessen Band neben seiner Tätigkeit als Schlagzeuger bei den Post-Rock-Pionieren Tortoise.
Auf Sons Of gibt es weit und breit nur elektronische Apparate zu hören, modulare analoge, außerdem digitale wie Sampler. Als patternbasierte Grooves mit unterschiedlich starkem Drumcomputereinsatz lässt sich die verbindende Herangehensweise für ihre vier Stücke beschreiben. Ein bisschen mag da ein Gruß in Richtung kosmische Musik entboten werden, doch kann man sie nicht darauf reduzieren.
Selbst wenn auf den ersten Blick alles gleichförmig und freundlich-ausgeglichen zugeht, bekommt man die Geschichte so nicht auf eine Formel. Zu viele kleine Details haben die beiden in ihre zwischen acht und 24 Minuten langen Instrumentalnummern eingearbeitet, zu viele Spielereien am Rand, ohne dass sie große Aufmerksamkeit einfordern würden. Zu diesem unaufdringlich begeisternden Einstand der alten Freunde passt das sehr liebevolle Cover, das eines der schönsten Katzenmotive des Jahres bereithält. Da bleiben keine Wünsche offen. Tim Caspar Boehme

Sarah Davachi – Two Sisters (Late Music)
Mit ihrem neuen Album bewegt sich die nordamerikanische Komponistin Sarah Davachi in der Alten Musik, der Minimal Music der 1960er sowie im gegenwärtigen Klang-Prozessieren. Baff machende Reibung entsteht.
Mittendrin, etwa in „Icon Studies I”, stellt sich das Begreifen ein: hier entsteht Musik von neuer Schönheit, einer Schönheit, die sich aus einem zerstückelten Begriff von Zeit speist. In diesem kurzweiligen Zwölf-Minuten-Stück vergeht jene Zeit sehr, sehr langsam, das Hören benötigt diese Dauer und vermag zu entziffern, ähnlich wie der Sehsinn ein Bild entziffern kann. Das Hören kann den Harmonien folgen und ihrem langsamen Vergehen, ebenso den vertikalen Bewegungen, Tonhöhe rauf, Tonhöhe runter, wie es eben möglich ist beim Betrachten etwa einer orthodoxen Ikonografie.
Diese Flexibilität in der Komposition, dieses Springen zwischen Hier und Dort, zwischen Gegenwart und Vergangenheit zeigt sich bereits in der Eröffnung. Die in Kanada aufgewachsene und derzeit in Kalifornien lebende Komponistin benennt mit „Hall Of Mirrors” das Eröffnungsstück quasi nach ihrer Arbeitsweise, mit allen Spiegelungen in die Unendlichkeit und Abbildungsverformungen, die solch einen Spiegelsaal charakterisieren. Im Folgestück „Alas, Departing” bearbeitet sie das Lied „Alas, Departynge is Ground of Woo” aus dem 15. Jahrhundert des europäischen Mittelalters, indem sie Stimmgruppen aufteilt, vereinzelt, hintereinanderschiebt, jedoch immer mit einer Rekonstruktion der Dekonstruktion im Auge behält: die bereits eingangs beschriebene, zeitgemäße Schönheit mitsamt eines molekularen Zeitbegriffs.
Die Reife der beiden ersten Arbeiten durchzieht das komplette Album, das so zu einer meisterlichen Arbeit der elektronischen Musik des Hörens heranreift: ein vielstimmiges und dennoch homogenes Klangwerk aus elektrischer Orgel, Viola, Cello und Singstimmen; eine hochkonzentrierte Bewegung weg von den ach so einstudierten Alltagshandlungen und ihren Verständnissen von Zeit und Aktion. Christoph Braun

Tomu DJ – Half Moon Bay (Franchise)
Kein leichtes Unterfangen muss es sein, tiefgehende Emotionalität fast durchgehend ohne Lyrics in elektronische Gewänder zu kleiden – nur anhand von Melodie und Instrumentation. Tomu DJ gelingt dieser Kniff mit vielen Lagen hauchdünner Klangelemente, die sie mit zärtlicher Gelassenheit zusammenwebt. Der Musikerin aus Kalifornien transportiert auf ihrem zweiten Album Half Moon Bay eine Gemengelage an Gefühlen und Eindrücken mit ambientgetränktem Footwork.
Flächige Pads und melancholische Synthmelodien kontrastieren oftmals klare Drums, die Dub-Rhythmen oder Breakbeats anschlagen und der sonstigen Tragik der Tracks einen dynamischen Schubs Richtung Erleichterung geben. Alle der sieben Titel haben etwas Meditatives und Delikates, klingen in sich gekehrt, so als würde Tomu DJ mit äußerster Sorgfalt die einzelnen Klänge aneinander fädeln.
„Spring of Life” beispielsweise scheint wie vor Leben zu summen, zirpen und schnurzen zu einer ausgedehnten Melodie und entzerrtem Rhythmus, bis der Track zu einem sanft blubbernden und glucksenden House-Klang umschwingt. Dem Song entgleiten dabei Gefühle der Leichtigkeit und des Loslassens. An anderer Stelle dringen mit „Half Moon” dunklere, eher trostlose, aber sehr berührende Impressionen ein. Mit einer Klangfarbe, die an subtilere Radiohead-Songs erinnert, taumelt die Synth-Melodie etwas ziellos durch den Track zu künstlich summenden Pads und simpel trottendem Beat. Während die ersten beiden Titel auf Half Moon Bay noch ein wenig wie Aufwärmer wirken, entfaltet sich das Zusammenspiel zwischen melancholischen Synths und offensiveren Drums im Laufe des Albums und transportiert umso mehr Emotionalität. Louisa Neitz
