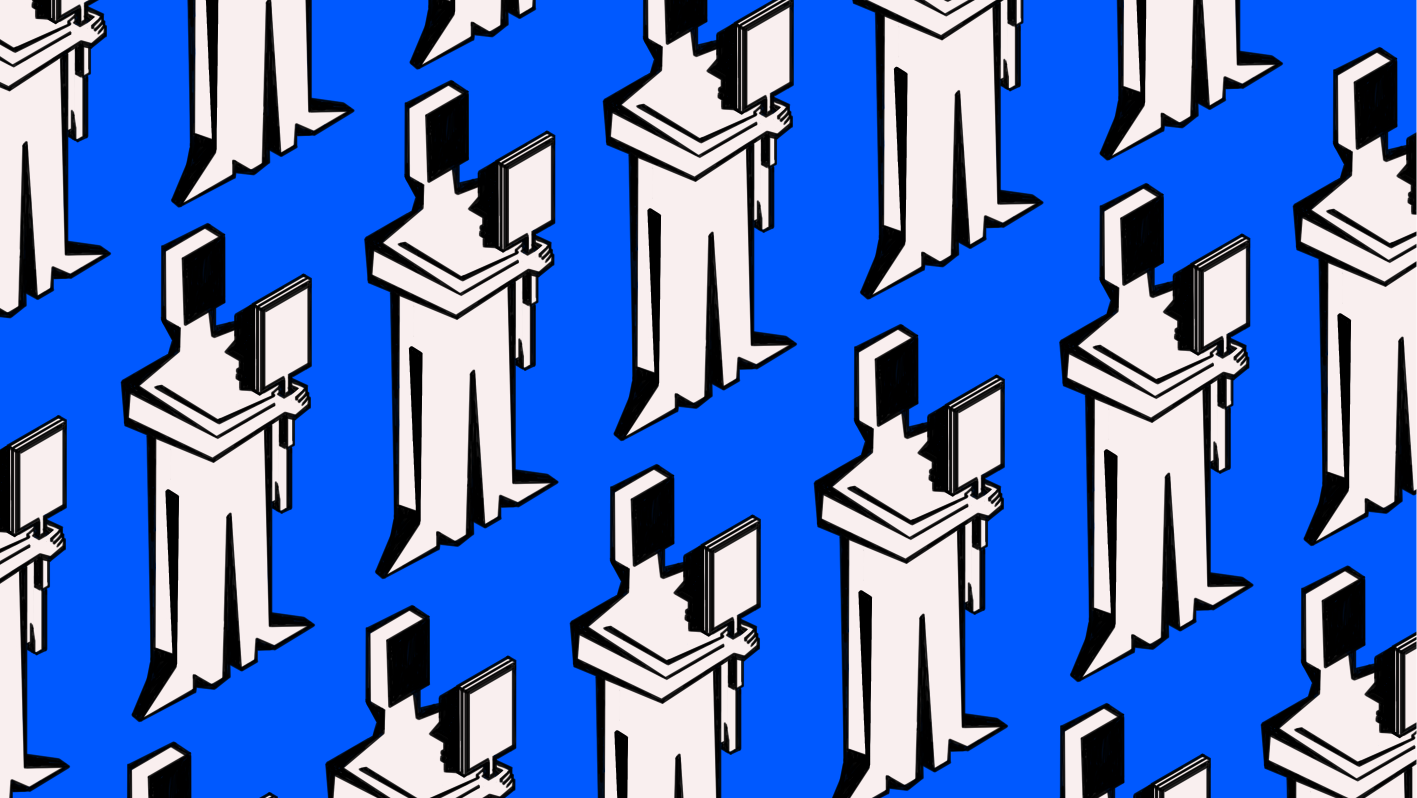Das grundlegende Versprechen der Dance Music war immer ebenso banal wie wunderschön. (Illustration: Dominika Huber)
Die Pandemie ist gleichermaßen das Produkt seit langem schwelender Übel im internationalen System wie auch deren Brandbeschleuniger. Das gilt auch für die globale Szene der elektronischen Musik, in der sich die Fronten über die vergangenen zwei Jahre und insbesondere während der letzten zwölf Monate sukzessive verhärteten. Auch dabei handelt es sich nicht etwa um ein neues Phänomen, wie Kristoffer Cornils in der REWIND2021-Ausgabe seiner Kolumne konkrit argumentiert, sondern vielmehr um die letzte Konsequenz einer von immanenten Widersprüchen geprägten Ideologie, auf die sich die Community bedenkenlos beruft und die im Jahr 2021 mehr denn je auf den Prüfstand gestellt werden sollte.
Irgendwann im Sommer dieses Jahres postete ein Produzent und DJ über seinen privaten Social-Media-Account ein mittlerweile gelöschtes Sharepic mit folgender Aufschrift: „Imagine if there were 99.7% chance you would NOT shit your pants, but you’re FORCED to wear diapers just in case.“ So krumm die Analogie auch sein mag, so schnell wurde ihr Inhalt schon beim ersten Lesen deutlich: Es sterben doch so wenige Menschen an COVID-19, die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei bist, ist gering – warum also solltest du dann eine Maske tragen?
Das eigentlich Interessante an dieser holprigen Rhetorik ist, dass sie sich vollständig an ein Individuum richtet und die Gesellschaft um dieses herum ignoriert. Denn nicht nur ließe sich einwenden, dass selbst hinter jeder noch so kleinen Nachkommastelle menschliche Schicksale stecken, sondern genauso, dass in einer Pandemie die bloße Anzahl verstorbener Menschen niemals die ganze Geschichte erzählt.
Denn was ist mit all jenen, die am sogenannten Long-COVID erkrankt sind? Diejenigen, die Wochen, wenn nicht gar Monate auf der Intensivstation um ihr Leben gekämpft haben? Diejenigen, die auf den Intensivstationen für ungerechte Löhne und unter erschwerten Arbeitsbedingungen täglich um Leben kämpfen? Was ist mit den gesundheitlichen, psychologischen, sozialen, kulturellen, politischen oder ökonomischen Konsequenzen dieser Pandemie? Tatsächlich ist eine allgemeine Maskenpflicht doch keine individuelle Gängelei, sondern eine strukturelle Maßnahme, um weitreichenden Schäden vorzubeugen.
People Looking to Themselves
Diese Dimensionen indes werden von dieser kruden Analogie nivelliert. Sie erinnert deswegen an einen berühmten Ausspruch der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher: „[…] who is society? There is no such thing! There are individual men and women and there are families and no government can do anything except through people and people look to themselves first.” Die Quintessenz: Der Staat soll weder durch Hilfeleistungen noch durch Regularien eine Gesellschaft unterstützen, die es ja doch sowieso nicht gäbe. Vielmehr sollten alle zuerst an sich selbst denken. Dann, so ließe sich der Gedanke mit einem deutschen Sprichwort weiterführen, sei schließlich schon an alle gedacht.
Thatcher formulierte mit dieser berühmt gewordenen Interview-Antwort einen der sozialen Grundsätze der wirtschaftlichen Theorie des Neoliberalismus, an deren praktischer politischer Umsetzung sie federführend beteiligt war. Verkürzt gesagt setzt die im 20. Jahrhundert maßgeblich vom Ökonom Friedrich August von Hayek geprägte Idee des Neoliberalismus auf die völlige Freiheit des Marktes, weil sie auf der unerschütterlichen Annahme basiert, dass der Kapitalismus aus sich selbst heraus Gerechtigkeit zwischen den Menschen schafft. Vulgo: „der Markt regelt”, und zwar immer zum Besseren hin. Ein Staat sollte sich laut dieser Idee, anders noch als in der klassischen von Adam Smith abgeleiteten Theorie des Liberalismus, nicht in die Dynamiken des Marktes einmischen – zumindest nicht in Form von Regeln oder gar Verboten.
Das alles verleiht dem Neoliberalismus eine ideologische Note, die seit Beginn seines Siegeszugs ab den frühen siebziger Jahren gleichsam das soziale Leben wie das individuelle Denken geprägt hat. Regeln und Verbote (Maske tragen!) werden mit Verweis auf individuelle Freiheiten abgelehnt (ich entscheide selbst, ob ich mich in Gefahr begebe) und die Gesellschaft beziehungsweise gesellschaftliche Auswirkungen eines solchen Individualismus auf die längere Bank gestellt (die Leerstelle in der Analogie: Ob mein Maskentragen andere schützt oder nicht, ist nicht einmal eine Erwähnung wert). Kurzum: Wenn der Markt alles regelt, braucht sich niemand mehr verantwortlich zu fühlen. Warum Windeln tragen, wenn es sich stattdessen auf die anderen scheißen lässt?
Rave wurde zum Massenphänomen und DJs letztlich doch zu den Stars, zu denen sie laut technomilitanten Formationen wie Underground Resistance niemals hätten werden dürfen.
Die Kehrseite des Ganzen besteht allerdings darin, dass der neoliberale Staat den Menschen im selben Zug umso mehr Verantwortlichkeit aufdrückt, indem er sie von sich abwälzt – vor allem in ökonomischer Hinsicht. Denn wenn der Markt schon alles regelt, braucht der Staat ihnen nicht mehr zu helfen und kann mehr noch implizit verlangen, dass sie sich selbst einbringen. Statt den systemischen Ursachen des Klimawandels politisch zu begegnen, müssen dieser Logik zufolge diese oder jene Steuern erhoben werden, die natürlich von den Endverbraucher*innen getragen werden. Derweil, versteht sich, multinational agierende Konzerne weiterhin fröhlich CO2 in die Luft pumpen dürfen.
Wenn neoliberale Politik schon im nachhaltigen Krisenmanagement sinnlos und ineffektiv wirkt, dann umso mehr in akuten Katastrophenfällen. Von „Eigenverantwortung” war während der zurückliegenden 20 Monate und insbesondere in Zeiten der dritten und vierten Welle immer wieder die Rede; es handelt sich um einen der zentralen Begriffe neoliberalen Vokabulars. Er besagt nicht weniger, als dass statt der Schließung von Fabriken, Großraumbüros oder Schulen – den Stätten, die Produktion und Reproduktion des Kapitals ermöglichen und also den heiligen Markt auf ihren Schultern tragen – entweder die Verantwortlichkeit auf Einzelpersonen geschoben wurde (freiwillige Selbstisolation und -testung nach Abschaffung des kostenlosen Angebots) oder aber repressiv in ihr Privatleben eingegriffen wurde (auf dem Arbeitsplatz über Stunden hinweg mit einer Vielzahl im Raum befindlicher Menschen zu schuften ist in Ordnung, ein Feierabendbier unter vier Augen aber nicht).
So also existiert die vermeintliche Freiheit im neoliberalen System nur, solange der Markt davon nicht betroffen ist. Das eben führt auch zum ewigen Hin und Her zwischen vermeintlicher individueller Freiheit und den Beschränkungen des Privatlebens im Lockdown-Hopping. Hätten sich die Regierungen dieser Welt Anfang 2020 geschlossen darauf verständigt, der Bevölkerung zwei Monate bezahlten Urlaub zu gewähren und die Sache geduldig auszusitzen, wäre COVID-19 heute eventuell kaum mehr eine Fußnote der epidemiologischen Geschichtsschreibung. Aber das Kapital musste weiterzirkulieren, und das Virus tat es ihm gleich.
Vor diesem Hintergrund scheint es theoretisch gesprochen nachvollziehbar, wenn einzelne Personen die Einschnitte in ihre persönlichen Freiheiten nicht mehr hinnehmen wollen. Allerdings nur auf sie zu pochen, die dahinterliegenden systemischen Übel nicht zu benennen (oder schlimmer noch: zu erkennen) und vor allem die Gesellschaft darum herum dabei außer Acht zu lassen, ist eben wieder nur der neoliberalen Logik zuträglich. Beides basiert auf und untermauert die Direktive der Eigenverantwortung, das heißt in Thatchers Worten dem Gedanken, dass Individuen zuerst auf sich selbst schauen sollten. Eine Gesellschaft wird so zugleich von oben wie von unten negiert.
Womit wir dann auch, pardon, endlich beim Thema angekommen wären: Was das Ganze mit Techno zu tun hat. Denn vielleicht ist es eben kein Zufall, dass ausgerechnet ein Mitglied dieser Szene auf den Gedanken kommt, so ein Sharepic in die Welt zu tragen.
Der Traum der ravenden Gesellschaft: ein immanenter Widerspruch
Das grundlegende Versprechen der Dance Music, von Disco über House bis hin zu Techno und allen neueren Spielarten elektronischer Tanzmusik sowie den dazugehörigen Subkulturen, war immer ebenso banal wie wunderschön: Es lässt sich dazu alleine und doch mit anderen zusammen tanzen, individuelle Freiheit im Kollektiv erfahren. Revolutionär war das zu Zeiten der ursprünglichen Disco-Bewegung deswegen, weil diese Form von Tanz mit den repressiven Werten und Gesetzen der Zeit – wir erinnern uns: Stonewall wurde unter dem Vorwand gestürmt, das Tanzen von gleichgeschlechtlichen Partner*innen zu unterbinden – konsequent brach. Nach dem homophob und sexistisch motivierten Backlash durch die Disco-Sucks-Bewegung übernahm House diese Fackel, und als schließlich Acid in Großbritannien aufschlug, zeigte sich ausgerechnet eine Margaret Thatcher besorgt über die spontaneistische und kollektivistische Massenbewegung.
Doch wissen wir alle, wie die Geschichte letztlich ausging: Rave wurde zum Massenphänomen und DJs letztlich doch zu den Stars, zu denen sie laut technomilitanten Formationen wie Underground Resistance niemals hätten werden dürfen. Und von da an wurde es nur noch schlimmer. Selbst die Super-DJs, wie sie Ende der neunziger Jahre aus einer chaotischen Gemengelage aufstiegen, nehmen sich gegenüber ihren heutigen Pendants tatsächlich sogar eindimensional aus. Wer heutzutage zu den Ein-Prozent-DJs dieser Welt gehört, betreibt nicht nur ein Label und eine internationale Event-Serie, sondern leiht das eigene Gesicht auch für Alkohol- und Auto-Brands aus, macht in Mode und nebenbei noch in Immobilien, Aktien oder sogar Krypto. Allein in die vielbeschworene Community fließt davon herzlich wenig zurück. Zwar wird weiterhin im Kollektiv gefeiert, aber doch sukzessive individuell abkassiert – und dabei auf die anderen geschissen.
Wie genau sorgt ein vollgepisster Berliner Tiergarten nun dafür, dass der Frieden in der Welt seinen Einzug hält?
Es fällt leicht, das als großen Ausverkauf immer noch gültiger Werte zu deuten und die Schuld auf vermeintlich Außenstehende zu schieben, die die Szene assimiliert und gründlich durchgentrifiziert haben. Die Wahrheit mag aber vielleicht schmerzhafter sein: Rave-Kultur bot schon immer den idealen Nährboden für neoliberale Ideologie, eben weil sie den eigentlichen Widerspruch zwischen Individualismus und Kollektivität in ihrem Kern nie aufzulösen vermochte, ja, dem Individuum immer schon den Vorrang einräumte.
Denn war nicht schon der Traum einer ravenden Gesellschaft, wie sie sich die Szene noch in den neunziger Jahren herbeifabulierte, diese „allergeilste Form von Demokratie”, mehr Tummelplatz für Partikularinteressen als eine wirkliche Gemeinschaft? Anders formuliert: Rekrutiert sich nicht die gesamte Riege der Super-DJs von damals und den Ein-Prozent-DJs von heute aus dem Underground, dessen vermeintliche Grundfesten sie noch bis heute, egal ob in Interviews für Szenezeitschriften oder in Werbefilmchen für Großkonzerne, predigen? Haben sie nicht auch in den „richtigen” Clubs angefangen, auf den „richtigen” Labels veröffentlicht und waren somit Teil des „echten Undergrounds” – der ravenden Gesellschaft?
Die Rave-O-Lution und das Ende der Geschichte
Hatten Disco und House noch auf das bedingungslose Miteinander gesetzt und die frühen Techno-Artists sich utopistischen Ideen verschrieben, fand schnell das Kapital seinen Eingang in die Szene. Es traf jedoch nicht etwa auf Widerstand, sondern auf offene Arme. Die Schneller-Härter-Weiter-Mentalität der Rave-O-Lution entsprach dann doch zu sehr der Schneller-Härter-Weiter-Mentalität des neoliberalen Kapitalismus. Insbesondere die Übersetzung von Rave-Kultur auf den Boden der wiedervereinten Bundesrepublik wurde zwar als positives soziokulturelles Zeichen gewertet, wird rückblickend gar verklärt und zu einer Graswurzelbewegung hochgejazzt, die angeblich ein neues Zeitalter anbrechen ließ.
Nur wie genau dieses Zeitalter auszusehen hätte, welche gesellschaftlichen und politischen Wünsche in dem riesigen Exzess angeblich ihren Ausdruck fanden, das wurde nie wirklich ausgesprochen oder zumindest nicht hinterfragt. Mit verheerenden Folgen. Am Beispiel Berlins zeigt sich am deutlichsten, dass auch diese Revolution ihre Kinder gefressen hat.
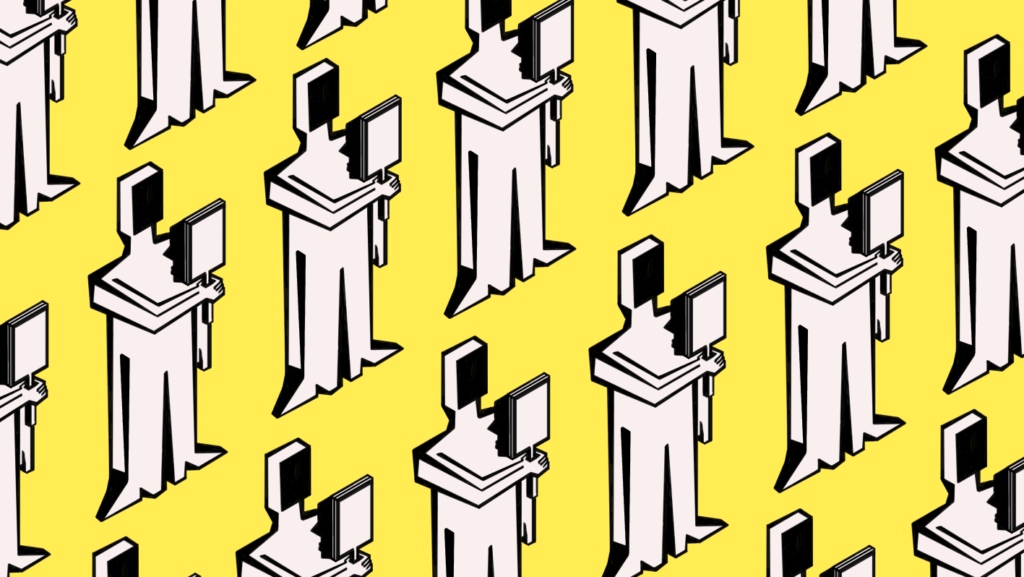
Überhaupt: Rave-O-Lution, das riecht nach Politik. Nur was für eine? Dass der Traum einer ravenden Gesellschaft mithilfe der Gelder von Alkohol- und Tabakkonzernen in die Realität umgesetzt werden sollte, wurde zwar in den neunziger Jahren allenthalben kritisiert, weitreichende Gegenbewegungen jedoch wurden nicht auf die Beine gestellt. Parallel dazu wurde eine Straßenparade als politische Veranstaltung angemeldet, deren Slogan „Friede, Freude, Eierkuchen” lautete – was bitte sollte daran ein Politikum darstellen? Wie genau sorgt ein vollgepisster Tiergarten nun dafür, dass der Frieden in der Welt seinen Einzug hält? Überhaupt: Frieden, was soll das heißen? Freude? Welche, bitte? Konkret lässt sich allerhöchstens sagen, was genau nun Eierkuchen sein sollen. Nur nicht, wie sie eine bessere Welt ermöglichen könnten.
Statt wirklich konkrete Utopien zu entwerfen, kam die Rave-O-Lution einer Siegesfeier für das „Ende der Geschichte” gleich, wie es der konservative Theoretiker Francis Fukuyama nach dem Niedergang des real existierenden Sozialismus deklarierte: Der Kapitalismus – Fukuyama nennt es „liberale Demokratie”, vermutlich weil „allergeilste” schlicht nicht Teil seines Wortschatzes war – habe gesiegt, lautete das Credo nach dem Umbruchsjahr 1989. Doch zeigte sich insbesondere in den von Rave-Musik beschallten neunziger Jahren, wie verhängnisvoll diese voreilige Triumpherklärung war – denn die Dinge wurden nicht besser, nur weil die Farben gehörig aufgedreht wurden.
Vielmehr gewann der Neoliberalismus an immer mehr Zugkraft und führte überall auf der Welt zu einer Erosion des Sozialstaats und damit auch des sozialen Gewebes schlechthin. Parallel dazu, dass ein paar drei Tage wache Druffis die ravende Gesellschaft herbeifantasierten, löste sich die real existente Gesellschaft graduell auf, weil sie kollektiv in ihre Einzelteile zerfiel und die Menschen zunehmend begannen, zuallererst auf sich selbst zu schauen – weil sie mussten. Thatcher sollte genau deswegen Recht behalten haben, da sie während ihrer Regierungszeit über die achtziger Jahre hinweg die ökonomischen Bedingungen für eine grundlegende gesellschaftliche Umwälzung gelegt hatte, die nach ihrer Abdankung im Jahr 1990 volle Blüten zu treiben begann.
Die Debatte um das Phänomen der Cancel Culture war in prä-pandemischen Zeiten keinesfalls ein Novum und auch schon vor langer Zeit in diesem Magazin ein Thema gewesen.
Die in diesen Jahren den Mainstream erreichende Rave-Kultur diente in kultureller Hinsicht gleichermaßen als Steigbügelhalter dieser Prozesse, wie ihr ideologisch doch angeblich so gefestigter Kern davon zersetzt wurde. Es setzte eine „neue Zensur” ein, wie es der französische Philosoph Jacques Derrida Mitte des Jahrzehnts hinsichtlich des Siegeszugs des Privatfernsehens konstatierte. Diese Zensur wurde nicht etwa autoritär von oben verordnet, sondern funktionierte nach den Regeln des Marktes: Sie „schöpft die Kraft ihrer List daraus, dass sie Konzentration und Zerlegung, Akkumulation und Privatisierung vereinigt”. Alle machten im Großen und Ganzen irgendwie separat ihr eigenes Ding, niemand redete mehr miteinander, und die Konsequenz von alledem war eine weitere Atomisierung dessen, was von der Gesellschaft zu diesem Punkt noch übrig war.
Das Resultat dieses widersprüchlichen, vom Neoliberalismus angestoßenen und angetriebenen Prozesses sei eine gründliche „Entpolitisierung”, so Derrida. Der Begriff muss wörtlich genommen werden. Politik ist nicht ohne gemeinsames Forum und erst recht nicht ohne Kollektiv denkbar. Übrig blieben eine Gesellschaft, die so nicht mehr zu nennen war, und das Individuum, das sich mit diesem Trümmerhaufen konfrontiert sah – einzeln tanzende Menschen in der wogenden Masse. Und weil dieses Individuum keine Alternativen zum dominanten Status quo erkennen konnte, entschied es sich folgerichtig dazu, sich selbst bloß nicht ein- und stattdessen lieber auf die anderen zu scheißen.
Epidemischer Neoliberalismus: Plague Raves und Cancel Culture
Am deutlichsten offenbarte sich die People-look-to-themselves-first-Ideologie in der weltweiten Clubkultur in ihrer aktuellen Form am Beispiel der Ein-Prozent-DJs, die nicht nur während des ersten Pandemiejahres noch fröhlich durch die Welt jetteten, sondern sogar im Frühjahr 2021 Abstecher nach beispielsweise Indien wagten – zu einer Zeit, in der bereits völlig absehbar war, dass das Gesundheitssystem des Landes unter der Last des quasi uneingeschränkt grassierenden Virus kollaborieren würde. Drauf geschissen! Oder an all jenen, die sich gleich nach Sansibar absetzten, wo die Leugnung des Coronavirus und seiner Auswirkungen zur Staatsräson erhoben wurde. Parole: Bloß nicht einmischen, das Kapital soll schließlich zirkulieren. Epidemischer Neoliberalismus, so gesehen. Kein Wunder, dass sich gut- und bestverdienende DJs in solchen Umfeldern wohl fühlten.
Als nach Wiedererwachen des Clublebens in Zentraleuropa ab Ende des Sommers dieselben DJs auf Instagram ihre Tourankündigungen veröffentlichten und dabei wie nebenbei anmerkten, wie schön es doch sein wird, endlich wieder gemeinsam feiern zu können, entging der offensichtliche Zynismus solcherlei Aussagen augenscheinlich zwar sehr vielen Fans. Bei anderen hingegen wurde er wiederum zum Aufhänger für veritable Aufregemarathons, wie sie sich weiterhin an jeder möglichen Gelegenheit entzünden.
Die Debatte um das Phänomen der Cancel Culture war in prä-pandemischen Zeiten keinesfalls ein Novum und auch schon vor langer Zeit in diesem Magazin ein Thema gewesen: Schon als der – vor allem auf rechter Seite verbreitete – Begriff noch kaum benutzt wurde, bezeichnete Ji-Hun Kim im Jahresrückblick 2015 „die Bigotterie innerhalb der sogenannten Szene” als „das eigentliche Problem” derselben. Kim analysiert in seinem Text anhand vieler Fallbeispiele wie etwa den homophoben Aussagen eines DJs die Empörungsmechaniken, die solcherlei Entgleisungen auslösten – und wie die lautesten Szenemitglieder wiederum davon profitierten, weil sie sich moralisch als Wahrer*innen einer, so Kim, „politischen Korrektheit” inszenieren konnten. Derweil sich an den Grundübeln nichts änderte, versteht sich.
Nicht das Kapital, sondern eine tatsächliche, kollektiv organisierte Graswurzelbewegung hat mit sehr konkreten Zahlen und noch konkreteren Forderungen graduelle Änderungen im Betrieb bewirkt.
Denn das ist Krux der sogenannten Cancel Culture: Dass sich wohlmeinende und bisweilen zweifelsfrei angebrachte Kritik an den Verhältnissen nur an individuellem Fehlverhalten entzündet einerseits und dass andererseits der vermeintlich politische Einsatz für eine saubere(re) Szene selbst der Akkumulation sozialmoralischen Kapitals innerhalb derselben dient. Nicht wenige DJs, Produzent*innen und Mitglieder der Szene wurden im zurückliegenden Jahr auf absonderliche Art und Weise zu moralischen Pandemiegewinner*innen, weil sie hier oder dort ihre Stimme gegen diejenigen erhoben, die sich offensichtlich über allen epidemiologischen Sachverstand und Solidaritätsgebote hinwegsetzten.
Nebeneinander betrachtet könnten die Plague-Raver*innen und die als Stimmen der Vernunft auftretenden Szenefiguren zwar kaum unterschiedlicher sein. An ihnen jedoch offenbart sich erneut der immanente Widerspruch, auf dem Rave-Ideologie als Ausprägung neoliberalen Gedankenguts überhaupt basiert – was letztlich auch bedeutet, dass es nun komplett irrelevant ist, ob jemand sich mit viel Ellbogenfett individuell durch die Krise hinweg massenhaft Vorteile verschafft (selbst die Aufregung ist ja vorteilhaft: die DJs bleiben im Gespräch, die Kasse klingelt sowieso) oder aus dem Lockdown heraus Anklagen formuliert (und damit, ob nun gewollt oder nicht, an der eigenen Marke als integre Szenefigur arbeitet). Der Fehler nämlich liegt im System, und dieses ist viel umfassender als diese Szene an sich.
Doch was tun? Wie Kritik üben, die eben nicht allein von Aufreger zu Aufreger hüpft und dabei Grundübel unberührt lässt? Darüber wurde im Frühling dieses Jahres ebenfalls in der GROOVE diskutiert: Autor Lars Fleischmann plädierte in einem Kommentar für „eine konkrete Inventur und eine gerechte Reflexion” innerhalb der Szene, während Redakteur Maximilian Fritz dem entgegenhielt, dass es auch bei der Dokumentation von Plague Raves auf Sansibar „ausnahmsweise um größere Zusammenhänge” ginge. Auffällig an beiden Texten ist, dass keiner von ihnen eine dezidierte Handlungsaufforderung enthielt, sondern Fleischmann seinen Ausweg ins Abstrakte nahm und Fritz trotz aller Bedenken gegenüber dem Ist-Zustand ein bisschen Positives darin sah. Schwammige Aufrufe zur Selbstreflexion hier, die Hoffnung, dass durch viel Stückwerk irgendwann ein systemischer Umschwung zumindest innerhalb der eingemeindeten Szene möglich wird – kann das wirklich alles sein?
People Looking out for Each Other
Das sollte es zumindest nicht. Denn so wie sich recht genau ausmachen lässt, welche politischen Verfehlungen und individuellen Fehltritte uns Ende 2021 in den nächsten Lockdown bugsieren, so ist dies auch mit Blick auf die Geschichte der Rave-Kultur möglich. Nun lassen sich daraus einige Lehren ziehen. Zum einen bringt es offensichtlich nichts, sich nur an individuellen Aufregern aufzuhängen, auch weil das erwiesenermaßen zu nichts führt. Das zeigte sich auch kurz vor Jahresende, als ein repressiver Staat ankündigte, eine große Bandbreite von DJs für ein Propagandafestival einzuladen. Die wenigen geladenen Gäste, die auf die Kritik reagierten, mussten zwar öffentlich Buße tun. Wer sich allerdings fein aus dem Strudel der Kommentare heraushielt, wird vermutlich ungestraft davonkommen – mal wieder.
Dagegen verdeutlichte die journalistische Auseinandersetzung mit sexuellen Übergriffen und sexistischen Strukturen in der Szene, ob nun durch Annabelle Ross oder auch in der GROOVE durch Lea Schröder, dass sorgsam aufbereitete Berichterstattung konstruktivere Beiträge zu den Übeln des Systems erlaubte als jeder anonym über Twitter abgeschossene Callout. Vor allem aber zeigte sich schleichend und doch merklich, dass insbesondere die Arbeit von female:pressure über das vergangene Jahrzehnt hinweg einen deutlichen Umschwung bewirkte, der von der –in diesem Jahr aktualisierten – FACTS-Studie gleichermaßen angestoßen wie dokumentiert werden konnte. Egal, wie viele von Alkoholmarken gesponserte Kampagnen diese oder jene DJ zu empowern versprechen: Nicht das Kapital, sondern eine tatsächliche, kollektiv organisierte Graswurzelbewegung hat mit sehr konkreten Zahlen und noch konkreteren Forderungen graduelle Änderungen im Betrieb bewirkt.
female:pressure ist eines, zum Glück aber nicht das einzige Beispiel für eine Initiative, die innerhalb einer neoliberal überformten Szene der neoliberalen Direktive des unbedingten Individualismus trotzt und somit für Repolitisierung dort sorgt, wo die Entpolitisierung bisweilen perfekt scheint. Schon vor und insbesondere aber während der Pandemiezeit kam es zunehmend zu Zusammenschlüssen regionaler Interessenverbände. Das Klubnetz Dresden e.V. fand sich beispielsweise im Januar 2020 zusammen, im Februar dieses Jahres erfolgte ein gewerkschaftlicher Zusammenschluss österreichischer DJs und Aktionen wie der Global Nightlife Recovery Plan wurden sogar international koordiniert. Waren vorher Clubs und vor allem DJs ideale Repräsentationsfiguren neoliberaler Handlungsmaxime insofern, dass sie gleichermaßen zuerst auf sich selbst schauten und ihre Problemchen eigenverantwortlich zu schultern versuchten, setzte erzwungenermaßen ein Umdenken ein, das in neuen Zusammenschlüssen mündete – people looking out for each other.
Selbst wenn es ein Glied in der Kette verkackt, sind damit noch lange nicht alle komplett angeschissen.
Während sich also an vorderster Front auf diese oder jene Art in Ellbogenindividualismus geübt wurde, wurden hinter den Kulissen Bündnisse geschlossen und sich in solidarischer Kollektivität geübt. Insbesondere die Berliner Clubcommission ist dabei zur internationalen Vorreiterin aufgestiegen, weil sie durch unermüdlichen Einsatz und gezielte politische Lobbyarbeit die Interessen der Szene vertreten hat. Möglich ist das allemal nur deswegen, weil sie mit sehr konkreten Zahlen für die Relevanz von Clubkultur in der Stadt oder zumindest in ihren Kassen argumentieren kann. Aber eben auch, weil sie über die diversen Differenzen und Partikularinteressen hinweg die regionale Szene als geschlossene Einheit zu repräsentieren vermag.
Die unter anderem von Seiten der Clubcommission angestrebte regionalübergreifende Vernetzung ist daher umso mehr zu begrüßen: Denn auch in Sachsen oder Salzburg, wo sich ähnliche Projekte formiert haben, die einer neoliberalen Politik gegenüber weit weniger gute ökonomische Argumente für ihren kulturellen Beitrag vorhalten könnten, dürfte von starken Bündnissen umso mehr profitiert werden. Denn, um es sharepicfreundlich zu formulieren: Selbst wenn es ein Glied in der Kette verkackt, sind damit noch lange nicht alle komplett angeschissen.
Angesichts der allgemeinen Beschissenheit der Dinge ist das mindestens ein tröstender Gedanke, er sollte allerdings nicht nur im Kern der internationalen Szene, sondern auch darüber hinaus zum neuen Leitfaden werden. Denn die sozioökonomischen Grundstrukturen, die herrschende Ideologie und die daraus resultierenden Verwerfungen betreffen eben nicht nur diesen kleinen Teil des vorrangig kulturellen und nur sekundär sozialen und politischen Lebens.
Die Repolitisierung einer entpolitisierten Szene muss demnach auf ideologischer wie auf organisatorischer Ebene zugleich stattfinden, gleichermaßen die dominante Scheiß-auf-alle-anderen-Mentalität hinter sich lassen, wie Brückenschläge über bestimmte Differenzen hinweg – wenn selbst dezidiert politisch progressiv agierende Clubs in moralinsauer geführte Stellvertretungsdiskussionen gerissen werden, ist etwas faul im Staate Ravemark – notwendig sein werden. Vielleicht klappt’s dann mit der Rave-O-Lution, auch wenn am Ende womöglich nicht die ravende Gesellschaft steht. Sondern womöglich gar eine neue, bessere. Oder zumindest überhaupt wieder eine.