Dieser Beitrag ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2025. Alle Artikel findet ihr hier.
Barker – Stochastic Drift (Smalltown Supersound)
Stochastic Drift entstand in einer Zeit des Wandels und der Unsicherheit, was sich in der Produktion widerspiegelt. Statt festen Strukturen zu folgen, ließ Barker das Unvorhersehbare in seine Musik einfließen: „Ich hatte zuvor mit einem sehr bewussten und zielgerichteten Ansatz gearbeitet, aber ich merkte, dass das im Kontext der Ungewissheit nicht so hilfreich war”, so der Producer.
Barker ist auch für seine Zusammenarbeit mit nd_Baumecker (als Barker & Baumecker) bekannt, mit dem er mehrere EPs und ein Album auf Ostgut Ton veröffentlicht hat. Seine Soloarbeiten erforschen häufig die Schnittstellen von Klang, Technologie und Körperwahrnehmung – inspiriert von akustischer Forschung, psychoakustischen Effekten und Tanzmusik. Yeliz Demirel
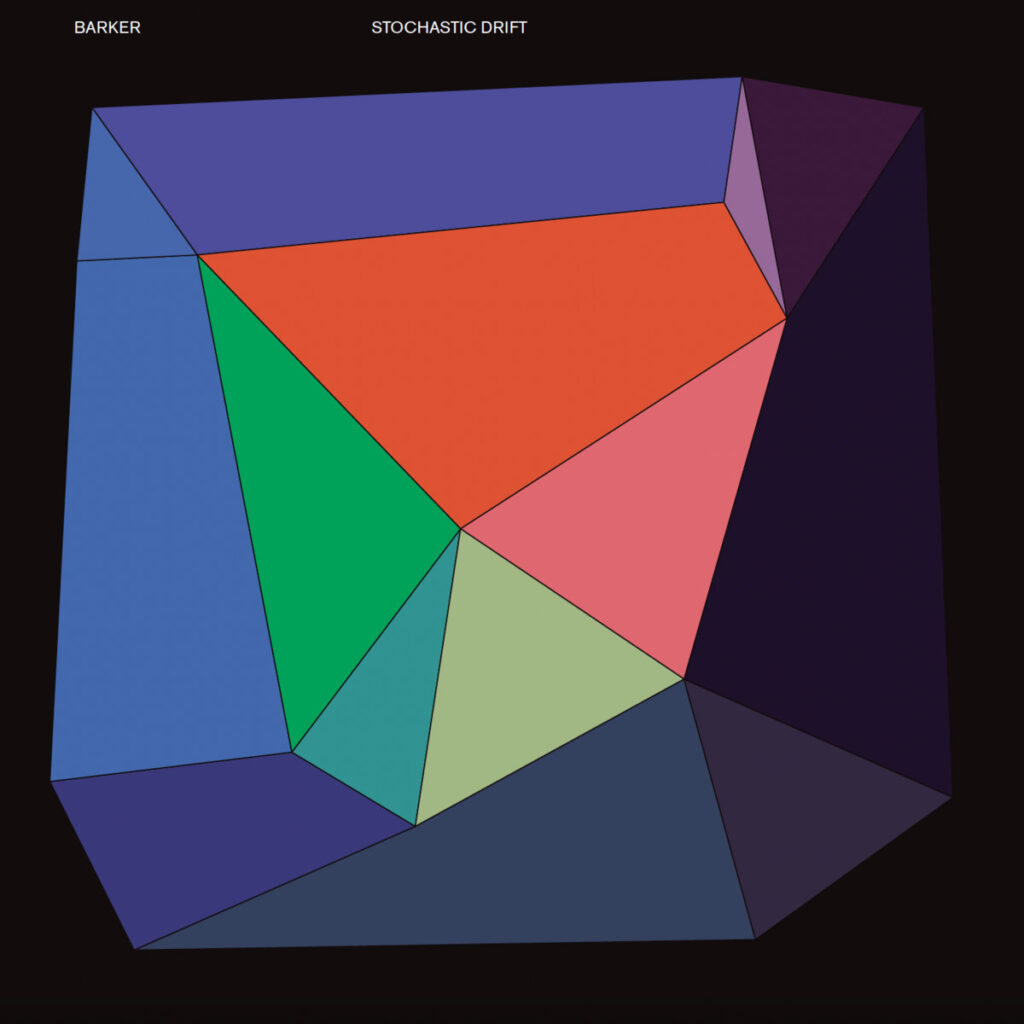
Biosphere – The Way Of Time (AD93)
Braucht elektronische Musik Worte? Genauer müsste man wohl fragen: Wann gehen elektronische Musik und Text eine günstige Verbindung ein? In manchen Fällen wirken die Worte leicht übergestülpt, was dann auf Kosten der Musik geht, oder sie werden umgekehrt von der Musik in ihrer Kraft geschwächt. Bleibt eine heikle Balance, ungeachtet gelungener Beispiele wie Larry Heards „The Sun Can’t Compare”, Karlheinz Stockhausens „Gesang der Jünglinge” oder DAFs „Der Mussolini”.
Irgendwo dazwischen findet sich das neue Album von Geir Jenssen alias Biosphere. Auf The Way Of Time vertonte er Passagen aus dem 1926 erschienenen Roman The Time of Man der US-amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Madox Roberts. Er verwendet dazu Samples aus einer Hörspielfassung des Buchs mit der Stimme der Schauspielerin Joan Lorring. Zu der wie von fern sprechenden, leicht verwaschenen Stimme kommen Geräusche von Grillen und Zikaden, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie aus dem Hörspiel stammen oder von Jenssen hinzugefügt sind, und seine kreiselnden Synthesizer, in einigen Stücken mit dezent bouncendem Beat unterlegt. Der etwas distanzierte Tonfall Lorrings, die stoischen Patterns und die Art, wie Biosphere die geloopte Stimme in seine repetitiven Strukturen einbaut, entfalten nach und nach immer stärker ihren Hypnose-Effekt. Am Anfang mag man sich noch fragen, wozu das jetzt, am Ende hat sich die Frage aber selig in ihre Sinnbestandteile zerlegt. Tim Caspar Boehme

Blawan – SickElixir (XL Recordings)
Mit SickElixir legt Jamie Roberts alias Blawan sein bisher radikalstes Statement vor – ein Album, das klingt, als würde jemand die DNA des Techno zerlegen. XL Recordings überrascht mit dem Album, das roh, unruhig, zutiefst körperlich daherkommt. Der Opener „The GL Lights” klingt wie eine Wiedergeburt unter Neonlicht, ein schwer atmender Maschinenorganismus. Doch schon mit dem Focustrack „NOS” zündet Roberts das eigentliche Konzept: Hochkompression trifft auf Katharsis. Hier verschiebt sich Blawan endgültig vom puristischen Techno hin zu einem emotionalen Noise-Hybrid, der seine Wut in Struktur verwandelt. „Rabbit Hole” mit Monstera Black ist das Herz des Albums – ein fiebriger Trip durch gebrochene Rhythmen und körperliche Verzerrung. Der Track hat etwas Paranoides, fast Theatralisches: Bass als innerer Monolog. Dann plötzlich: „Birf Song”, eine fragile Miniatur, die wie ein Rest Licht in einem dunklen Raum wirkt. Zwischen all den martialischen Texturen blitzt hier ein Moment echter Verletzlichkeit auf. Und im Titelstück bündelt sich schließlich alles – die Härte, die Intimität, die unterschwellige Hoffnung. Es ist kein kathartischer Abschluss, sondern ein offener Bruch, ein Riss.
Blawan gelingt auf SickElixir das Kunststück, seine industrielle Ästhetik zu humanisieren, ohne sie zu entschärfen. Wo frühere Veröffentlichungen wie Woke Up Right Handed noch wie Experimente im Maschinenraum wirkten, entsteht hier ein komplexes, fast biografisches Klanggebilde: Techno als Selbstporträt. Liron Klangwart

Carrier – Rhythm Immortal (Modern Love)
Guy Brewer blickt auf eine bewegte Musikgeschichte zurück und hat mit seinen Projekten schon jetzt das Kunststück fertiggebracht, verschiedenste Szenen mitzuprägen. Als Gründer von Commix entwickelte er unter anderem auf Labels wie Metalheadz die Evolution des Post-Tech-Step-D’n’B-Sounds der Nullerjahre mit, um anschließend als Shifted für über eine Dekade einen reduzierten dunklen Techno-Sound bei Mote-Evolver oder Avian weiterzuentwickeln. Und das ist nur ein Auszug aus seinem Schaffen, das auch kurzlebigere Projekte wie Alexander Lewis, A Model Authority oder die selbsternannte D’n’B-Supergroup The Cambridge 4 beinhalten.
Nach zehn Jahren Berlin ist Brewer vor zwei Jahren nach Belgien gezogen und hat auch musikalisch nach einem Neuanfang gesucht. Die ersten Releases als Carrier fielen vermutlich nicht ganz zufällig mit dem Zeitpunkt des Umzugs zusammen und schlagen ein komplett neues Kapitel auf: die EPs auf The Trilogy Tapes und FELT eröffneten bereits komplett neue Räume, die starke Assoziationen mit Dub-Techno-Explorationen von Basic Channel und – wahrscheinlich ungewollt, aber nicht unpassend – an den gleichnamigen Track („Carrier”) von Rhythm & Sound weckten. Durchaus möglich aber, dass sowohl bei Brewers Projekt als auch beim gleichnamigen R&S-Track die gleichen Assoziationen mit einem Begriff aus der FM-Synthese Pate standen, wo der „Carrier” als Trägersignal für Modulationen dient, die für Dub und Dub Techno stilprägend sind.
Mit seinem Debüt-Album hat Brewers neues Projekt beim Manchester Label Modern Love ein Zuhause gefunden, das kaum passender sein könnte – fühlen sich seine neuen Tracks zwischen Label-Legenden wie Andy Stott oder Demdike Stare doch sichtbar wohl. Die acht neuen Stücke auf Rhythm Immortal loten einen industriell anmutenden, explorativen Sound aus, in dem Dub Techno zwischen verhallten Samples, Vocals und Drones nur noch als omnipräsentes Echo erscheint und der in seiner reduzierten und soundverliebten Spielart nicht zuletzt an Robert Henkes Monolake erinnert. Eine Referenz, die Brewer selbst als Inspiration erwähnt und auf dem Album präsent zu sein scheint.
Symptomatisch scheint zum Beispiel „Carbon Works”, in dem ein klopfender Beat nach und nach der Echokammer entschwebt und in einen polyrhythmischen Reigen aus industriell anmutenden Samples übergeht. Jeder Track bringt hier eigenständige Elemente und Einflüsse ein, wie die im Sound floatenden Vocals von Noa Kurzweill bei der Voice-Actor-Kollaboration „Veil Of Yours”. Und nicht zuletzt die dunkel an dekontextualisiert-isoliertes Jazz-Instrumentarium erinnernden Drum-und-Sax-Samples bei „Outer Shell”oder „Offshore” (feat. Memotone).
Verraucht tribalistische Referenzen meint man bei „Wave after Wave” und „Amber Circle” herauszuhören, ohne sich je ganz sicher sein zu können. Der Sound gibt eine Richtung vor, lässt aber ähnlich wie bei Henke viel Raum, den man mit eigenen Assoziationen und Interpretationen füllen kann. Oder wie es Brewer selbst umschreibt: „I wanted it to feel like a dream you have where you’re somewhere familiar, which feels nevertheless otherworldly.” Und das ist ihm auf dem Album vortrefflich gelungen. Stefan Dietze

DJ Koze – Music Can Hear Us (Pampa)
In einer Welt, in der elektronische Musik oft zwischen algorithmisch berechneter Tanzbarkeit und der zwanghaften Suche nach Authentizität pendelt, ist DJ Koze eine seltene Figur: ein Bastler, ein Klangpoet, ein freier Radikaler im System. Seine Alben wirken weniger wie Veröffentlichungen als Portale; tief persönliche, mitunter dadaistische Audio-Collagen, die weniger das Jetzt abbilden als eine andere Realität erzeugen. Umso gespannter war man auf Music Can Hear Us, das erste Koze-Album seit dem bahnbrechenden Knock Knock von 2018. Schon das Artwork von Gepa Hinrichsen, ein expressionistischer Bastard zwischen Basquiat und Kinderzeichnung, signalisiert: Hier ist nichts konventionell, nichts eindeutig. Der Opener „The Universe in a Nutshell“ bestätigt diese Erwartung.
Das Stück hat ein fragmentiertes, fast jazziges Intro, das wie ein gestottertes Willkommen in Kozes Kosmos wirkt: verspielt, verkopft, dabei nie kopflastig. Ein Klangraum, der immer auch ein Gedankenraum ist. Und dann kommt Blur-Sänger Damon Albarn. In „Pure Love” entfaltet sich eine fragile Pop-Ballade, deren Schönheit gerade aus ihrer Unvollkommenheit wächst. Albarn murmelt sehnsüchtig über ein Koze-Fundament aus digitaler Melancholie und analogem Bröseln. Es ist der vielleicht berührendste Moment des Albums und zugleich ein Versprechen, das im Verlauf der Platte nicht immer eingelöst wird.
Denn so faszinierend Music Can Hear Us konzeptionell und atmosphärisch ist, so sehr kämpft es auch mit Längen. Gerade im Mittelteil, etwa mit Tracks wie „The Talented Mr. Tripley”, „What About Us” oder „Unbelievable”, stellt sich ein Gefühl der Gleichförmigkeit ein. Statt der typischen Koze’schen Überraschungen dominieren breitgewalzte Beats, repetitive Samples, ein Sounddesign, das sich in seiner eigenen Coolness zu gefallen scheint. Man vermisst den Witz, die Unverfrorenheit, das Unberechenbare. Jenen Moment, in dem Koze sonst das Steuer reißt und den Hörer plötzlich rückwärts durch ein Zeitloch zieht. Dabei gibt es zwischendurch immer wieder Lichtblitze: „Tu Dime Cuando”, ein bittersüßes Duett zwischen Ada und Sofia Kourtesis, changiert elegant zwischen Club, Sehnsucht und sanftem Sonnenuntergang. „Vamos A la Playa” ist ein dekonstruiertes Popsong-Gespenst, Soap&Skin haucht darin geisterhaft ins Leere. Und „Die Gondel” ist ein grummelndes Kleinod, wie ein vertonter Spaziergang durch Wien im Februar. Dennoch bleibt ein Zwiespalt.
Denn so liebevoll und detailversessen Koze mit seinen Gästen und Fragmenten umgeht, so sehr verliert sich das Album stellenweise in sich selbst. Man könnte sagen: Die Musik hört uns, aber sie antwortet nicht immer. Erst gegen Ende flammt das Album noch einmal richtig auf: „Brushcutter” und „Buschtaxi” sind Miniaturen, die vor schrulliger Eigenwilligkeit glänzen. Und „Umaoi”, das Finale mit dem ainu-folkigen Vokalensemble Marewrew, ist schlicht atemberaubend. Archaisch und hypermodern zugleich – als würde man über Jahrtausende hinweg eine Stimme hören, die man nie vergessen kann, obwohl man sie nie gehört hat.
Music Can Hear Us ist ein paradoxes Album: Es schwebt leicht, aber es trägt schwer. Es umarmt dich, aber manchmal vergisst es dich auch. Vielleicht liegt darin gerade sein Reiz – und sein Risiko. Koze bleibt ein Genie der Intuition, ein Seismograph für das Zwischenmenschliche im Elektronischen. Das Ergebnis: eine klangliche Odyssee mit Umwegen, aber auch mit Momenten reiner Magie. Liron Klangwart

Djrum – Under Tangled Silence (Houndstooth)
Auf seiner 2024 nach fünfjähriger Veröffentlichungspause erschienenen Comeback-EP Meaning’s Edge hatte Djrum, nicht unähnlich André 3000 auf New Blue Sun, die Flöte als neues Leitinstrument entdeckt. Nun scheint es so, als gäbe auf seinem neuen Album das gesamte klassische Instrumenten-Repertoire, von Piano zu Cello zu Flöte, den Ton an.
Entlang der elf Stücke von Under Tangled Silence sind es immer wieder so langgezogene wie dennoch nicht langweilige Intros aus Streichern, Holzbläsern oder perlenden Klavierklängen, die in den weitgefassten Klangkosmos dieser Musik hineinziehen.
In „L’Ancienne” etwa morpht über eineinhalb Minuten ein dumpf präpariertes Piano mit atonal tönender Modular-Electronica, bevor sich der Track in tribalistischen Breakbeats auflöst, die federweich wippend ins Ohr schweben, während sie dabei tonnenschwere Sub-Frequenzen transportieren. Man wird mitgenommen zu tiefschwarz ins Dunkle schürfenden Klangritualen, die sich immer wieder in Kompositionen auflösen. Diese verbinden wunderweiche Electronica-Melodien, die, so verspielt wie verspult, an Gamelan-Sequenzen erinnern, mit sich rasend schnell ins Ohr bohrenden Perkussion- und Kickdrum-Attacken.
Mitunter lässt Djrum die vorantickenden Rhythmen auch komplett hinter sich und taucht ein in einen ambienten Atmosphäre-Teich aus Streicher-Drones und melancholischen Piano-Sentenzen, die auf einem Max-Richter-Album auch nicht fehl am Platze wären. Immer wieder verbindet er auf kongeniale Weise moderne Klassik-Momente mit den auralen Gesetzmäßigkeiten des Hardcore Continuums – ohne jedoch sich auch nur einmal in angestaubter Breakbeat-Pastiche zu verlieren. Und das macht Under Tangled Silence einzigartig, wenn nicht gar zu einem Anwärter auf den Pokal für das Album des Jahres 2025. Tim Lorenz

Efdemin – Poly (Ostgut Ton)
Sechs Jahre hat es gedauert, bis Phillip Sollmann alias Efdemin wieder ein vollständiges Album vorlegt. Schon der Titel deutet es an: Poly meint Vielstimmigkeit, Vielschichtigkeit, das Auflösen starrer Formen zugunsten einer vibrierenden, atmenden Klangökologie.
Das Album beginnt mit „Drift”, einem schwebenden Stück, das wie ein Atemzug funktioniert – langsam, tastend, mit subtilen Verschiebungen zwischen Drone und Dub. Danach öffnet sich das Feld. Der Titeltrack pulsiert mit mathematischer Präzision, aber dahinter glimmt Wärme. Besonders hervorzuheben ist „Signal to Noise” – ein Stück, das Efdemins feines Gespür für Balance zeigt. Zwischen Rauschen und Struktur, zwischen Clubenergie und Kontemplation. Die Bässe sind trocken, das Rauschen flirrt – technoider Minimalismus, der fast poetisch wirkt. „Rauris” und „Aachen” dagegen tragen geografische Namen, als wären sie Erinnerungsorte in Sound gegossen. „Rauris” ist ein meditatives Stück, während „Aachen” mit dissonanten Schwingungen die Brücke zwischen sakralem Raum und Maschinenmusik schlägt. Und dann: „Radical Hope”, meditative Klangflächen durchbrechen ein dichtes Geflecht aus Rhythmen und Texturen, ein Moment von fast utopischer Offenheit. Am Ende, mit meinem Highlight „Below the Surface”, sinkt man sanft in die Schichten unterhalb der Beats, dorthin, wo Efdemin seit jeher seine eigentliche Sprache findet: die des Zuhörens, der Resonanz, des vibrierenden Stillstands.
Poly ist kein lautes Comeback, sondern eine subtile, präzise formulierte Klangschrift. Ein Album, das die Geschichte des Techno hinterfragt – und dabei so leise wie konsequent antwortet. Liron Klangwart
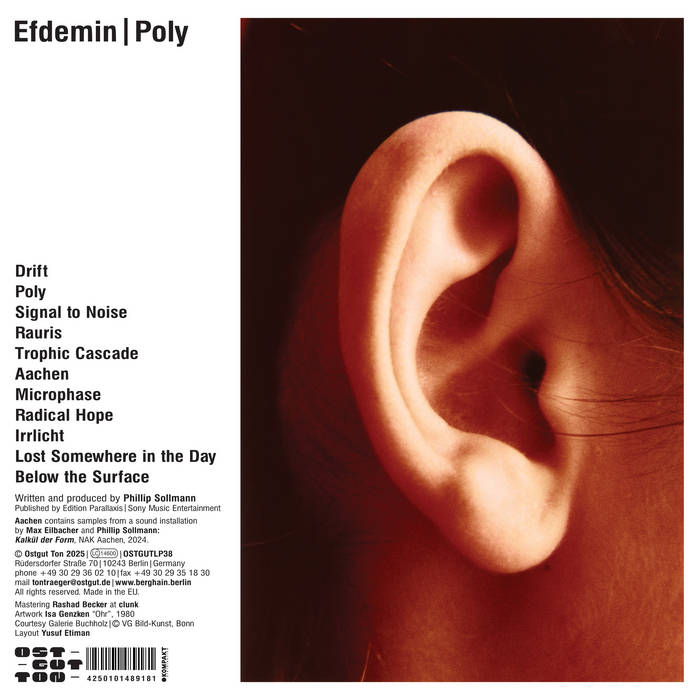
Erika de Casier – Lifetime (Independent Jeep Music)
Boom-Bap-Beats waren in den frühen Neunzigern nicht nur im Hip-Hop beliebt – dort also, wo sie entstanden waren. Sie bildeten auch das Gerüst für viele Songs der Manchester-Bands wie Happy Mondays und Stone Roses und außerdem für einige wunderbare One-Hit-Wonder. Erika de Casier scheint diese geradlinige, klare Produktion von Candy Flips Beatles-Coverversion „Strawberry Fields Forever” oder „Sweet Harmony” von The Beloved auf ihrem neuen Album Lifetime im Kopf zu haben. Die kickenden Beats sind ganz auf Pop produziert. Dabei scheint noch eine andere Referenz der besagten Zeit auf: Die Beats von Future Sound Of London in ihrer futuristischen Transparenz. Etwa fünf Jahre später würden William Orbit und Madonna diesen Sound zum Bestseller-Album Ray Of Light formen.
Ein leichtes Insektenschwirren scheint über „Miss” zu liegen, ein Wähltastenton doppelt die Gesangslinie von „The Chase”, silbrig schillert die Snare in „Delusional”, dazu wiehert ein Pferd, und verträumt lässt die Sängerin Vokale los. Dabei pflegt die in Portugal aufgewachsene de Casier eine absolute Ziellosigkeit. Nichts suchen, nichts wollen, alles ist egal. Dies jedoch in aller Entschiedenheit. All das zusammen macht aus Lifetime ein Sommeralbum. Ein Ideal von einem Sommeralbum und gleichzeitig ein Beispiel für ein Sommeralbum. Welchen Preis erzielen eigentlich Café-del-Mar-Shirts auf Vinted? Christoph Braun

Ishome – Carpet Watcher (Galaxiid)
Mirabella Karyanova aus Krasnodar, Russland, hat sich seit ungefähr 15 Jahren als Shadowax mit Deep Techno und unter ihrem Eigennamen mit eigenwillig knister-atmosphärischem Dubstep, der eben nicht nach Burial klingt, international bekannt gemacht, kommt als Ishome oft ganz ohne Beats aus. Der ausladende Soundtrip Carpet Watcher (Galaxiid, 27. Juni) auf Nina Kraviz‘ experimentellem Zweitlabel zeigt die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, wie sich beatlose, aber nicht arrhythmische Electronica anhören kann, wenn Inspiration und produktionelles Können aufeinandertreffen. Da ist es besonders schade, dass Karyanova so selten etwas veröffentlicht; und wenn, dann womöglich noch viele Jahre unter Verschluss hält wie Carpet Watcher, das 2018 produziert wurde, aber keine Minute gealtert ist.

Lucrecia Dalt – A Danger to Ourselves (RVNG Intl.)
Wo der Name Lucrecia Dalt draufsteht, steckt immer etwas Sonderbares drin. Sogar wenn die kolumbianische Musikerin vordergründig Pop bietet wie auf ihrem aktuellen Album A Danger to Ourselves. Mehr als sonst zentriert sie die Musik um ihre Stimme, und die Nummern folgen in ihrem Aufbau weitgehend Songstrukturen, doch trotzdem kann man nicht sagen, dass die Platte konventioneller geraten sei als ihre früheren. Lucrecia Dalt schreibt ihre Musik mit der Entdeckungslust einer Forscherin, die in Vertrautem stets Unbekanntes aufspürt. Waren ihre früheren Alben vorwiegend elektronisch, verwendet sie inzwischen eine Vielzahl akustischer Instrumente, gespielt von ihr selbst oder ihren Gästen. Die Besetzung reicht von Gitarre, Bass, Perkussion und Streichern bis zum Saxofon. Diese verfremdet sie oder wählt Rhythmen, die auf kaum merkliche Weise komplex sind. So gibt es in jeder Nummer neue Überraschungen, von den eigenwilligen Kombinationen von Klängen über unerwartete Details bis zu abrupten Richtungswechseln im Song. Das alles mit einer Eleganz, die auch abseitige Einfälle völlig selbstverständlich wirken lässt. Produziert hat sie das Album mit der grauen Pop-Eminenz David Sylvian, der im ersten Stück als Gitarrist und mit einer Spoken-Word-Einlage in Erscheinung tritt. Vielleicht wäre dieser Gastauftritt gar nicht nötig gewesen: Dalt hat eine Größe ganz eigener Rätselhaftigkeit. Tim Caspar Boehme

Margaux Gazur – Blurred Memories (Smallville Records)
Jedes dieser Stücke könnte 30 Minuten dauern, es lässt sich gut darin verlorengehen. Oder 30 Sekunden, alles hier lädt ein zum Loopen. Flache Bassdrums, von Subs unterspült, wenige Akkordwechsel, Blue Notes: Margaux Gazur, eine französisch-vietnamesische Künstlerin mit derzeitigem Sitz in Berlin, interpretiert den Entwurf des Smallville-Sounds in besonders inniger, spannungsloser Weise. Ihr Album Blurred Memories hat keinen Anfang und kein Ende. So geht es jedem einzelnen Track.
Es passiert halt nicht viel, und das bei vollem Willen und Bewusstsein: Das Titelstück etwa kommt mit wenigen Spuren aus. Zum beinahe statischen, verbeulten, melancholischen Key kommt eine pochende Bassdrum. Irgendwann. Und zu Beginn, „Agata” heißt das Stück, pluckert es gut reinfühlmäßig, und so bleibt der Vibe. „Weich” heißt schließlich der Zusammenschluss von Leuten, die im queeren Berlin interdisziplinäre Kunst-Veranstaltungen durchführen und zu denen Margaux Gazur gehört. „Madake” klingt wie House aus Japan, „Su Phu” plonkert. Kein Spannungsaufbau ist auch eine Dramaturgie, zeigt dieses Album, und: Das Ambientige von Ambient kann in den Beats liegen. Christoph Braun

Mark Ernestus‘ Ndagga Rhythm Force – Khadim (Khadim)
Manche Musik lässt sich eigentlich gar nicht anhören – sie lässt sich nur betreten. Khadim, die neue LP von Mark Ernestus‘ Ndagga Rhythm Force, ist solch ein Raum – ein Klangraum. Kein Studioalbum im klassischen Sinne, sondern eine rhythmische Séance. Vier Stücke, vier spirituelle Episoden. Alles an diesem Album atmet, trommelt, fleht, flackert. Reduktion ist hier kein Verzicht, sondern ein Dogma: Gitarre? Weg. Ensemble? Ausgedünnt. Was bleibt, ist Essenz – Drums, Chords, Stimme, Raum.
Gleich der Titeltrack steht im Zentrum wie ein musikalischer Monolith. Slow-motion-House, wie er vielleicht einmal begann: ein einfacher Akkord, verhallte Keyboard-Stabs, ein Kickdrum-Herzschlag. Darauf tanzen die sabar-getriebenen Polyrhythmen von Serigne Mamoune Seck mit einer Eleganz, die keine Eile kennt. Mbene Diatta Seck, mehr Prophetin als Sängerin, erzählt, preist, zitiert. Der Song erinnert an Steppers-Reggae, aber ohne Rasta-Pathos; eher eine afrikanische Dub-Vision mit sufitischer Tiefe. Musik als Gebet, Groove als geistige Handlung. Ein House-Track, der betet, nicht pulsiert.
Dabei geht es um mehr als Spiritualität: Khadim ist auch politische Musik. Die Geschichte Cheikh Ahmadou Bambas, des Gründers der Mouride-Bruderschaft, schwingt in jedem Takt mit. Sein Exil, seine poetische Lehre, sein gewaltloser Widerstand – all das wird hier nicht erzählt, sondern körperlich erinnert. Musik als Archiv, als Ritual, als Widerstand. Ernestus gelingt es, all das in ein Setting zu überführen, das weder folkloristisch noch clubkonform klingt. Stattdessen: ein Gefühl von Weite, das sich aufbaut wie eine Prozession in Zeitlupe.
Dagegen ist „Dieuw Bakhul” komplexer, vertrackt, fragmentarischer. Der Beat ringt mit sich selbst, als wolle er sich zerschlagen und neu formieren. Synths winden sich wie dunkle Gedanken, Basslines kriechen unter die Haut. Mbene zersetzt ihre Stimme in Erinnerungsfetzen, in Zwischenrufe und seelische Splitter. Es geht um Verrat, um Enttäuschung – aber ohne Zorn, sondern mit fast zärtlicher Resignation. Und trotzdem: Aus dieser Zerrissenheit entsteht ein seltsames, hypnotisches Momentum. Man verliert sich, aber man bleibt nicht verloren. Die Musik scheint innerlich zu taumeln – aber gerade darin liegt ihre Wahrheit.
„Nimzat” wiederum ist die Reduktion auf den Rhythmus – und auf das, was über ihn hinausgeht. Stripped down, aber nicht leer. Die Perkussion trägt die Melodie, das minimale Arrangement wirkt wie ein stiller Trance-Loop. Und wieder: die Stimme als Scharnier zum Spirituellen. Sie hebt ab, wie von innen gezogen, fast entrückt. Keine Ekstase, sondern fokussierte Hingabe. Mbene singt nicht für das Publikum, sondern für etwas Höheres – und wir hören nur zufällig mit. Die Musik flackert, der Raum bebt leise, und plötzlich ist da: eine innere Bewegung, die nicht mehr aufhört.
„Lamp Fall” schließlich lässt man am besten einfach laufen. Der Track zieht sich nicht auf – er fließt. Ein langsamer Downshift, der keine Pointe braucht. Die Beats gleiten, die Synths murmeln, Mbene schwebt über allem. Die Hommage an Cheikh Ibra Fall, Gründer der Baye Fall, wird zur klanglichen Meditation. Der Groove ist sanft, aber bestimmend. Der Raum tut den Rest: Hier passiert Magie nicht durch Aktion, sondern durch Geduld. Wer zuhört, wird mitgezogen – ob er will oder nicht.
Was dieses Album so besonders macht, ist seine dichte, doch transparente Textur. Nichts drängt sich auf, alles ist in sich ruhend, offen für Projektion. Khadim ist auch das Dokument eines langen Prozesses. Fast ein Jahrzehnt ist seit dem Vorgänger Yermande vergangen, doch was hier erklingt, ist nicht das Produkt von Stillstand, sondern von Transformation. Live geformt, durch hunderte von Konzerte, geerdet in kollektiver Erfahrung. Die Studioaufnahme ist fast eine Nachzeichnung dieses kollektiven Bewusstseinszustands.
Khadim ist kein Album für die Funktion, eigentlich nicht für den Dancefloor, nicht fürs Radio. Es ist ein Ritual in vier Teilen. Es meint es ernst. Und genau das macht es so dringlich. Mark Ernestus hat hier keine Platte produziert, er hat ein klangliches Gefäß gebaut. Für die Rhythmen. Für die Stimmen. Für den Geist. Für etwas, das bleibt, wenn alles andere längst vergangen ist. Ein Klang, der nicht gehört, sondern durchlebt werden will. Liron Klangwart

Nick León – A Tropical Entropy (TraTraTrax)
Schade, dass Rosalía nicht auf dem neuen Nick-León-Album singt. Das hätte wunderbar als Kontinuität zu ihrem sensationellen Album Motomami funktioniert. Das aber nur am Rande – und zur stilistischen Einordnung von A Tropical Entropy. Das ist auch ohne den spanischen Star schwer ergreifend. Jeder Track absolut auf der Höhe der Zeit. Global, mit ganz viel Vocals. Und allem, was Latin-Pop und Clubmusik aus Südamerika so modern macht. In Deutschland sind Stile wie Reggaeton leider noch nicht so angesagt und spielen im Club nur eine partielle Rolle.
Im Rest der Welt ist das anders. Reggaeton und seine diversen Spielarten erfrischen mit Takten, die ein gemeinschaftliches Tanz-Erlebnis mit viel Freude im Gesicht hervorrufen. A Tropical Entropy wird Ähnliches anrichten. Und das mit diversen Gesangs-Gäst:innen, wie der kolumbianischen Multiinstrumentalistin Ela Minus, der kanadischen Produzentin Casey MQ, Sängerin Erika de Casier aus Portugal, Nick Leóns Miami-Nachbar Jonny From Space oder dem Berliner Produzenten Lavurn. Die oft durch Autotune verfremdeten Stimmen tanzen, singen, croonen über Liebe und Herzschmerz zu knarzenden EDM-Bässen, Camp-Melodien, digitalen Gitarren, zackigen Dance-Grooves und locker hüpfenden Rhythmen. Ein Longplayer, der Nick León, das Label TraTraTrax und Musik aus Lateinamerika weiter vorne in der internationalen Popmusik platzieren wird. In stilistisch offenen Clubs dürfte das ebenso einschlagen. Und hoffentlich auch hierzulande für Frische sorgen. Michael Leuffen

Polygonia – Dream Horizons (Dekmantel)
Heute ist es gar nicht mehr so einfach, im Techno noch etwas Neues zu sagen. Gerade deshalb wurde Polygonias Album auf Dekmantel mit Spannung erwartet, ist die Münchnerin Lindsey Wang doch dafür bekannt, dass sie dem Genre mit ihrer eigenen Musikalität frischen Wind einhaucht. Über die letzten Monate ist ihr ein immer promineterer Status als heilsbringende Newcomerin zuteil geworden – dieses Album versteht sich somit als Kür und könnte dem angestauten Hype endlich das zertifizierende Gütesiegel aufsetzen. Doch zunächst zum Inhalt.
Das Album folgt dem namensgebenden Konzept, nämlich einer modularen Erzählweise episodenhaft geschilderter Traumwelten. Klingt so weit komplex, bietet aber einen einfachen Zugang zu allerlei wilden, surrealen Klangwelten, die sich nur minimal miteinander auseinandersetzen müssen; denn Träume kommen nun mal recht irr und wirr daher und müssen vor allem keinem roten Faden folgen. So lässt sich die Album-Dramaturgie zwar anhand rhythmischer und ambienter Phasen ablesen, die Übergänge sind allerdings teils fluide, teils abrupt und geben vielmehr einen kaleidoskopischen Rundumblick ins Innere der Künstlerin preis.
Dargestellt wird das alles mit Polygonias bekannten Mitteln: ihrem präzisen Sounddesign mit Hang zu mikroskopisch kleinen Details und Bewegungsmustern, ihren Myriaden verschiedener stilistischer Einflüsse, Techno, Ambient, Downtempo, Dub, Jungle, Drum’n’Bass, Footwork, Psytrance, Jazz und weitere, und einem Verständnis von Klangräumen, das dem geschulten Ohr einer klassisch ausgebildeten Musikerin geschuldet ist. Dabei finden sich neben den selbst eingespielten Sounds der Multi-Instrumentalistin immer wieder hochprozessierte Fragmente ihrer Stimme wieder, die den Tracks entweder Textur, Rhythmik oder auch organische Elemente verleihen. Die ganze Traumwelt, in welcher konkreten Ausformung auch immer, fühlt sich so stets nach Polygonias eigener Kreation an.
Wenn man auf ältere Veröffentlichungen der Künstlerin blickt, war auch hier bereits ein strenges eigenes Ökosystem zu erkennen, das sich weniger Gedanken um Funktionalität denn Originalität machte. Dream Horizons folgt diesem Trend und setzt auf hyperkomplexe, verschachtelte Strukturen, die dennoch irgendwie das Gefühl von Techno heraufbeschwören, ohne sich dabei dem strengen Minimalismus der Vorlage zu ergeben.
So zieht der schimmernde, pulsierende Opener sofort hinein in Polygonias Klangwelt, bevor ihre Stimme als verzerrtes Rhythmuselement auf „Flakes Flying Upwards”, einem verschrobenen, alienhaften Breakbeat-Track, das gewisse, außerweltliche Extra verleiht. In dem gedrängten Groove von „Soul Reflections” spiegeln sich dagegen ihre Psytrance-Wurzeln, und auf „Twisted Colours” darf sich eine Vielzahl verschiedener Rhythmen abwechseln, die anderswo für eine ganze Footwork-EP gereicht hätten. All das geschieht, während immer wieder Wangs Stimme, Saxofon, Flöte oder Violine zum Einsatz kommen – doch nicht nur als Gag oder Alleinstellungsmerkmal, sondern tatsächlich singuläre Bausteine, die ihren organischen Traumszenarien Essenzielles verleihen und diese atmosphärischen Welten mit Detaildichte und Musikalität bereichern.
So ist Dream Horizons ein zwar an Club-Strukturen angelehntes, aber doch zum mehrmaligen Durchhören einladendes Album, das in seiner assoziativen Natur und vielschichtigen Bauweise immer neue Entdeckungen und Interpretationen bereithält. Und beweist, dass Lindsey Wang dem Hype um ihren Namen nicht nur gerecht, sondern eine ganze Ecke voraus ist. Leopold Hutter
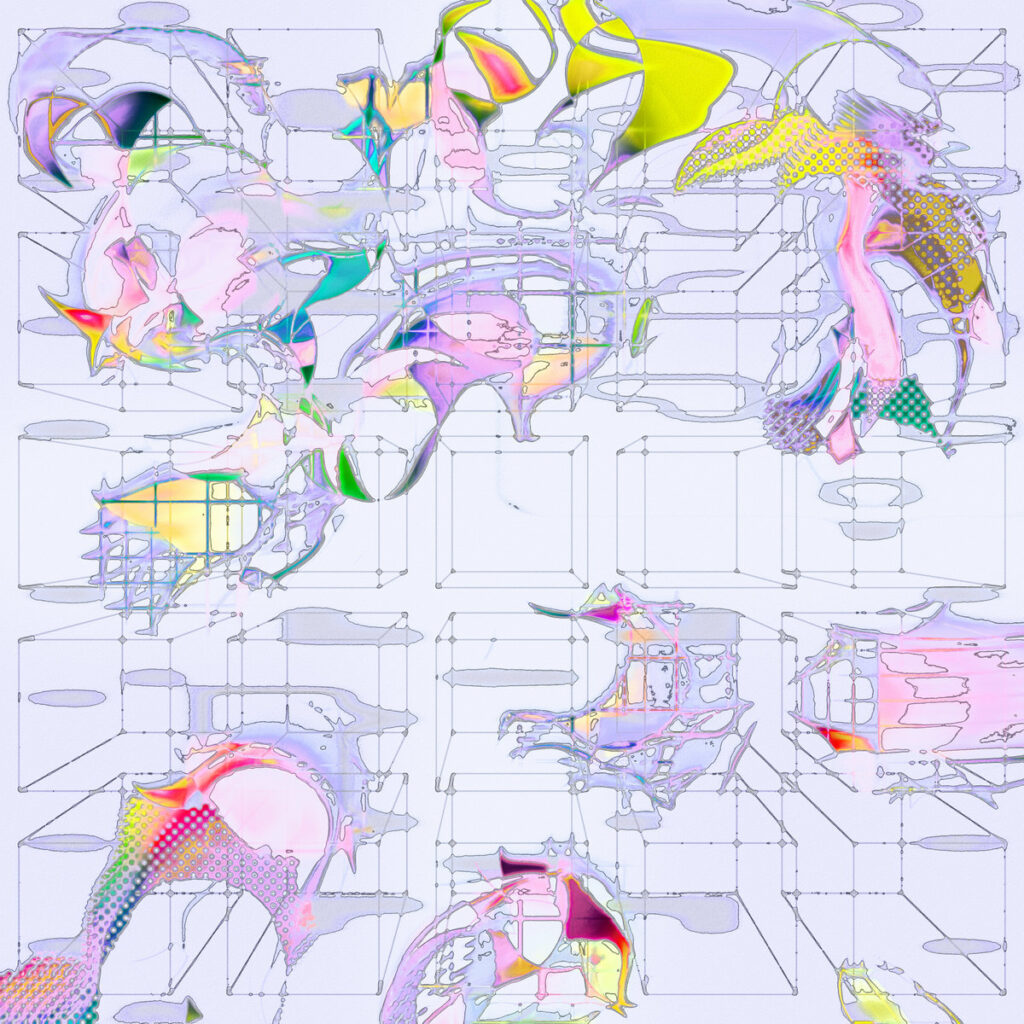
Sandwell District – End Beginnings (The Point Of Departure)
Zeiten rennen, sie kommen und gehen. So ist jeder Tag nicht nur immer wieder ein neuer Anfang, sondern auch der Erste des Rests unseres Lebens. Seit dem tragischen Tod von John Juan Mendez, besser bekannt als Silent Servant, erhalten diese vermeintlichen Banalitäten für Karl O’Connor und David Sumner ein neues Gewicht. Als Regis und Function geleiteten sie über die letzten drei Dekaden hinweg den kalt-hypnotischen Birmingham Sound der Neunziger maßgeblich aus britischen Warehouses in die Bunker und Kraftwerke des industriellen Technos – nicht nur solo, sondern zusammen mit Mendez und Peter Sutton (Female) auch als Kollektiv und Label Sandwell District.
Der zunehmend blutleeren Kommerzialisierung der Clubkultur halten die Vier den dringlichen Impetus eines neuen Selbstverständnisses entgegen, mit dem Techno in diversen Subformen während der Zweitausender seine Adoleszenz erlebt. Das Klangbild ist minimalistisch und maschinell, gleichzeitig dunkel und schlank, von der Situationistischen Internationalen ebenso wie vom Brutalismus inspiriert und wird ab 2006 nach guter alter Chain-Reaction-Manier in kaum identifizierbaren White-Label-12-Inches, später auch EPs verbreitet. Die Dezentralisierung der DJ-Persönlichkeit ist tonangebend – und funktioniert.
Einer matt schimmernden Ästhetik in Sleeve Designs, irrwitzigen Liveshows und postmoderner Bebilderung aus Mendez‘ Feder stellt das Kollektiv dann 2010 das bislang einzige Studioalbum Feed-Forward zur Seite. Wie nur wenige andere Techno-Konstrukte sollte es das Genre über die kommenden Jahre auch dann noch prägen, als die febrilen Audiotransmissionen des Kollektivs auf dem Werkhöhepunkt ein abruptes Ende finden. Wegen jahrelanger, teilweise gewalttätiger Querelen zwischen O’Connor und Sumner und weil dieser 2013 einen Gig in der Londoner fabric verpasst, ist danach Schluss. Vorerst.
Fast forward zum Sommer 2023, als das abermals sofort ausverkaufte und brillant neu gemasterte Reissue des Debüts aufhorchen lässt. Und obwohl die Compilation Where Next? (benannt nach dem von Mendez kuratierten und mittlerweile leider inaktiven Tumblr-Blog des Kollektivs) mit unveröffentlichtem Material sowie gelungenen Remixes des Distrikts in der Mache ist, arbeiten Sumner, O’Connor und Mendez da bereits an neuem Material. Veröffentlichung? Unklar.
Der plötzliche Tod von Projektvermittler Mendez am 18. Januar 2024, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin und Luis Vazquez (The Soft Moon) einer Überdosis erliegt, bringt das Vorhaben dann unverhofft ins Wanken. Wie kann, wie soll dieses Album noch finalisiert werden? Als Kollektiv geboren, als solches fortbestehend, ist es schließlich ein gemeinschaftlicher Kraftakt, der End Beginnings zur Produktionsreife bringt und bei dem die Namen von Seth Horvitz (Rrose), Simon Shreeve (Mønic), Mika Hallbäck (Rivet) oder Sarah Wreath quer über die Credits verteilt sind.
Das Resultat ist über die gesamte Laufzeit hinweg ein Meisterstück zeitgenössischen Technos, das einerseits die turbulente Laufbahn des Kollektivs bis hierhin zusammenfasst, sublim ausformuliert und erweitert. Andererseits aber auch eine Elegie an Silent Servant darstellt, der mit seinen endzeitlichen Grafiken und Produktionsideen stets den ästhetischen Kern von Sandwell District zu definieren wusste. Schon im Opener „Dreaming” scheint sein Geist zwischen perkussiver Beatsequenzierung und schimmernden Reverbs ins Ohr zu diffundieren, während Atemzüge von Melancholie in ihrer Andeutung zerfließen. Der Vorahnung namenloser Bedrohungen werden „Self-Initiate” und „Will You Be Safe?” mit Breakbeat-Bombardements gerecht, die den tribalen Ursprüngen repetitiver Ritualmusik ebenso Tribut zollen wie dem Gefühl von psychosomatischem Kontrollverlust. Beides ist drin, beides scheint präzise in jedem Stem wahrnehmbar.
So strotzen diese rund 50 Minuten vor durchtrainierter Koordinationsfähigkeit, der sich Tanzende bei jeder Dosis gewiss sein sollten. Nachdem die Peaktime gegen Ende von „Restless” angenehm abklingt, manövriert die zweite Hälfte dieses Trips nämlich durch dunstige Mid-Tempo-Gefilde von opaker Schönheit. Klar wird hier: deren Topografie kann nur durch das auditive Erleben auf beiden Ebenen erfasst werden – im Club und unterm Kopfhörer. „Least Travelled” erinnert mit staubigen Saitenstrichen und verzinktem Schlagwerk adäquat an die Glanzzeiten von Downwards und Blackest Ever Black, an Raime aber auch die vibrierende Erotik von Massive Attack. Und während „Citrinitas Acid” sowohl dem säurehaltigen Retrofuturismus von Gerald Donald als auch dem ziselierten Harmoniegefühl eines Speedy J huldigt, pustet „Hidden” die Seelen der Hörenden vorbei an pulsierenden roten Riesen in eine andere Ebene der Wahrnehmung. Hier, am oberen Ende des Kopfkinos, ruht zwischen weißem Rauschen und orchestraler Räumlichkeit „The Silent Servant”, entrückt vom irdischen Streben und Sterben. Sein Ende markiert nun den Beginn von etwas Neuem. Nils Schlechtriemen

SAULT – 10 (Forever Living Originals)
Schon der Name SAULT steht für ein Phänomen: Ein britisches Kollektiv um Produzent Inflo und Sängerin Cleo Sol, das seit 2019 Soul, Gospel, Funk, Disco, House und R’n’B in eine neue, minimalistische Form gießt. Keine Gesichter in der Öffentlichkeit, kaum Interviews, keine PR-Kampagnen und dennoch eine Präsenz, die im heutigen Musikgeschehen kaum zu überhören ist. SAULT füllen eine Lücke, denn ihre Musik wirkt wie ein Ritual zwischen Körper und Geist, sie ist gleichzeitig Groove und Gebet. Im Zentrum steht Cleo Sols Stimme, die tröstet, klagt, erhebt und wie ein Leuchtturm durch die Kompositionen führt, während Inflo den Rahmen so reduziert wie präzise setzt.
10 erschien bereits am diesjährigen Ostersonntag, also vor ziemlich genau vier Monaten. Dass es sich in dieser Zeit zu einem der Alben dieses Sommers mauserte und zum anderen erst seit August auch auf Vinyl vorliegt, sind nur zwei der Gründe, die 10 zum Album des Monats machen. Das Kollektiv knüpft nahtlos an seine Mission der Heilung, Selbstermächtigung und des spirituellen Erwachens an. Die Stücke folgen keiner linearen Dramaturgie, sondern entfalten sich wie eine Reise in Schleifen.
Alles beginnt mit „The Healing” und endet mit „Sounds Of The Healing” – ein Kreisschluss, der den gesamten Weg vom Erkennen des Schmerzes über das Wiederfinden der eigenen Stärke bis hin zum Moment der Heilung musikalisch rahmt. Dabei reduzieren SAULT ihre Songtitel auf Abkürzungen, die wie ein geheimer Code wirken. Ein Rätsel, das sich erst im Hören der Stücke nach und nach entschlüsselt.
Stilistisch ist 10 funkiger und energetischer als manche der Vorgänger, doch stets durchdrungen von einer spirituellen Wärme. Während „Power” ein R’n’B-Statement mit treibendem Groove und klassischem Funk-Spirit ist, schlägt „Know That You Will Survive” leisere Töne an. Es ist basslastig, warm und tröstend, mit Cleo Sols eindringlicher Botschaft der Resilienz, die wie ein Mantra gegen alle Widrigkeiten wirkt. Fast meditativ erscheint „Look Up”, dessen Gitarrenriffs und chorale Gesänge an Gospel anklingen und dem Stück den Charakter eines Soul-Gebets verleihen.
Eines der wesentlichen, immer wieder auftauchenden Motive des Albums ist das Kollektive. Sei es in den lyrischen Botschaften, deren Inhalte über Gefühle, Krisen und Hoffnung erzählen, als auch in den musikalischen Texturen. Titel wie „Higher Than The Rain” oder „We Are Living” verzeichnen orchestrale Schichtungen und deuten mit dieser kollektiven Kraft auf ein gemeinsames Empfinden hin. Es herrscht ein Wir, kein Ich. Und genau darin liegt die Kraft von 10 – sich in etwas Größeres einzubringen.
Und doch bleibt das Ganze nie entrückt. Im Kern ist es Groove, Körpermusik, die sich nicht auflösen will in bloßer Spiritualität, sondern die Beine mitnimmt. Alles bleibt rhythmisch und organisch. 10 wirkt weniger wie ein Album, das man hört, als wie ein Zustand, der von Bewegung gekennzeichnet ist. SAULT legen mit dieser Platte ein Werk vor, das gleichermaßen alt wie neu klingt, intim und kollektiv, und das auch im Kosmos der elektronischen Musikgenres seinen Platz so selbstverständlich wie unverzichtbar behauptet. Denn am Ende geht es um Bewegung, und zwar um die des gemeinsamen und kollektiven. Wuchtige Beats oder Synths braucht es dafür nicht. SAULT gelingt es, all diese Energien in weiche, warme Klangschichten zu übersetzen und dennoch dieselben musikalischen Räume zu öffnen, die sonst von DJs mit ganz anderen Mitteln betreten werden. Wencke Riede

Traxman – Da Mind Of Traxman Vol.3 (Planet Mu)
Was soll man von einem Produzenten halten, der in einem Track dazu auffordert, einen DJ, der nicht die gewünschte Musik spielt, mit einem Ziegelstein zu vermöbeln? Darauf ließe sich antworten: Wenn der Rhythmus stimmt, passt das schon. „Kill Da DJ”, mit dem der Chicagoer Footwork-Veteran Traxman sein Album Da Mind Of Traxman Vol. 3 eröffnet, enthält besagte Forderung, gerappt über einem siliziumtrockenen Beat, aufgekratzt gestrafft, fast wie in den guten alten Tagen des Labels Dance Mania, deftige Lyrics inklusive.
Cornelius Ferguson alias Corky Strong alias Traxman ist seit den Neunzigern im Geschäft, seine ersten Platten erschienen auf besagtem House-Label. Sein Output ist immens, digital bringt er alle paar Monate ein neues Album als Selbstveröffentlichung heraus, darunter neue Musik genauso wie Archivmaterial. Seine Plattenserie Da Mind Of Traxman bei Planet Mu hingegen ist eine rare Angelegenheit. Die ersten beiden Auflagen sind von 2012 und 2014, danach ließ Traxman die Sache mit den Einblicken in seinen Geist über ein Jahrzehnt auf sich beruhen.
Jetzt aber hat er sich darauf besonnen, das Projekt wiederaufleben zu lassen. Und man kann sehr viele Spekulationen darüber anstellen, was die Pause für Ferguson bewirkt hat oder welche Einflüsse seitdem bei ihm hinzugekommen sind, jedenfalls ist das Ergebnis fantastisch. Hatten die ersten beiden Mind-Alben oft etwas Verspieltes, das zur abstrahierten Albernheit tendierte, kommt jetzt eine Konzentration zum Tragen, die teils Rückbesinnung auf seine Anfänge sein mag, vor allem aber wie eine Footwork-Renaissance aus eigener Kraft klingt.
Sei es, dass krassere Zeiten schon mal krassere Musik begünstigen (das jedoch nicht zwingend, die Sparte „Musik als Heilung” ist inzwischen genauso ein festes Marktsegment, das sich als Effekt der Multikrise deuten ließe), sei es, dass Traxman einfach einen Run hat, der sich in diesen 15 Titeln manifestiert: Hier findet sich nichts Unnötiges oder Enttäuschendes. Wobei das mit dem Run in etwas größerem Maßstab zu verstehen ist, schließlich geht die auf dieser Platte versammelte Musik mitunter bis 2005 zurück.
Veraltet oder sonstwie abgestanden wirkt jedoch nichts davon, die Auswahl der Samples sitzt, Traxmans Schnippelarbeit, die er damit leistet, ebenso, desgleichen die Rubbeldidupp-Rhythmen, die er darunterlegt. Bei manchen Footwork- und Juke-Künstlern scheint sich, schon der hohen BPM-Zahl und der peitschend programmierten Drumcomputer wegen, hier und da so etwas wie Wut in ihren Tracks zu kanalisieren. Grund genug gäbe es. Bei Traxman könnte dieser Eindruck in einzelnen Fällen allenfalls entstehen, wenn man selbst gerade nicht bei bester Laune sein sollte. Dass man beim Hören von besagtem „Kill Da DJ” aber ernsthaft Gefahr liefe, Mordgedanken zu entwickeln, verhindert Traxman durch fröhlich überdrehte Tightness. Er könnte ebenso „Kiss The DJ” rappen lassen, bloß dass die Konsonanten da weniger gut fließen würden.
Die Qualität von Da Mind Of Traxman Vol. 3 besteht vor allem darin, dass die Musik nicht Frust, sondern gebündelte Lebensfreude transportiert und bei aller Gegenwärtigkeit und Abgedrehtheit etwas Klassisches hat. Man bekommt an keiner Stelle den Eindruck, dass irgendetwas anders zu sein hätte. Dieser Tanzwahn folgt einer Methode, in die zugleich tonnenweise Liebe mit eingeflossen sein muss. Man muss ihn dafür bedingungslos zurücklieben. Wie heißt es doch im letzten Track, „Day and Night Time”: „I’m gonna love you anyway.” Tim Caspar Boehme

Valentina Magaletti & YPY – Kansai Bruises (AD 93)
Und schon wieder eine: die britisch-italienische Schlagzeugerin, Perkussionistin und Komponistin Valentina Magaletti hört nicht auf. Ständig neue Veröffentlichungen. Ständig neue Kollaborationen. 2024 mit der afro-portugiesischen Produzentin Nídia und dem belgischen Duo Jeugdbrand. Bei der ersten Kooperation traf Kuduro auf Post-Punk und experimentelle Elektronik. Bei der zweiten Elektronik auf Drone. 2025 hat sie mit der französischen Poetin Fanny Chiarello, mit der Magaletti auch das Label und den Verlag Permanent Draft betreibt, bereits das Album Gym Douce veröffentlicht. Dieses bringt freie Improvisation, Elektroakustik und Jazz zusammen, vereint mit Spoken Words von Chiarello. Magalettis Vielseitigkeit manifestiert sich auch in den Bands, in denen sie spielt. Allen voran Holy Tongue und Moin, die beide 2024 ein Album veröffentlichten. Wer recherchiert, wie oft sie mit ihren Bands und anderen Formationen live spielt, fragt sich: Hat sie ein Zuhause? Ja, sie hat eins. Die Musik. Und nicht allein aufgrund ihres Instruments – des Schlagzeugs, das sie tiefgründig beherrscht und mit dem sie fieberhaft Rhythmen, Grooves und neuartige Beat-Nuancen erkundet. Sie schätzt auch den klanglichen Austausch, die Elektrizität, die entsteht, wenn Künstler:innen durch Sound miteinander kommunizieren. Das war früher besonders ihrem Projekt Tomaga anzumerken. Derzeit sind Moin live auf einem besonderen kommunikativen Plateau, einem Zeitfenster, das bei Bands nicht immer ewig hält.
Auch Kansai Bruises, ihr neuestes Album, ist eine Kollaboration. Eingespielt mit dem in Osaka lebenden Produzenten Koshiro Hino alias YPY. Es hat alles, was ihre Kunst auszeichnet. Es ist entdeckend, öffnet Fenster, elektronisch und rhythmisch. Der Japaner ist der perfekte Partner für abenteuerliche Expeditionen. Als Mitglied der experimentellen Band Goat lotet er fesselnd die Grenzen von Jazz, Rock, Minimal und Elektronik aus. Mit dem Cellisten Yuki Nakagawa bildet er Kakuhan, ein Duo, dessen Album Metal Zone beispiellos experimentierend Cellospiel und Elektronik vereint. Zudem betreibt Hino die Labels birdFriend und NAKID, die oft seine eigene Musik präsentieren. Als YPY veröffentlicht er dort regelmäßig. Aber auch auf Labels wie Acido Records, Cav Empt oder EM Records. Solo bewegt sich Hino zwischen Experimental, IDM, Minimal Techno, House, Avantgarde Jazz, Dub oder Hip-Hop. Perfekte Grundlagen für gemeinsames Arbeiten an unbeanspruchter Musik und frischer rhythmischer Dramaturgie.
Der Opener „One Hour Visa” wirbelt mit nervöser Perkussion in ein wendiges Album hinein. Hier afrikanische Grooves, da Lateinamerika. Im Hintergrund zuweilen begeistertes Ächzen von Magaletti, aufgenommen durch das Raummikrofon und evoziert durch Hinos feinfühlige Synthschleifen, die sich mit viel Drama an ihrem Drumming hochziehen. Ruhigere Kompositionen wie „Float” oder „Lantern Lit Run” entführen mit Suspense in kraftvolle Drumzonen, metallische Klangstrukturen und elektronische Sounds. „Pesto” beschließt das alles und bündelt mit hektischem Jazz-Schlagzeug und wirbelnden Synth-Sounds den pulsierenden Charakter dieser Musik perfekt. Ein Album voll subtiler Elektronik und polyrhythmischer Perkussion, deren Austausch eine Schwerelosigkeit erzeugt, die an Ricardo-Villalobos-Tracks wie „Samma” oder „Bredow” erinnert. Es wird spannend, das live zu erleben. Sicher wird es die beiden auf die Bühne ziehen. Jeder ambitionierte Promoter für aktuelle experimentelle Musik muss sich auf sie stürzen. Zu verlockend ist dieses musikalische Dokument zweier zeitgenössischer Künstler, die sich am liebsten auf der Bühne ausdrücken. Wer zufälligerweise am 14. Oktober in London ist, kann Valentina Magaletti & YPY im Ormside Projects erstmals live erleben. Michael Leuffen

Voices From The Lake – II (Spazio Disponibile)
Schimmert unser Zentralgestirn zur Wintersonnenwende fast auf Augenhöhe am Horizont, tauchen Wälder und Gewässer in andere Spektren aus Farben und Reflexionen ab. Kalte Orte wirken nun warm und schicken voraus, dass aus den langen Nächten eine Zeit der Erneuerung folgen wird. Auch in den ersten Produktionen, die Donato Scaramuzzi (Dozzy) und Giuseppe Tillieci (Neel) 2011 gemeinsam für einen Live-Mix unter dem Arbeitstitel Voices From The Lake zusammenschrauben, geraten naturalistische Szenerien, die kosmischen Kreisläufe und wir Menschen in ihnen zu tonangebenden Leitmotiven. Zwar werden erste Rohfassungen bei einer Nachtfahrt in Dozzys Mercedes zwischen den beiden verhandelt und später von Neel auf einem Tape für Dozzys Hochzeit mit der Künstlerin Koto Hirai gebündelt. Doch gebären die aus einer langen Phase von Jams und Aufnahmen entstandenen Tracks unverhofft mehr und mehr Material, genauer gesagt satte 95 Gigabyte: Destilliert in einem Klassiker, der bis heute als wegweisend gilt – nicht nur für vieles, was danach in Europa zwischen Ambient und Techno erscheint. So kommt das Debüt von Voices From The Lake im November 2012 via Prologue, nachdem es ein Jahr zuvor auf dem Labyrinth Festival in Japan seine denkwürdige Uraufführung an einem See im Wald feiert. Innerhalb weniger Wochen schlägt das Album große Wellen und ist noch davor restlos ausverkauft. Erstpressungen wechseln auf Discogs bereits zu Weihnachten 2012 für dreistellige Beträge den Besitzer. Auch abseits internationaler Techno-Feuilletons wird die Produktionsqualität des Duos gefeiert – manch einer spricht sogar vom Selected Ambient Works 85-92 für die Berghain-Generation.
Es folgen nicht weniger beachtete EPs, ein fulminantes Live-Album über Editions Mego und eine Handvoll weiterer Live-Performances, die von seligen Anwesenden als quasi-religiöse Erfahrungen beschrieben werden. Ein Hype im klassischen Sinne ist das damals wie heute aber nicht. Vielmehr sickert das somatische Sounddesign in Klang und Bild seither langsam und beständig durch die europäische Clubsphäre, inspiriert Kunstschaffende ebenso wie ganze Labels – von Astral Industries bis Northern Electronics, von Hypnus bis Mantis. Ambient Techno als Möglichkeit der Entrückung? Als auditiver Holzstich im Stile Flammarions, der aus dem Hier und Jetzt ausbricht, um zu sehen, was dahinter ist, wie es weitergeht? Sicher gab es dazu auch schon in den Jahren zuvor Versuche, etwa von Wolfgang Voigt, Global Communication oder auch Biosphere. Wenn überhaupt wurden aber nur selten archaische Rhythmik, zeitgenössische Klangsynthese und naturalistische Bebilderung zu einem immersiven Hörerlebnis dieser Qualität fusioniert.
13 Jahre später. Auf dem jetzt über ihr eigenes Label Spazio Disponibile veröffentlichten Nachfolger II spielt das Duo erneut mit einer ebenso eigenwilligen wie eingängigen Soundpalette, die neben Field Recordings und Samples aus zwei Dekaden umtriebiger Produktionstätigkeiten auch genussvolle analoge Modulation bemüht, um eine verschlingende Wanderwelle über die Basilarmembran zu senden. Ganz ohne Widerstand, im Fluss wie alles.
So sind es beinahe instrumentell anmutende Produktionen wie das diesige „Lotus Mist” oder das subtil pochende „Montenero”, an denen sich ein untrügliches Gespür für Sequenzierung, das brillante Mastering dieser Platte, aber auch ihr konzeptioneller Rahmen offenbart. Es tröpfelt und plätschert, quellt und strömt, rieselt und prasselt in minutiös realisierter Definition über die gesamte Länge der zehn Tracks. Und dennoch: II geht im Vergleich zum Vorgänger ein, zwei Schritte weiter in Richtung dunkel eingefärbtem Dub Techno, dessen Bassspuren an und für sich schon ein Beleg für die herausragenden Fähigkeiten der beiden Kindheitsfreunde Dozzy und Neel sind. Wie Nebelschwaden über einem Waldsee schweben auch das von Vogelliedern inspirierte „Mono No Koto” oder die an Klaus Schulze gemahnenden Prog-Synths von „Blue Noa” in ritueller Trance durchs Gehörlabyrinth.
In den tieferen Hertz-Ebenen findet das Duo folgerichtig ein fruchtbares Substrat, auf dem diese kunstvoll ziselierten Reverbs und sehnsüchtigen Pads dem Licht entgegen wachsen können – das ist nicht bloß eine blumige Metapher. Neben dem unbestreitbar vorhandenen Grower-Potenzial stellen Wachstum, Wandel, Wiederkehr tatsächlich konstituierende Grundgedanken dieses Albums dar. Vielleicht ist es also beim finalen „Ian” nicht unbedingt eine bessere Welt, die hier mit kindlicher Trommelmaschine und Windspielmelodie im limbischen Kopfkino beschworen wird – zumindest aber eine andere. Nils Schlechtriemen
