Dieser Beitrag ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2024. Alle Artikel findet ihr hier.
Actress – Statik (Smalltown Supersound)
Actress, immer was. Vor allem für Freunde des mikrowellentemperierten Geschmacks, das heißt: Man peitscht sich nicht mehr mit Ledergürteln durch die Manege, hat das aber möglicherweise irgendwann mal getan, damals – mittlerweile geht man es ja ruhiger an. Statik auf Smalltown Supersound stellt uns jedenfalls vor ein Problem, das schon Schrödingers Kater kannte: Es ist und gleichzeitig ist es nicht, in unserem Fall Clubmusik. Dann Ambient. Field Recordings. House und Detroit und alles und nichts. Wie gesagt: immer was, Actress. Christoph Benkeser

Adriaan de Roover – Other Rooms (Dauw)
„Ein wahnsinnig stimmiges Album”, hat der Chef geschrieben. Und wenn der Chef das schreibt, dann stimmt das. Es ist aber auch ganz schwierig, etwas anderes zu sagen. Sofern man sich bei Kunstmusik nicht die Ohren zuhält und demonstrativ Lalala brüllt. Weil dann hörte man keinen Soundtrack für vergangene und kommende und überhaupt alle Videoinstallationen, mit denen man im White Cube so konfrontiert werden könnte. Man würde einfach nichts hören. Und das wäre, da muss man dem Chef nochmal zustimmen, doch schade um Adriaan de Roover und Other Rooms und seine „surreale Kontingenz”. Christoph Benkeser
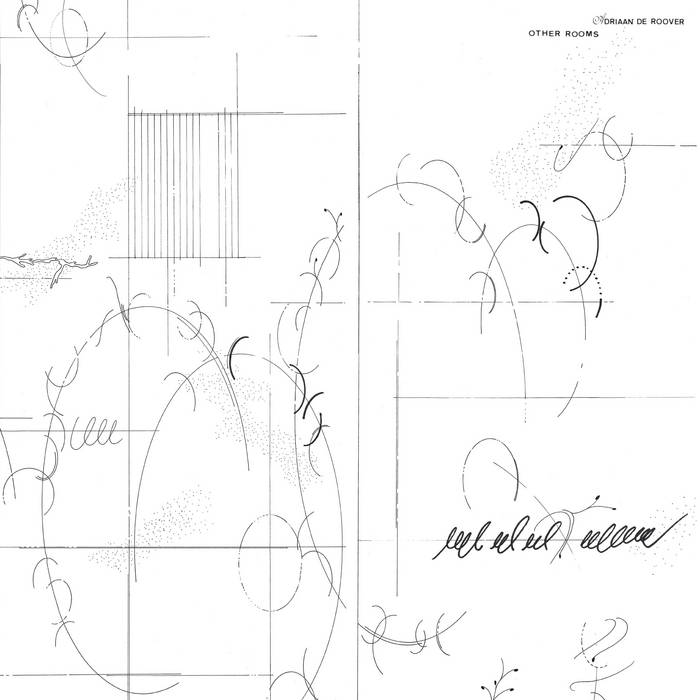
Another Taste – Another Taste (Space Grapes)
Nein, hier hat die Tante beim Aufräumen der Garage nicht zufällig eine Kiste voller unveröffentlichter Disco-Funk-und-Boogie-Bändern aus den Siebzigern gefunden. Hier sind die Siebziger. Oder die Achtziger. Wie auch immer: Another Taste, eine Band aus Rotterdam, hat die Zeitkapselmusik richtig eingestellt. Das Debüt klingt wie der Suchverlauf von jedem DJ, der dort rumkramt, wo obskur draufsteht und die unverkauften Restbestände drinstecken. Wird also eine gute Party, oder? Christoph Benkeser

British Murder Boys – Active Agents and House Boys (Downwards)
Wer hat eigentlich gesagt, dass Techno nicht so sein darf, wie Techno mal war? Niemand. Jedenfalls nicht die, die Techno einfach so machen, wie er mal gewesen war. Früher. In den Neunzigern. Was für eine Zeit. Die British Murder Boys waren da schon dabei. Jeder für sich. Und so hat man es nach all den Jahren irgendwann gesehen und gehört, und dann fängt man von vorne an. Hat ja niemand gesagt, dass Techno nicht so sein darf, wie Techno mal war. Christoph Benkeser

Donato Dozzy – Magda (Spazio Disponibile)
Man kann dazu tanzen, sich hinlegen, die Augen zumachen. Man kann dazu aber auch bei dreihundertachtzig Sachen die Lichthupe setzen und dann alles in Zeitlupe verfolgen. Vorbeiziehen. Verschwimmen. Das geht natürlich nicht so gut mit einem Renault Twingo, dafür setzt man sich lieber in deutsche Ingenieurskatapulte, ab der S-Klasse macht es Freude. Weil da die Geschwindigkeit egal ist. Weil da nur noch die Straße ist. Und die Nacht. Und plötzlich ein Album wie Magda, eine Nummer wie „Santa Cunegonda” die wirklichste Musik ist. Christoph Benkeser
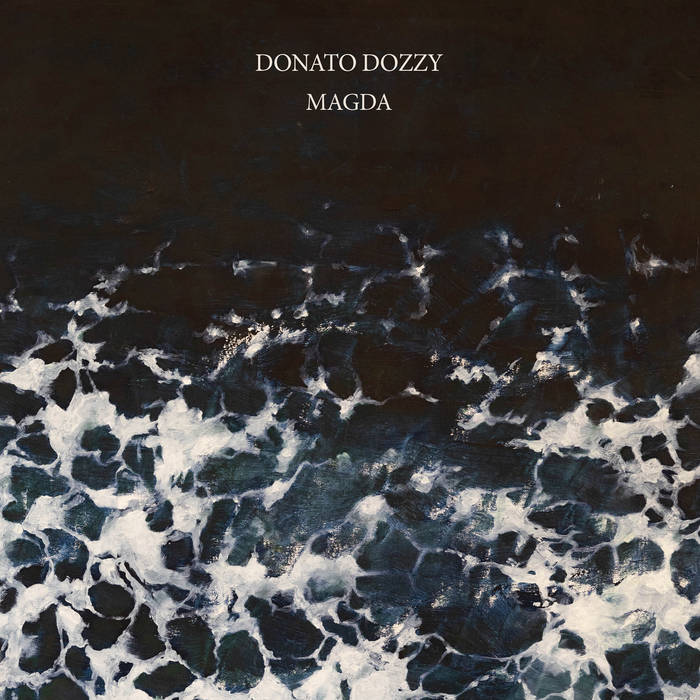
Four Tet – Three (Text)
Irgendwann, lang her: Machen zwei Kumpels Mucke, die die Leute feiern, plötzlich ist Wien wieder wer, in der Lounge, zu der damals alle Chillout Room sagen. Weil nach dem Trip-Hop-Gestolpere ja nur noch Valium als Alternative ansteht. Oder die Güte der Zeit, die vergeht. Und irgendwann alles vergessen macht. Also besser macht. Ja, deshalb hört man dieses Album von Four Tet gerne. Auch wenn man sich beherrschen muss, weil man weiß, dass irgendwo auf dieser Welt gerade ein:e Kunststudent:in die Plattenhülle an die Wand getackert hat. Christoph Benkeser

Heavee – Unleash (Hyperdub)
Ja, es ist ein reichlich angestaubtes Klischee, Alben mit Filmen oder Erzählungen zu vergleichen. Aber, wie es so ist mit Klischees, es gäbe sie wohl kaum, wenn nicht auch etwas dran wäre an ihnen. So oder so, Unleash verdient jedes Gleichsetzen mit großen Epen, ob filmischen oder literarischen. Der aus Chicago stammende und der Footwork-Szene zugeordnete Daryl Bunch Jr. entwickelt auf seinem zweiten Album über 14 Tracks einen bildhaften Flow, der, auch wenn man kein Wort versteht, in eine Geschichte hineinzieht, die jenseits von Inhalt rein emotional und – hey, wir reden hier immer noch von Musik – rein musikalisch funktioniert. Footwork steckt nur ganz grob das Terrain ab; das Herz etlicher Stücke schlägt tatsächlich irgendwo bei 160 BPM. Aber wie es so schön im Werbetext zum Album heißt: „Footwork eats all”. Und dieses „alles” meint alle möglichen Genres. Und eben nicht nur die naheliegenden wie R’n’B, Hip-Hop und Grime. Über Jazz geht es auf Unleash schnell in Richtung IDM, und die Dancefloor-Gene haben natürlich einen hohen Verwandtschaftsgrad zu Detroit-Techno und, na klar, Chicago-House. Mit jedem Track wird die Geschichte verästelter und komplexer, und es wäre absolut kein Wunder, wenn schon irgendwo Graphic-Novelist:innen und Theater- oder Filmregisseur:innen an entsprechenden narrativen Umsetzungen sitzen würden. Mathias Schaffhäuser

L.B. Dub Corp – Saturn To Home (Dekmantel)
Auf sein Projekt L.B. Dub Corp greift der Produzent Luke Slater gern zurück, wenn es nicht so klar definiert zugehen soll. Keine reinen Techno- oder Ambient-Geschichten, und selbst der im Namen geführte Dub muss nicht ständig zugegen sein. Slater bringt ihn auf dieser Platte, dem ersten Album unter diesem Alias seit 2018, dafür gleich ein paarmal ins Spiel.
Auf „Golden Star” kann die Sängerin Alexandra Grübler von Baal & Mortimer die Echos um sie herum für ein wenig Introspektion nutzen, und der unvergleichliche Paul St. Hilaire steuert seinen flüsternd angetoasteten Singsanggesang zu einer retrofuturistischen Dub-House-Nummer bei. Das ist nicht nur einer der Höhepunkte der Platte, sondern zeigt auch, worum es Slater hier wohl geht: Songwriting für den Club. Dass ein Track wie „Krank” von fern an seinen frühen Klassiker „Freek Funk” erinnert, stellt keinen Widerspruch dar, sondern zeigt einfach, dass die Sache offen angelegt ist.
Als Coup hat sich der Techno-Veteran Slater für „You Got Me” den House1-Veteranen Robert Owens hinzugeholt. Die Zusammenkunft enttäuscht nicht, das Ergebnis überzeugt als moderat nostalgische Deep-House-Hymne mit obligatem Klavierpart. Selbstironie gehört zur Inszenierung bei Slater übrigens ebenfalls dazu: Das Cover zeigt sein Konterfei mit den Ringen des titelgebenden Saturn um den Kopf, was bei ihm aussieht wie ein breitkrempiger Hut im Stil der Amische. Tim Caspar Boehme

Loidis – One Day (Incienso)
Ich zähle acht Tracks und, moment, so circa 70 Minuten Laufzeit. Das sind auf anderen Planeten sieben Jahre, was bedeutet: Wir filtern hier gnadenlos aus. Ja, klar. Kommt nicht nur auf die Länge an, niemals. Aber wenn Huerco S. ein Album macht, sich wieder mal Loidis nennt, jedenfalls eine Platte macht, die dem branchenüblichen Aufmerksamkeitsunfall den schönen Finger zeigt. Ja, dann braucht man eigentlich nicht mehr viel zu wissen, außer vielleicht der Tontechniker, der darf schon mal alle Fader gegen Drehregler austauschen. Christoph Benkeser
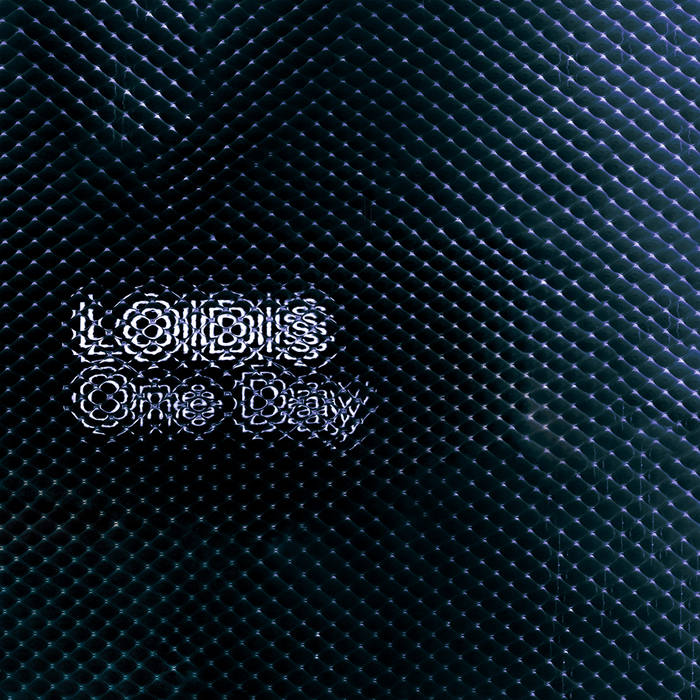
Midland – Fragments Of Us (Graded)
Moment mal, Debütalbum, von Midland? Den gibt es doch länger als Lukas Podolski, also seit immer. Aber ja, es stimmt. Kein Album bis jetzt – hat er sich doch getraut. Den Wunderkindsager erspart sich Midland mit Ende 30 sicherheitshalber. Er legt eher was vor, was die Pressetypen bescheiden einordnen dürfen: „lange gereift”, eine Platte, „die den Club auf die Couch” bringe, jedenfalls „was ganz Eigenes”. Und das ist es bestimmt, dieses Debüt. Aber vor allem eine sehr gute Platte, wenn man auf Intros steht, in denen wichtige Leute reinquatschen. Christoph Benkeser

Monolake – Studio (Imbalance Computer Music)
Die Augen leuchten, der Speichel fließt: Monolake hat wieder mal eine Platte gemacht, die nächste, mitunter seine Beste. Aber das müssen die Kritiker entscheiden. Die wissen dann bestimmt, warum die jetzt ganz anders klingt als, sagen wir, die von 1997. Und warum das Kratzen und Schmirgeln, nun sag’ es schon: der Glitch, na ja, warum der immer noch von Bedeutung sein darf in einer Welt wie der unsrigen, wo doch alles Digitale längst bereinigt, nur noch glänzende Oberfläche ist. Christoph Benkeser
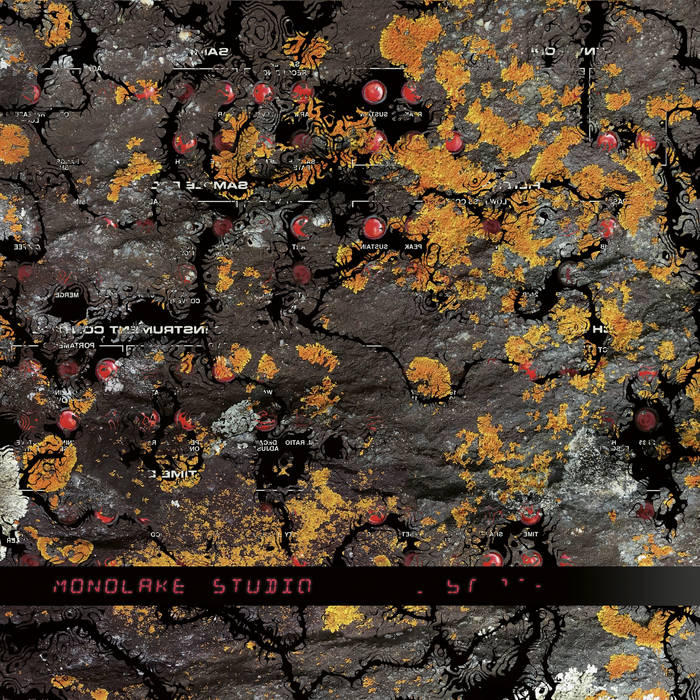
Mount Kimbie – The Sunset Violent (Warp)
15 Jahre nach ihrem Debüt haben sich Mount Kimbie weit von ihren Bass-Music-Wurzeln entfernt. Das einstige Electronica-Duo, bekannt für Crooks & Lovers (2010), hat mit The Sunset Violent einen Sound entwickelt, der nur noch am Rande mit elektronischer Musik zu tun hat. Zwar gibt es Synths und Drummachines, doch die Hauptinstrumente sind nun verzerrte Gitarren und stark verfremdete Stimmen. Diese erzählen von brennenden Küchen oder emotionalem Chaos und schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen psychedelisch wie vertraut wirkt.
Mit 37 Minuten Laufzeit ist das Album kurz und radiotauglich – und würde ohne die Vorgeschichte der Band vielleicht kaum auffallen. Doch die dichte Klanglandschaft hat ihre Reize, etwa im Closer „Empty and Silent”, der mit ambienten Akkorden an alte Zeiten erinnert, bevor Archy Marshall alias King Krule mit tagebuchartigen Texten das Album abschließt. Leopold Hutter

Nídia & Valentina – Estradas (Latency)
Straßen. Tiefschürfender Name, tiefschürfendes Album, das Nídia und Valentina im September vorgelegt haben. Erstere produzierte dafür irrlichternde wie berührende Kuduro-Beats, beziehungsweise: Melodien, zweitere zimmert unter diese wahnhafte Rhythmen, die sich selbst verschlingen, wieder ausspucken und am Ende das vollkommene Glück bescheren. Was das mit Clubkultur zu tun hat? Eine ganze Menge, wenn man nur ein wenig über den Tellerrand hinausblickt. Maximilian Fritz

Paranoid London – Arseholes, Liars and Electronic Pioneers (Paranoid London)
Gerardo Delgado und Quinn Whalley alias Paranoid London versetzen mit dem Opener ihres dritten Albums an das Ende der Party, nein, des Rave-Wochenendes und in eine Zeit, die rückblickend leicht und sorglos erscheinen mag – was natürlich blanke Illusion ist: Primal Screams Bobby Gillespie singt in „People (Ah Yeah)” über einen gefilterten Background, aus dem nicht nur fast alle Höhen eliminiert sind, sondern auch die Drums. Trotzdem groovt der Track, aber der Beat scheint meilenweit entfernt. So wie die Neunziger, aus denen diese Erinnerung herüberweht.
Und tatsächlich nimmt das Album explizit Bezug auf die Prozession von Krisen der letzten Jahre, die man laut Delgado und Whalley am besten mit genialer Musik bewältigt. Gefragt nach ihren persönlichen musikalischen Helden nennen die beiden übrigens den US-Electro-Don Aldo Marin, die britische Produzentin Andrea Parker und die Post-Punk-Instanz Wire – quasi die Zusammenfassung der Eckdaten des Paranoid-London-Universums: Acid, Rave und eine immer mitschwingende augenzwinkernd-mürrische Punk-Attitüde – gerne mit einem guten Schuss Gothic wie in „Love One Self”, der ersten Single-Auskopplung, oder dem sehr gelungenen verhalten-treibenden „The Motion” mit Mutado Pintado am Mikrofon. Im Höhepunkt des Albums kommen alle Parameter perfekt zusammen: „Fields Of Fire” ist ein achtminütiger Trip, der nicht auf Vollgas setzt, sondern auf das häppchenweise Auftürmen von Elementen, die einen immer stärkeren Sog erzeugen und den Track zu einem dekonstruktivistischen Update von „I Feel Love” machen – nur dass Gastsängerin Jennifer Touch nicht körperliche Liebe simulieren muss, sondern die Durchhalteparole unserer Zeit beschwörend wiederholt: „We are not alone”. Dank Paranoid London noch ein bisschen weniger. Mathias Schaffhäuser

Priori – This but More (naff)
Streicher, schwierige Sache. Außer man mag Star Wars oder befindet sich im Orchestergraben. Das heißt, man legt die Tränendrüsen lieber trocken, bevor es zur Überschwemmung kommt. Priori weiß das genau. Er schickt die Geigen gleich mal nach Hause. Die schleichen sich zwar wieder hinten rein und bringen zu allem Überfluss auch noch die Gitarren mit. Aber da hört man gar nicht mehr hin, das Album heißt ja nicht ohne Grund This But More, also: Das Gesülze darf sein, aber da ist noch mehr. Und das ist dann auch richtig gut, Favorit: „Wake” mit James K, bitte, gern! Christoph Benkeser

Shed – The 030-Files (The Final Experiment)
René Pawlowitz ist kein Nostalgiker. Auch wenn sein kontinuierliches Abarbeiten an verschiedenen Peaktime-Momenten des ravigen Dancefloors dies nahelegen könnte. Denn es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man der Vergangenheit unreflektiert nachhängt und sie restauratorisch pflegt oder man Prägendes von damals als Ausgangspunkt für das Morgen nimmt. Shed steht für Letzteres. Ohne hin und wieder den Rückspiegel zu bemühen, würden wir niemals in der Zukunft ankommen.
Die acht 030-Files pulsen purzelnd zwischen zwischen gebreaktem Four-To-The-Floor-Gewitter, verdubbtem, unkenntlich gemachtem Restgeräusch und einer groß angelegten Feldstudie zum Thema, was eigentlich passiert, wenn abstrahierte Hands-in-the-air-Momente durch komplexe Stroboskop-Kaleidoskope wie ein Fiebertraum in der REM-Phase einschlagen. Wer glaubt, dass schmalbandig-gefilterte Chords à la Basic Channel nicht zum Soul drei Floors weiter passen, höre „Let Yourself Go” und schweige still. Die Musik von Shed ist ein Rätsel, für das wir dankbar bleiben müssen. Niemand sonst schafft es, Dringlichkeit in derart elegante Leichtigkeit zu verpacken. Thaddeus Herrmann

Shinichi Atobe – Discipline (DDS)
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kommen so maximale Minimalisten wie Shinichi Atobe immer sehr entgegen. Dank ihnen merkt man erst, wie wenig man tun muss, wenn man es denn halbwegs gescheit tut, also: sich auf die Kernkompetenzen beschränkt, die man entwickelt hat, weil man immer wieder dieselbe Idee wiederholt. Bis dann die nächste kommt und man die von vorhin schon wieder vergessen haben sollte, weil: Sonst fällt es ja irgendwann auf, wie wenig man wirklich tun muss, damit dieser House, ich meine Dub, gescheit klingt. Christoph Benkeser

Stef Mendesidis – Decima (Klockworks)
Ich sage ja zum live gespielten Techno. Der hat eine andere, nun ja, Dringlichkeit, einen anderen Drive, da dreht jemand gerne mal die Tiefen raus und dann wieder rein und yeah! Stef Mendesidis ist so ein Live-Spieler. Schon immer. Und jetzt auf Albumlänge für Klockworks. Da muss man bei der letzten Klubnacht nicht dabeigewesen sein, da weiß man auch so: Hier herrscht der Grundsatz im Groovegesetzbuch (alda, cringe!), hier findet man die Peaktimeperlen (ey!) in der Dancefloormuschel (genug jetzt, wirklich!). Ja, wirklich. Christoph Benkeser

Tim Reaper, Kloke – In Full Effect (Hyperdub)
Man kann tausend Bücher lesen über Nostalgie und so weiter. Und dann kommen diese zwei Herren und fabrizieren eine Platte, Jungle, wie er war und wie er sein soll, und man hört die und man merkt, die tausend Bücher haben nichts gebracht. Weil verstehen, also kapieren, checken, realisieren, kann man dieses Gefühl nur, wenn man es hört. Dafür muss man nicht anno 94 in London gewesen sein, in irgendeinem Warehouse irgendeine Party besucht, die absolute Erfahrung vor einem Lautsprecherturm gemacht haben. Man muss nur Reaper und Kloke zuhören. In here. Und jetzt. Das reicht dann schon. Christoph Benkeser

Vril – Saturn Is A Supercomputer (Omnidisc)
Meint es das Jahr doch noch gut mit uns, vielleicht. Es gibt sich immerhin Mühe auf den letzten Metern. Bestes Beispiel: Vril bringt eine neue, seine sechste Platte raus. Die Begleitumstände ersparen wir uns an der Stelle. Tatsache ist: Das ist Milchstraßenmusik von einem der (nicht übermütig werden!) besten Producer (ja, ok!) in dieser Sache (aha?), die wir Szene nennen (puh). Mit mehr Stimmungen, als der Saturn Monde hat. Was ganz schön viele sind, also wirklich viele sind. Christoph Benkeser
