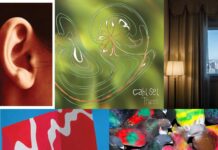Einen besonderen Moment auf dem neuen Album gibt es in der Mitte von „Feel First Live“, wenn plötzlich ein Chor auftaucht. Es fühlt sich an, als ob man durch einen Wald läuft und plötzlich eine Lichtung erreicht. Das hat mich an einen alten Song von Talk Talks erinnert: „I Believe In You“.
Ha, ich weiß genau was du meinst: Ich liebe diesen Song! Er ist einer meiner absoluten Lieblingsstücke. Aber ich hatte ihn nicht im Sinn, als ich „Feel First Live“ schrieb. Eigentlich wollte ich schon mit einem Chor arbeiten, seitdem ich ein Kind bin. Und diesmal hab ich es einfach gemacht: 15 Sänger in mein Studio geholt und einen Tag lang für diese Passage aufgenommen.
Dabei ist dieser Chor am Ende nur etwas länger als zwei Minuten zu hören.
Genau, aber manchmal ist es halt wichtig, großen Aufwand für kleine Details zu betreiben.
Einer der wichtigsten Aspekte deiner Musik ist das Sounddesign. Hört man sich heute deine ersten Platten von Anfang der Nullerjahre an, fällt auf, dass das damals kaum eine Rolle spielte.
Mein erstes Album habe ich aufgenommen als ich 19 oder 20 war. Die Musik, die ich machte, sollte einfach schön klingen, viel mehr habe ich über die Sounds nicht nachgedacht. Das änderte sich erst mit meinem dritten Album Insides. Da habe ich mich wohl auch ein wenig gegen meine eigenen älteren Sachen gewendet und fing an, Krach, Verzerrung und akustische Klänge zu benutzen. Es ging nicht darum, dass etwas perfekt klingt, sondern ich wollte vielmehr eine Unvollkommenheit einfangen und meinen Instinkten folgen. Auf Immunity gehören die Hintergrundgeräusche dann sogar zu meinen liebsten Momenten. (lacht)

Ist das auch auf dem neuen Album der Fall?
Ich hab zumindest ziemlich viele Field Recordings versteckt, Donner etwa oder eine Eule oder Anrufbeantworter-Nachrichten, die mir Freunde hinterlassen haben. Das kann man wirklich wahrnehmen, wenn man an den richtigen Stellen sehr genau hinhört. Ich hab das gemacht, weil es für mich die Musik persönlicher klingen lässt, auch wenn ich der Einzige bin, der weiß, dass diese Sounds da sind und was für eine Bedeutung sie haben.
Gibt es etwas, das du in den vergangenen Jahren hinzugelernt hast?
Ja, das Wichtigste ist vielleicht, dass ich weniger darauf achte, wie meine Musik wahrgenommen wird. Auf früheren Platten von mir spielte das viel stärker eine Rolle. Ich bin stolz darauf, Immunity gemacht zu haben, aber gleichzeitig gab es auch einen Teil von mir, der bei der Arbeit daran dachte, wie die Leute wohl darauf reagieren würden. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich es tanzbarer machen wollte. Das geschah mit voller Integrität, weil ich damals auch viel in Clubs unterwegs war. Aber diesmal bin ich einen Schritt zurück getreten, um etwas Reineres und Persönlicheres zu machen.
Dabei hast du durch Immunity viele neue Hörer gefunden. Gab es da bei der neuen Platte nicht den Wunsch, diese nicht zu vergraulen?
Nein, für mich ist es vielmehr so, dass ich durch den Erfolg von Immunity das Gefühl bekommen hab, machen zu können, was ich will – ein Gefühl von Freiheit. (Zitat).
Bei Immunity hatte ich den Eindruck, dass du einen Techno-Sound aufgegriffen hast, den vor 15 Jahren James Holden etabliert hatte, von dem er sich auf seinen letzten Alben aber immer stärker verabschiedet hat.
Das war schon der Fall. Ich lernte damals auch Nathan Fake kennen, als er noch auf James’ Border Community-Label veröffentlichte. Seine Musik und auch die von James hat mich dann inspiriert, vor allem deren rhythmische Architektur, diese subtilen Zeitverschiebungen in ihren Rhythmen, die die Tracks zum Schwingen bringen. Ich mochte einfach dies Idee von organischem Techno und hatte das Gefühl, dass es darin etwas gab, das noch nicht weiterverfolgt wurde. Er fing etwas an, was dann andere weiterverfolgten. Nicht nur ich, sondern auch Caribou oder Four Tet, als sie anfingen, tanzbarere Musik zu machen.