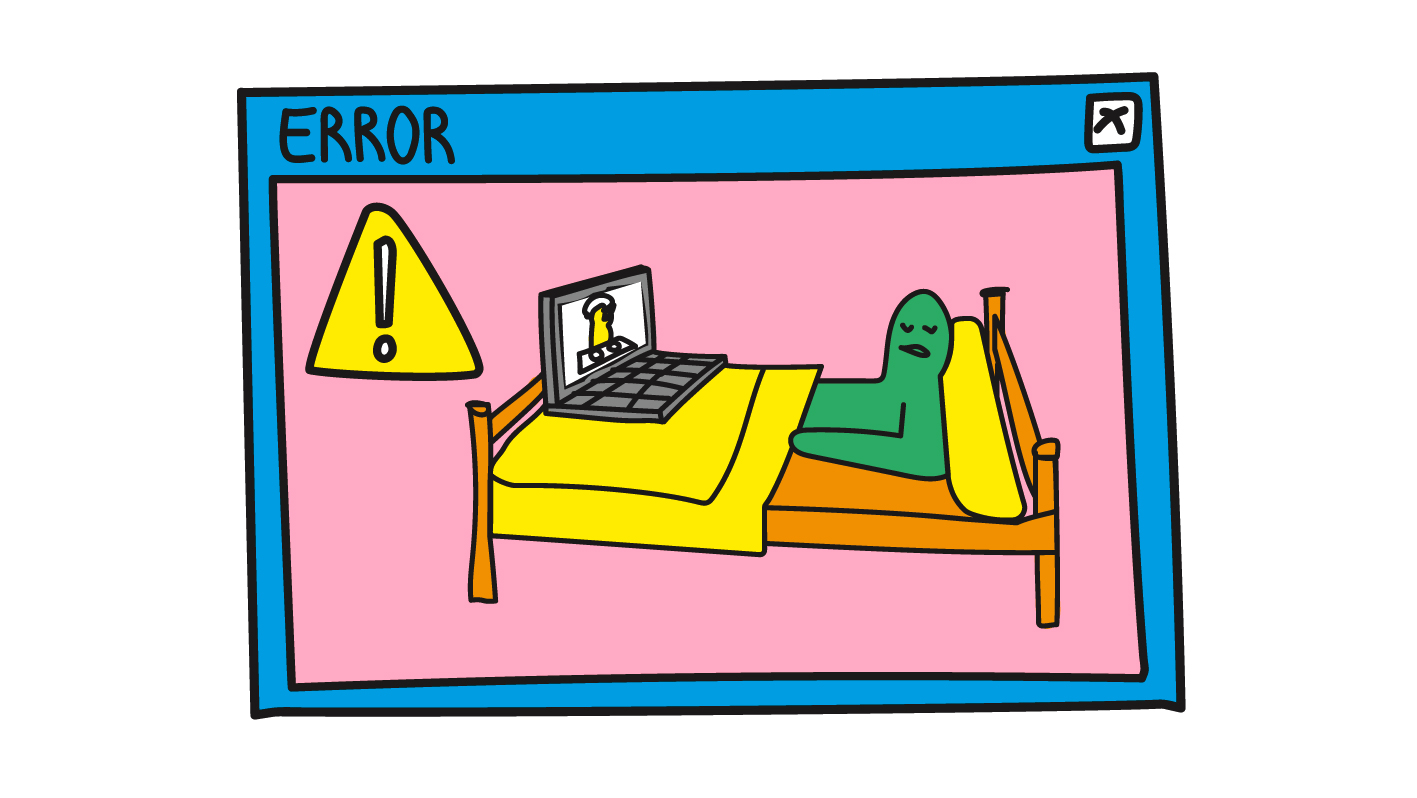Illustration: Dominika Huber
Was haben das Tempelhofer Feld, Lucianos Wohnzimmer und die Dachterrasse von Ellen Allien gemeinsam? Sie sind nicht nur Instagram-taugliche Wandtapeten für Boiler-Room-Ästhetik, sondern Austragungsort für DJ-Sets mit mehr Publikum, als jeder Club dieser Welt fassen könnte. Millionen von Menschen haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie in Europa im Frühjahr 2020 durch Live-Streaming-Events und digitale Konzerte geklickt. 40 Millionen sollen allein bei Videos von United We Stream eingeschaltet haben. Hunderttausende sahen auf Twitch, Facebook oder Instagram zu, wie sich Plattenspieler in Lofts drehen und CDJs aus Schlafzimmern blinken. Während sich nicht abschätzen lässt, wann Clubs wieder die Subwoofer durchpusten können, streamt irgendwo ein DJ zwischen Monstera-Stauden und Räucherstäbchen den ärgsten Baller-Techno seit 1993 durch die digitale Klangschale. Ob Leute tatsächlich „digital feiern” oder welchen Mehrwert man zwischen Beschäftigungstherapie im Lockdown und „Wir-sind-noch-da”-Signalen aus leeren Clubs produziert, bleibt offen. Sind wir trotzdem angekommen in der schönen neuen DJ-Welt des Live-Streamings?
„Die Cluberfahrung ist mehr als nur die Musik”, sagte Watergate-Betreiber Uli Wombacher, der im Juli mit Yes We’re Open so etwas wie eine Clubnacht mit Chatroulette-Feeling probiert hat. Es war ein Versuch, den Fokus vom Frontal-Streaming hin zu einer interaktiveren Form der digitalen Party zu lenken. Menschen sollten sich gegenseitig sehen, miteinander chatten oder zusammen aufs virtuelle Klo gehen können, während DJs auflegen. Eine Strategie, die zwar mehr als eine Promo-Aktion im Überlebenskampf war. Aber kein Ersatz für das Erlebnis vor Ort – weder für Künstler*innen noch für’s Publikum.
Viele der Leute, auf deren Musik manche Top-100-DJs ihre Karriere stützen, sitzen in ihren Bedroom-Studios und versuchen, unter prekären Umständen neue Musik zu produzieren.
Den Versuch, Konzerte oder DJ-Sets in digitale Umgebungen zu verlagern, um die Ferngesellschaft zu versammeln, gab es schon vor Corona. Sie funktionieren für die 1-Prozent-Künstler*innen am oberen Ende der kommerziellen Fahnenstange. Der amerikanische DJ Marshmello ging 2019 im Online-Game Fortnite mit einem virtuellen Avatar vor elf Millionen Spieler*innen ab. Rapper Travis Scott hob diese Marke später auf über 27 Millionen Zuseher*innen. Und bereits 2018 legten DJs wie Solomun und The Blessed Madonna bei virtuellen Raves in Grand Theft Auto auf. Eine Lösung für lokale Szenen, DJs und Clubs findet man in diesen PR-Spektakeln nicht. Aber man versteht, nach welchen Vorbildern Ideen für digitale Clubveranstaltungen funktionieren sollen.
Zwischen Lockdown und Shit-Listen
Um die aktuelle Streaming-Entwicklung zu verstehen, lohnt ein Rückblick: Mitte März, kurz vor Beginn des ersten Lockdowns in Deutschland und während die Zahl der Corona-Infizierten stieg, fuhr die Wirtschaft herunter. Clubs gehörten zu den Ersten, die zusperren mussten. Und sie seien die Letzten, die wieder aufmachen werden, hieß es damals. Seit 13. März prügelten die Bass-Drums in ganz Deutschland nicht mehr aus Funktion-One-Anlagen, Künstler*innen mussten Auftritte absagen, viele Clubs kämpfen seitdem um ihr finanzielles Überleben – und damit neben Promoter*innen auch Bar-, Technik- und Securitypersonal. Über 9000 Jobs hängen allein in Berlin an über 280 Clubs, die 2018 für fast 1,5 Milliarden Euro Umsatz durch Clubtouristen sorgten, so die Clubkultur-Studie der Clubcommission Berlin. Im April beschloss der Berliner Senat eine Clubförderung: 30 Millionen Euro sollten an „mittelgroße Akteure” fließen.
Die Verteilung der Förderung war undurchsichtig, Locations wie das ://about blank bekamen im Vergleich zu Kommerz-Tempeln wie The Pearl nur geringe Summen. Während der Sommermonate feierten Menschen outdoor bei legalen oder illegalen Veranstaltungen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte: Auf die Party müsse man weiterhin verzichten. Shit-Listen über DJs, die durch Europa touren, um in vollen Clubs vor einer Schar an Smartphone-Kameras aufzulegen, tauchten im Netz auf. Ende Oktober stiegen die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder an. Nicht wegen der Clubs – die hatten entweder zu oder Outdoor-Hygienekonzepte –, sondern wegen der Tatsache, dass sich Menschen häufiger in privaten Innenräumen treffen. Deshalb heißt es seit Anfang November: Lockdown 2.0 – Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote und keine Partys.
Live-Streams explodieren
Der erste Lockdown ging mit einer Phase des Neuen, der Überraschung einher. Soziale Treffen fielen weg. Man traf sich zum Corona-Drink auf Zoom, lernte TikTok fürchten, streamte selbst – oder sah anderen dabei zu. Twitch, die größte Live-Streaming-Plattform für alles zwischen Games und Labern, verzeichnete zwischen März und April einen Anstieg der gestreamten Stunden um 50 Prozent. Insgesamt ziehen sich Menschen 1,6 Milliarden Stunden an Streams im Monat rein. Das entspricht 182 Jahren oder der ambitionierten Aufgabe, William Basinskis Album Desintegration Loops über 1 Milliarde Mal auf Repeat zu lauschen. Auch Facebook, Instagram und YouTube klatschten vor lauter Streaming-Freude auf die heißgelaufenen Server. Irgendwann, so scrollte man durch die eigenen Feeds, würden alle jemanden kennen, der den privaten Plattenschrank in einem Live-Stream auf den Kopf stellt.
Das alles passierte im rechtlichen Niemandsland. Als DJ ging es immer darum, sich für die Musik anderer Menschen einzusetzen, indem man sie live spielt. Das macht eine Szene aus, es führt zu Gemeinschaft und ist die Grundlage für das, was wir Clubkultur nennen. Inzwischen streichen manche DJs mehr Kohle an einem Abend ein als ihr Publikum in einem Jahr. Trotzdem hat sich am Konzept nichts verändert: DJs legen Musik von anderen Leuten auf. Aber viele dieser Leute, auf deren Musik manche Top-100-DJs ihre Karriere stützen, sitzen in ihren Bedroom-Studios und versuchen, unter prekären Umständen neue Musik zu produzieren. An diesem Punkt kickt die Krux der Aufmerksamkeitsgesellschaft in die Magengegend wie eine komprimierte 909. Sogenannte Top-DJs starten private Streams und erreichen tausende Follower*innen mit Tracks, die ihnen nicht gehören. Noch im März konnte man auf Twitch, Facebook oder Instagram stundenlang auflegen, ohne dass Streams wegen Copyright-Verletzungen gecancelt worden wären. Es war der Wilde Westen für DJs, die statt Knarren mit USB-Sticks zum Duell um unsere Aufmerksamkeit antraten.
Man vermisst die Energie im Club, die Ekstase auf der Tanzfläche und das bisschen Eskapismus vor einer Welt, die man für ein paar Stunden in dunklen Räumen hinter sich lassen konnte, um im Rausch zu Musik abzugehen, die im Moment existiert.
Mittlerweile bannt Twitch alle DJ-Sets, die unlizenzierte Tracks verwenden. Facebook und Instagram gehen ähnlich vor. Live-Streams von DJ-Sets verschwinden innerhalb weniger Minuten. Die offizielle Plattform United We Stream, die Arte Concert zusammen mit der Berliner Clubcommission zu Beginn des ersten Lockdown ins Leben rief, besteht dafür weiter. Im November sollen täglich Konzerte und DJ-Sets „aus Berlin, Europa und der Welt” gestreamt werden, weil man in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe. In Berlin gab es 73 Live-Übertragungen, über 2000 Künstler*innen traten auf, 570.000 Euro an Spenden gingen an 66 Clubs – pro Tür und Tanzfläche knapp 9.000 Euro. Als „Feuerwehrtopf” bezeichnete Lutz Leichsenring, Sprecher der Berliner Clubcommission, die Summe, die bei vielen Locations nicht mal für die Monatsmiete reicht.
Außerdem ist der Überraschungseffekt im Kunstnebel verpufft. Visuals flackern an den Wänden von Clubs, um von der Leere mit flashigen Schnitten abzulenken. DJs geben sich Mühe, die Stille zu füllen. Auf der Couch gaukelt man sich das Gefühl von Gemeinsamkeit vor, weil tausende Menschen dieselbe Simulation erleben. Allein, vor dem Bildschirm, als Ambient-Noise zum Zocken, Abendessen oder Einpennen. Man weiß, was man bekommt. Und zerstört sich damit die Illusion, etwas zu erleben und an etwas teilzuhaben, das die Aufmerksamkeitsspanne nicht über die Dauer eines Übergangs zerschießt.
Live-Streams beamen uns nicht in die Zukunft
Wer sich an die letzte Clubnacht erinnern kann, ärgert sich wahrscheinlich immer noch, nicht länger geblieben zu sein. Dass Leute feiern, sich den Frust aus der Seele tanzen und auf abgefuckten Toiletten schlechtes Speed ziehen wollen, ist umso verständlicher in einem Jahr, das man am besten mit Prämie verschrottet. Man vermisst die Energie im Club, die Ekstase auf der Tanzfläche und das bisschen Eskapismus vor einer Welt, die man für ein paar Stunden in dunklen Räumen hinter sich lassen konnte, um im Rausch zu Musik abzugehen, die im Moment existiert. Musik, die man zwar über Streams hören, aber nicht durch sie verstehen kann. Oder wer feiert wirklich, wenn Hoe_mies-Hälfte Lúcia Lu ihre Cuts im Hauptabendprogramm in die Finsternis des Clubs loslässt? Wer hält die Leere aus, die von abgefilmten Clubs auf den Bildschirm ausstrahlt? Und wer klappt den Laptop auf, um sich in die desinfizierten Hände zu spucken und selbst einzureden: „Endlich 21 Uhr. Zeit, um ein paar Pillen mit Wodka-Mate runterzuspülen und bis Mitternacht durchs Wohnzimmer zu eiern.”
Niemand. Es gibt keinen Grund, weil alles fehlt, was Clubnächte ausgemacht hat. Die Leute, die Körperlichkeit, die Tränen in den Augen, wenn die Sonne aufgeht. Dass Sender wie Arte auf „leere Kulturstätten” aufmerksam machen, bringt Karma-Punkte fürs nächste Stampfen auf dem Dancefloor und ein paar Tantiemen für Künstler*innen, deren Tracks aus Laptop-Speakern blubbern. Die Bilder schaffen vielleicht Sehnsucht und setzen auf Zeichen der Vergänglichkeit. Übrig bleibt aber nur die Tatsache, dass der Staat sich kaum um Clubs schert und es privaten Initiativen überlässt, einen ganzen Kulturzweig zu retten. Allein: Mit durchschnittlich zehn gespendeten Cents pro Stream wird sich das Clubsterben nicht aufhalten lassen. Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich Gedanken zu machen, wie die Clublandschaft der Zukunft aussehen soll. Auf Ellen Alliens Dachterrasse wird man sie nicht finden.
Dieser Text ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2020. Alle Artikel findet ihr hier.