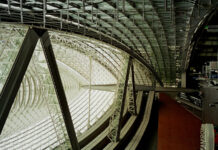Foto: Frank P. Eckert
Wenn gesellschaftliche Normen und kulturelle Übereinkünfte über das, was gut und erstrebenswert ist, nicht mehr mit der individuellen Lebensweise und den Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, übereinstimmen (zum Beispiel, weil der Zugang zu Bildung, Geld oder sozialen Kontakten fehlt), entsteht eine psychologische Lücke, ein Unbehagen, das eventuell zu etwas Neuem, zu Revolution und Disruption führt, wesentlich häufiger allerdings zu ungerichteter Devianz, Depression, Eskapismus oder überbetonter Anpassung. Gemeinsamer Nenner dieser Schmerzen an den Verhältnissen ist eine spezifische Orientierungslosigkeit, Vereinzelung, gesellschaftliche Isolation. Für diese existenzielle Diskrepanz steht in der Soziologie der Begriff der Anomie, um den die Schwedin Sonja Tofik ihr Albumdebüt Anomi (Moloton) gebaut hat. Als dunkler, nach innen gerichteter Gegenpol zu Anarchie und Chaos dürfte Anomie einer der akutesten Zeitbegriffe der Covid-Ära sein und Tofiks Klänge, die zwischen resignativen Synthesizer-Drones, abrupten Industrial-Ausbrüchen und tiefenmelancholischer Schönheit schwingen, die Musik zur Zeit.
Stream: Sonja Tofik – All Errors Are Mine
Das Kopenhagener Label Posh Isolation (ebenfalls ein smarter Ausdruck von und für Anomie) hat einen spannenden, bei manchen Fans durchaus umstrittenen Weg von klassisch harschem Industrial/Power Noise auf Tape durchlaufen, hin zu abstrakten Derivaten von Insta-Clip-kompatiblem Mainstream-Pop und Trap, der durch extreme Melancholie hindurch gegangen, bei leicht unbehaglicher Schönheit angekommen ist. Christian Stadsgaard ist neben Loke Rahbeck (Croatian Amor) Betreiber des Labels und für die interessante Neuausrichtung in den vergangenen paar Jahren definitiv mit verantwortlich. Solo nennt sich Stadsgaard Vanity Productions und führt die Gentrifizierung von Noise via Mainstream und Schwermut in dunkle wie stille Extreme. But All Spiked (Posh Isolation), seine erst zweite LP unter diesem Alias, ist wie die letzten EPs ein Multimediaprojekt, in dem die Bebilderung mit dem Sound in Wechselwirkung tritt. Das Album beweist (als ob dafür ein Beweis nötig wäre), dass Melancholie immer recht hat und elegische Schönheit nicht falsch sein kann, selbst wenn sie sich der Ausdrücke der EDM- oder Instagram-Kultur bedient.
Die Isolation im Studio, allein mit sich selbst und jeder Menge Equipment, mit möglicherweise dunklen Gedanken und hell scheinenden Ideen, ist ein klassischer Weg des Umgangs mit Anomie und dem Gefühl, unfreiwillig den Kontakt zur Welt verloren zu haben, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein – im Guten wie im Schlechten. Dies produktiv machen zu können, ist eine der nützlichsten Fähigkeiten in dieser Zeit. Oh Daydream (My Own Imaginary World), das Debütalbum von Rachel Lyn auf ihrem eigenen, ebenso neuen Label aus Berlin führt dies in roher Perfektion vor. Schon das Cover, mit Lyn in einem leeren Auditorium mit Theaterambiente sitzend oder liegend, gibt die Tonlage vor. Die Experimente mit Stimme und Loops und die zurückgenommenen Modularsynthesizer-Loops wirken wie schnell und genialistisch dahingeworfene, improvisierte Skizzen. Die Tiefenwirkung dieser im besten Sinne minimalistischen Stücke resultiert aus der Entrücktheit, aus der Distanz zur Welt, die sie doch wesentlich inkorporiert hat, im Körper mitbringt. Auch dies die Musik zur Zeit.
Nicht viele Musiker*innen trauen sich zu, ihre einmal etablierte Formsprache wirklich fundamental umzuwerfen und sich als Komponist noch einmal from scratch neu zu erfinden. Die seit langem in Paris lebende japanische Jazzpianistin Tomoko Sauvage hat es gewagt, und dabei eine tatsächlich komplett eigene neue Art des elektroakustischen Ausdrucks gefunden. Statt auf einem Klavier arbeitet sie heute mit wassergefüllten Glasschalen und hydrophonischer Mikrofonierung. Statt Jazz macht sie nun orts- und raumspezifische Klanginstallationen wie Fischgeist (Bohemian Drips), das, improvisiert und aufgenommen in einem ehemaligen Berliner Wasserspeicher, der zu DDR-Zeiten als naturkalter Kühlraum für Fische diente, das submarine Rauschen der zu neuem Leben erweckten Wassertiere wundervoll wie diskret illustriert.
Klangliche Zurückhaltung ist ebenfalls die Domäne des Kanadiers Christopher Bissonnette. Eigentlich Experte für analoge Synthesizer, hat der auf Wayfinding (12k) einen subtilen Soundscape aus Umgebungsgeräuschen und zartestmöglichen losen Harmonien gebaut, der die enge, eingeschlossene Welt der Innenräume der Wohnung öffnet und weit macht. Eine ganz andere Art des ortsspezifischen Ambient, nicht weniger faszinierend als von Tomoko Sauvage.
Unerwartet ebenfalls die Soundtrackarbeit Kamali (SA Recordings) von Henrietta Smith-Rolla. Die Britin, die ansonsten als Afrodeutsche für zupackenden Klopftechno und Detroit-Abstraktionen steht, hat hier die gleichnamige Dokumentation über eine jugendliche Skateboarderin mit zartromantischen Solopiano-Etüden unterlegt, auf die die Größen der klavierigen Neoklassik neidisch sein können.
Wenn dagegen deutsche Schauspieler anfangen, Musik zu machen, kann es schlimm werden. Dass es anders geht, beweist Taumel, Duo des Dark-Hauptdarstellers Jakob Diehl und des Schlagwerkers Sven Pollkötter. Ihr in Jazz-Quartett-Besetzung eingespieltes Debüt There is No Time to Run Away From Here (NoIsolution) bedient sich der Darkjazz- und Postrock-Sprache, die zum Beispiel von Bohren und der Club of Gore perfektioniert wurde, was natürlich grundsätzlich eine sehr gute Idee ist. Taumel agieren vergleichbar düster, aber minimal schneller, also immer noch in hochaufgelöster Ultrazeitlupe. Instrumentell sind sie mit dem dominanten Fender Rhodes und dem Flügelhorn etwas bunter als Bohren, aber bleiben am dunkelsten Ende der Farbpalette des Jazz.