Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Isolation zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im zweiten Teil des Mai-Rückblicks mit Kaitlyn Aurelia Smith, Moodymann, Phillip Sollmann und drei weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.
Exos – Indigo (Figure)

Arnvidur Snorrason alias Exos ist seit der Wiederbelebung seiner Produzenten-Karriere durch Nina Kraviz auf ihrem Label Trip im Jahr 2014 mit internationalen DJ-Gigs und neuen Veröffentlichungen recht umtriebig. Der Icelandic King Of Techno veröffentlichte in den letzten 25 Jahren auf legendären Labels wie Force Inc., Thule Records und Mosaic. Seine Produktionen besitzen oft einen ambienten Reverb-Sound, die Basic Channels Dub-Techno Anfang der 1990er Jahre erfand. Und der wurde von einigen isländischen Techno-Produzenten perfektioniert. So erscheint Indigo auf Figure zu einem Drittel als reines Ambient-Album. Mit Wasserplätschern, Vogelzwitschern und leicht kitschig-dystopischen Cluster-Synth-Flächen wehen heroische Hallraum-Fahnen von Reykjavik bis nach Berlin. Im deutschsprachigen Bildungskanon erahnt die zugedröhnte Tanzfläche bei „Skjolo Naetur” in Form des Wort-Loops, der leicht mit „Walle!” verwechselt werden könnte, Goethes Zauberlehrling. Das könnte womöglich die maximale bürgerlich-metaphysische, deutschsprachige Techno-Verwirrung im Jahr 2020 werden! Exos‘ (ex latine: Ohne Knochen) Soundästhetik rauscht derart luzid-flüssig zwischen Klangsynthese und Transponierung über die runden Beat-Brocken, als erfreuten sich nackte Techno-Hippie-Füße im Einklang mit der Natur auf dem Jahrtausende alten, sanft geformten Steingeröll eines breiten, wild-verspielten und trotzdem flachen Flüssleins. Inmitten der sommerlichen Frische auf einer saftig hellgrünen isländischen Wiese schweben am harmonisierten Klangkörper vereinzelt dicke, weiß strahlende Wolken am kobaltblauen Himmel vorbei. Und in weiter Ferne befreien schneebedeckte Berggipfel die alten Raver-Nasen mit frischer Luft. Die restlichen zwei Drittel des Albums, dessen lateinische und isländische Titel sich an Körper-/Naturthemen abarbeiten, sind teils Maschinen-Funk-artige, teils saftig und voll produzierte Techno-Grooves. Mirko Hecktor
Kaitlyn Aurelia Smith – The Mosaic of Transformation (Ghostly International)

Synthetische Orgeln pfeifen fröhlich, helle Töne perlen wie Quellwasser nach oben. Schon nach den ersten Klängen von Kaitlyn Aurelia Smiths The Mosaic of Transformation ist klar: Dieses Album ist etwas für Romantiker*innen. Die studierte Musikerin Smith hat bei der Produktion ihre Körperbewegungen in Klang umgewandelt. Die Rückumwandlung von Klang in Bewegung, in Tanz, vor dem heimischen Laptop ist schwierig. Nicht nur weil es auf dem kompletten Album keine Beats gibt. Der Versuch, fröhlich perlendes Quellwasser zu tanzen, endet schnell beim Ausdruckstanz. Nicht jedermanns Sache. Genauso wie der ätherische Gesang. Welche Bewegungen die Komponistin zu welchen Klängen veranlasst haben, ist nur schwer nachvollziehbar. Oft wechseln Sequenzen unvermittelt und überraschend, eben wie in einem Mosaik. Doch dieses Bruchstückhafte widerspricht dem Fließenden, das Transformationen innewohnt, und lockert leider nicht die Konformität des Sounds: Das synthetische Fagott klingt wie die synthetische Orgel. Also eine Produktion aus einem Guss, doch das wirkt auf Dauer leider zu eintönig. Martina Dünkelmann
Luke Vibert – Luke Vibert presents… Amen Andrews (Hypercolour)

17 Jahre nachdem sich Luke Vibert sein mittlerweile durchaus legendäres Amen-Andrews-Pseudonym erstmals für eine Fünf-EP-Serie auf Rephlex überstülpte, meldet er sich nun, 2020, in dieser Verkleidung zurück, – von einer EP für FaltyDLs Blueberry Records 2014 abgesehen – das erste Mal seitdem. Seinerzeit verband er als Andrews, der Vorname spielt natürlich auf den stilbildenden Amen-Break der Winstons an, in gekonnt auraler Slapstick-Manier überbordende Breakbeat-Gewitter mit zahllosen geschickt selektierten Schnipsel-Zitaten der Rave-Geschichte und schuf dabei sozusagen die Braindance-Version von Jungle Music. Das passt natürlich hervorragend zum seit einigen Jahren wieder auflebenden Interesse an den Techno-, House- und Breakbeat-Ursprüngen der frühen Neunziger, dem sogenannten Hardcore Continuum, welches natürlich nie zu existieren aufhörte. Und so klingt auf diesem Album denn alles so wie damals, nur vielleicht noch eine Spur überdreht-übertriebener und witziger. Die Monty-Python-Version von Jungle und Drum’n’Bass könnte man sagen. Musik also, die im Ministerium für alberne Gang- beziehungsweise Tanzarten auf Endlosschleife laufen dürfte. Tim Lorenz
Moodymann – Taken Away (KDJ)

Moodymann-Alben kommen Ereignissen im philosophischen Verständnis des Begriffs gleich: Niemand genau hat einen blassen Schimmer, wann genau was wie passieren wird, am Ende aber gehen alle geläutert aus der Sache hervor. Mit Taken Away liefert Kenny Dixon Jr. nicht nur in erstaunlich schneller Nachfolge zum Doppelpack Sinner eine neue LP ab, sondern tut das sogar auf fast konventionelle Art mit Vorabsingle und ordentlicher Ankündigung. Entweder hat eine Detroiter Größe also keine Lust mehr darauf, in der Nachbarschaft ein paar Schallplatten aus dem Kofferraum zu verkaufen, oder aber endlich digitale Distribution verstanden. Wie dem auch sei: Taken Away setzt ab der ersten Sekunde auf alte Kernkompetenzen. Soll heißen: Samples, Samples und noch mehr Samples. Ein gehauchtes „Yeah”, ein „Oh thank you, Jesus!”, ein „Wait a minute” und noch mehr werden in einen Stereo-Monolog geflochten, darunter läuft ein Midtempo-Beat ein und schließlich greift KDJ selbst zum Mikro und gibt die Direktiven aus: Die Lady muss die Handtasche abstellen, den Mantel ausziehen und sich nebenbei noch eine Standpauke anhören, weil der Kerl sich vernachlässigt fühlt. „Do Wrong” ist die machistische Moodymann-Version eines torch songs und nebenbei wohl das komplexeste Stück Musik, das er je geschrieben beziehungsweise collagiert hat. Kurzum: ein ziemlicher Einstieg für sein – je nach Zählweise – 14. Album. Taken Away zeigt sich deutlich Song-betonter, Prince-beeinflusster und enger denn je an Gospel- und Blues-Traditionen verpflichtet, nimmt aber manchmal wie auf dem Titelsong nicht ganz schlüssige Abzweigungen auf den House-Floor. Sowieso ragen die erdigen Vibes und Pop-nahen Töne hervor: „Let Me In” ist wie eine auf Klammerblues gepolte J-Dilla-Produktion mit den überragenden Lyrics einer Sky Covington, die bereits als Demo bekannte Jazz-Nummer „I’m Already Hi” ein verschwitztes Bossa-Nova-Monster und „Just Stay a While” eine sehnsüchtige Electro-Soul-Nummer. Sie alle gehören zu den größten Hits eines Albums, das selbst mit unscheinbaren Grooves zu überzeugen weiß. Der Sommerparty-Staccato-Funk von „Slow Down” oder die verschlafene Deep-House-Nummer „Let Me Show You Love” beispielsweise verweisen aufstrebende Genre-Adept*innen schon vor dem Frühstück zurück auf die Schulbank. Und obwohl oder gerade weil „I Need Another ____” mit seinem unterschwelligen New-Romantic-meets-Hi-NRG-Pathos nicht ganz auf dieses Album zu passen scheint und also definitiv keinen würdigen Abschluss für dieses darstellt, lädt es umso mehr zum Rewind ein. Denn wie beginnt der? Mit einem gehauchten „Yeah”, einem „Oh thank you, Jesus!”, einem „Wait a minute” – der Vorwarnung, dass gleich ein echtes, läuterndes Ereignis bevorsteht. Kristoffer Cornils
Peaking Lights – E S C A P E (Dekmantel)

Indra Dunis und Aaron Coyes sind gern gesehene Besucher im Nirvana – da, wo Frieden ein Resultat aus dem Verlust von Zeit und Ego ist. Mit E S C A P E liefert das Ehe-Duo als Peaking Lights einen betörenden Cocktail aus Electropop, Neo-Psychedelia und Dub, der diesen jenseitigen Freudentaumel nach dem Wahnsinn des gutbürgerlichen Lebens einleiten könnte, entspannt transzendent, hochgradig melodisch und stets von rauschhaften Vocals durchzogen. Eine gewisse Bereitschaft, sich darauf einzulassen, gehört natürlich auch dazu. Den Alltagsmuff der verkorksten elterlichen Erziehung abstreifen können, im denkbar positivsten Sinne gelöst ins Morgen feiern, vielleicht sogar Hedonismus als etwas redefinieren, das eben nicht nur egoistischen Lustgewinn bedeutet, sondern auch Sorge um die kollektive Geistesgesundheit, indem jeder zuerst bei sich und den eigenen kulturell oktroyierten Neurosen beginnt. Manche nennen das Hippie-Kitsch, andere Selbstfindungsprozesse, die nächsten Eskapismus oder inneren Frieden finden. Atmosphärisch liegt das erste Album der Peaking Lights für Dekmantel irgendwo dazwischen. Mittels dynamisch prozessierter Wave-Beats, hypnotischer Tape-Loops sowie lustvoll ausufernder Synth-Kaskaden werden hier strahlend blaue Szenarien in den Himmel gezogen – selten passte ein Cover-Artwork besser zur Musik. Wer sich vom aktuellen Zustand der Welt abkoppeln will, um die eigene Psychohygiene wieder mal auf einen ungezwungen kindlichen Status zu bringen, findet hier jedenfalls über eine Stunde viele Gelegenheiten, die persönlich bevorzugten Entgrenzungs-Erlebnisse zu zelebrieren – egal ob Sport, Sex, Tanzen, Entheogene oder alles auf einmal. Dieses Album passt nonstop, macht mit immer neuen Manifestationen der gleichen Soundästhetik und einer konsistent brillanten Produktion die Dichte herausragender Tracks zum durchgehend heilsamen Erlebnis. Das bisher beste Album dieses Duos und zweifellos Sommermusik Deluxe mit Sahne. Nils Schlechtriemen
Phillip Sollmann – Monophonie (A-Ton/Ostgut Ton)

Phillip Sollmanns Monophonie-Projekt ist das Ergebnis seiner langjährigen Auseinandersetzung mit ungewöhnlichen und historischen Instrumenten und Klangskulpturen – darunter die von Harry Parch, Hermann von Helmholtz und Harry Bertoia. Die freie Stimmung dieser Instrumente entzieht sich den harmonischen Gesetzmäßigkeiten, die die westliche Musik dominieren. So lässt sich die Musik auf Monophonie als anti-logozentrisch und somit politisch verstehen – schon seine frühen Tracks als Efdemin veröffentlichte Sollmann schließlich bei Dial Records, wo man es sich seinerzeit zur Aufgabe gemacht hatte, antifaschistische Inhalte mit dem Dancefloor zu vereinen. Monophonie ist aber nicht nur in dieser Hinsicht Zirkelschluss, schließlich beschäftigte sich Sollmann doch bereits mit Computer- und Konzeptmusik, bevor er seinen ersten Technobeat produzierte und mehr oder weniger aus Versehen zu einem der bekanntesten DJs des Landes avancierte. Aus seinem Unbehagen mit Teilen der Clubkultur hat Sollmann nie eine Hehl gemacht, und schon auf New Atlantis, dem letzten Efdemin-Album, kündigte sich ein Paradigmenwechsel an: Die gerade Bassdrum wurde da mit ritueller Musik aus Asien gekreuzt und die Nähe zur eher avantgardistischen Minimal Music war nicht zu überhören. Minimal Music wäre wohl auch das passendste Etikett für Monophonie: Polyrhythmisch und reduziert liegt die Aufmerksamkeit allein auf den Klängen des eigenwilligen Instrumentariums, und obwohl sein Label zu Recht darauf hinweist, dass die Tracks dieses Albums eine durchaus psychedelische Wirkung entfachen, wirkt Sollmanns Produktion klanglich sehr analytisch und klar. Strenge Musik, die aber bald schon gar nicht mehr streng klingt. Nach der mikrotonalen Studie, die das Album eröffnet, fräst sich Liebe zur Clubmusik nach und nach in die Stücke: Das Ergebnis ist eine akustische Minimal Music, die beinahe tanzbar wird: You can take the boy out of the club, but you can’t take the club out of the boy. Christian Blumberg
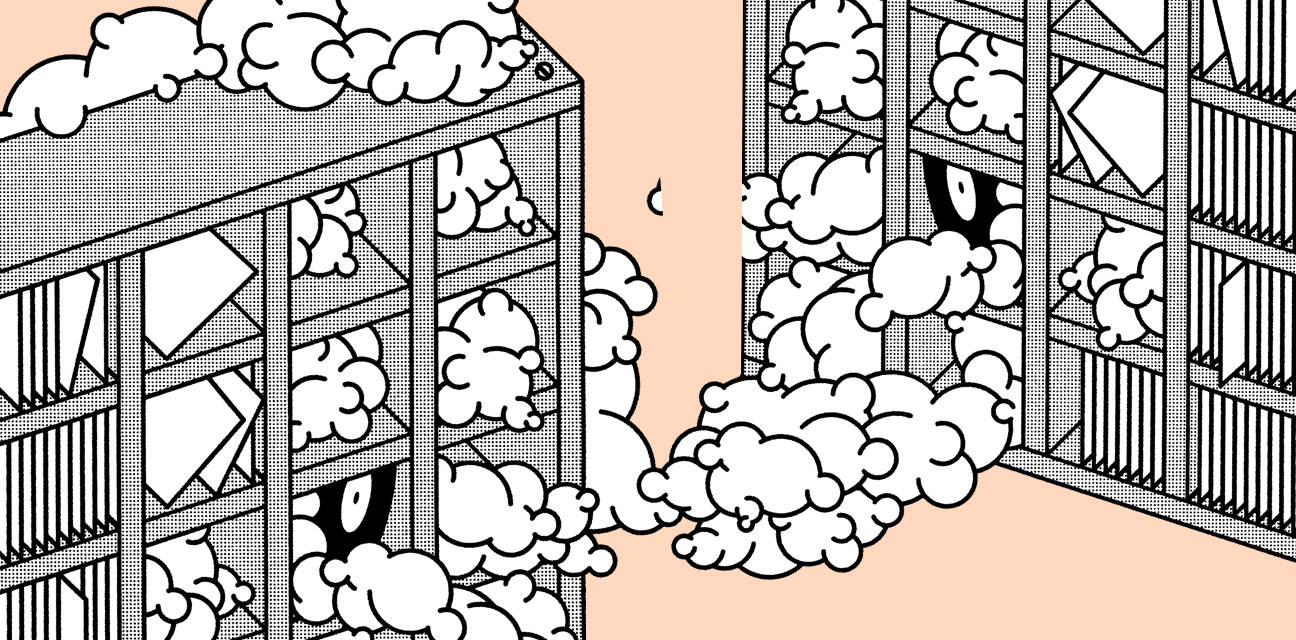

![[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2025/12/Alben2025_klein-218x150.jpg)


