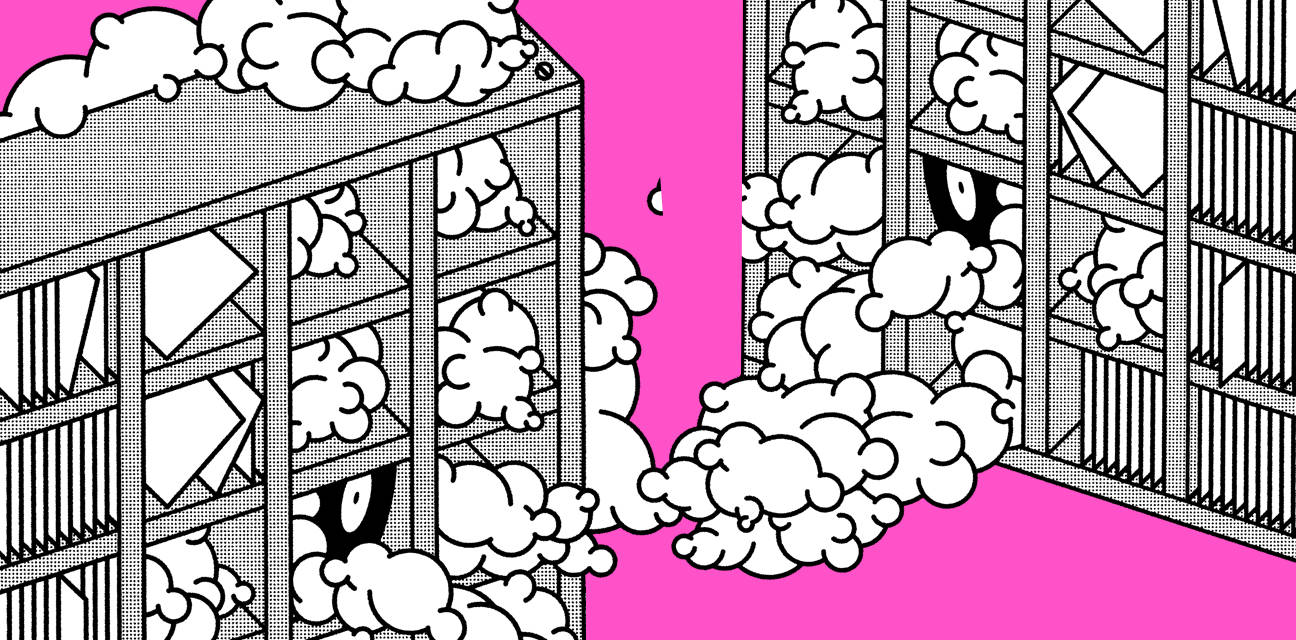Amandra x Mattheis – Lettre Ouverte (Nous’klaer)
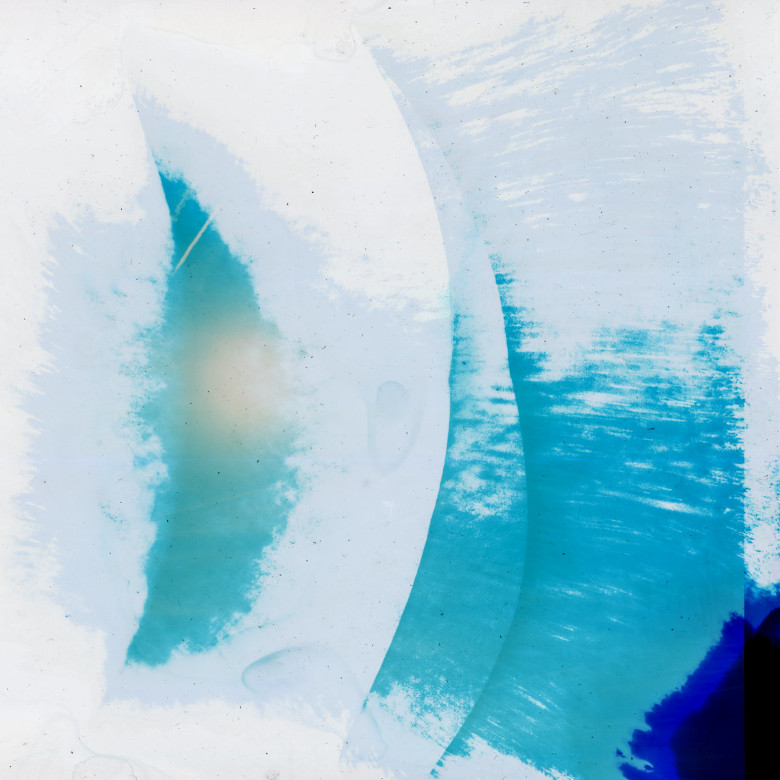
Ich habe ja immer die Befürchtung, wenn es heißt, dass sich zwei Freund*innen – beide bekannt in der Szene – zusammenfinden. Mittlerweile riecht das mehr nach Reichweiten-Bündelung und seltener nach den erhofften künstlerischen Effekten: Kräfte bündeln wie bei den Power Rangers oder Captain Planet.
Umso schöner und überraschender dann so eine Doppel-LP (drunter macht man es dann beim Label Nous’klaer eben nicht), die man schon alleine ob ihres Äußeren besitzen muss. Die zwei türkisen Vinyls, die eingelassene Schrift auf dem Karton, die abstrakten Gestaltung von Ruben Uvez. Hier sieht man förmlich, was drinnen lauert. Ätherische Musik, die Interferenzen feiert.
Da sind einerseits die Mandala-artigen Synthmuster, die Mattheis schon länger für das Rotterdammer Label in die Luft malt. Manchmal abstrakter Electro, dann wiederum Ambient und Impressionismus. Man könnte meinen, da sei gar kein Platz mehr für den Franzosen Amandra Eymery. Doch der schafft es geschickt seine Drum-Settings mit den Synth-Pads zu verweben. Der Stoff, der dabei entsteht, ist aber gar nicht zu fein oder sonderlich dünne, sondern im besten Sinne reißfest.So hält man über Minuten hinweg die Spannung, selbst wenn vergleichsweise wenig passiert. Ob man hier aber noch mit dem Ambient-Begriff arbeiten kann, darf bezweifelt werden. Amandra und Mattheis haben es viel eher geschafft die wahre Essenz des Minimal Technos einzufangen – und so outdated das gerade klingen mag, so genial ist das nicht nur für sonnige Samstagmorgen, sondern womöglich auch im Clubeinsatz. Auf die Bestätigung werden wir aber warten müssen. Lars Fleischmann
Calibre – Feeling Normal (Signature)

Dominick Martin alias Calibre ist ganz sicher kein Durchschnitts-Produzent. Allein schon an der Menge des Outputs gemessen – Feeling Normal ist sein 16. Studioalbum in über zwei Jahrzehnten. Hinzu kommt ein kreativ diversifiziertes Talent, aufgeteilt auf Instrumente, Gesang, freie Kunst und natürlich das Auflegen. Den meisten sollte Calibre dennoch als Drum’n’Bass-Produzent ein Begriff sein, selbst wenn er schon mit anderen Genres gespielt oder gleich ganze Alben, etwa im House-Bereich, veröffentlicht hat. Feeling Normal kommt gut ein Jahr nach Planet Hearth, der introspektiven Ambient-LP, deren melancholische Grundstimmung dem Verlust eines engen Freundes geschuldet war. Jetzt will Calibre aber zurück zum Club und widmet sich erstmals ganz dem 140BPM-Gefilde.
Er wollte ein Album schreiben, „das zwar im Kopf funktioniert, am Ende aber für den schwitzigen Club, den wir derzeit so vermissen, gedacht ist”. 13 Tracks lang und über einen Zeitraum von sieben Jahren entstanden, hat sich Calibre viel Zeit gelassen, das Album nun endlich fertigzustellen. Herausgekommen ist ein Werk, das sich natürlich immer noch nach Drum’n’Bass anhört und typische Qualitäten wie lebendige Basslines, kunstvoll gestaltete Drumloops, emotionale Vocals und frische Ideen in sich vereint. Ohne jemals dick aufzutragen, schafft Calibre es, den Stücken Leben und Gefühl einzuhauchen.
Sein kürzlicher Mix für RA war so etwas wie eine Vorschau auf die LP; dabei spricht es Bände für die Wirkung einiger Tracks, wenn sie jetzt beim zweiten Hören schon das Gefühl eines jahrealten Klassikers auslösen. Die Vocaltracks „Time to Breathe” mit Sängerin Cimone oder auch der Titeltrack mit Calibres eigener Stimme sind beides ultra-deepe, bittersüß inszenierte Stücke, die sofort ins Herz gehen und für Wiederspielwert sorgen.Der Rest fügt sich nahtlos ins Gesamtbild: Calibre bastelt einfach wundervoll inszenierte, gefühlsgeschwängerte, basslastige Grooves, deren Sogkraft sich kaum widerstehen lässt. Highlights sind hier nicht Momente der Eskalation, sondern introspektive Erfahrungen, wenn man sich dem Kopfnicken mit geschlossenen Augen hingibt. Und obwohl wieder 140BPM auf der Platte steht, dürfen auch eingefleischte Drum’n’Bass-Fans unbesorgt zugreifen – es ist schließlich Calibre, bei dem sich auch dieses Tempo ganz klar nach Drum’n’Bass anfühlt. Leopold Hutter
Cristian Vogel – The Rebirth Of Wonky (Endless Process)

Was wäre das für eine Welt, in der man nicht mehr raven darf, aber forever and ever der Mukke von Héctor Oaks lauschen müsste? So gesehen hat Cristian Vogel schon mit dem ersten Track gewonnen. Der Rest ist ein Fest – als wären sich Thomas Körner und DJ Metatron im Nachtbus nach Nirgendwo in die Haare gekommen, um bei der nächsten Pinkelpause draufzukommen, dass man sich nicht an alle Mitglieder des Wu-Tang Clans erinnern muss, um Basic Channel geil zu finden. Man raucht noch eine Kippe, einigt sich darauf, dass beides nichts miteinander zu tun habe und verlobt sich auf der Stelle. Kleiner Spaß am Rande, ne? Wer aber in den letzten 28 Jahren genügend Kristalle über abgefuckten Kloschüsseln gecrusht hat, weiß, dass es im Sound von Vogel Raum für Spielereien gibt. Schließlich hatte der Gute in drei Jahrzehnten zwischen Sound und Subwoofern reichlich Zeit, sich an den Möglichkeiten der elektronischen Klangsynthese abzurackern. Mit The Rebirth Of Wonky rauscht er durch die Schallmauer von 25 Alben. Das sind nur zehn weniger, als Jeff Mills je rausgehauen hat. Und bei Vogel kann man sich wenigstens sicher sein, dass die Hälfte nicht aus leiwanden Demos zusammengeklaut wurde. Hail to the wonky, hail to Cristian Vogel! Christoph Benkeser
Dax Pierson – Nerve Bumps (A Queer Divine Dissatisfaction) (Dark Entries)

Dissatisfaction heißt ja übersetzt: Unzufriedenheit. Unzufrieden kann man mit dieser Platte nicht sein, aber unbefriedigt. Das ist die Last, die einhergeht mit einer außergewöhnlichen Künstler*innen-Vita, denn Dax Pierson ist nicht bloß in Oakland und rund um die Bay Area eine Bekanntheit, sondern seit Jahren weltweit umtriebig. Gerade hier in Deutschland kennt man ihn als Mitglied des The Notwist-Ablegers-Nicht-Ablegers-sondern-Side-Projects 13 & God. Darüber hinaus war er auch eine der treibenden Kräfte des Sextetts Subtle; mit dieser Gruppe erfuhr er seine schönsten, aber auch seinen schlimmsten Moment: 2005 prallte der Tourvan gegen einen Eisbrocken. Pierson verletzte sich das Rückenmark bei dem Autounfall und ist seitdem gelähmt.
Der Albumtitel Nerve Bumps beschreibt dementsprechend auch jene Schwellungen der Nerven, die zur Dysfunktion und zur Lähmung führen. Man merkt der Platte deutlich an, dass sie zerrissen ist zwischen dem Versuch Tanzmusik zu erzeugen, zu der man nicht tanzen braucht oder kann, und jener Frustration, des Wollens-aber-nicht-könnens.Kommen wir trotzdem nochmal zurück zum Anfang: Viele Anlagen sind hier neuartig, es gibt kakophonischen Noise, trippy Ambience und soundtrackhafte Synth-Stücke. Hier treffen Punk, Hip Hop und abstrakter Techno aufeinander. Gerade für ein (offizielles) Debüt natürlich ganz schön viel Ballast, den es zu schultern heißt. Hier bricht Pierson gelegentlich zusammen, die Platte auseinander. Gerade nach dem unerwarteten „Snap” entwickelt sich ein Sog: Das weirde Heavy-Pop-Stück „I Slay the Pain” funktioniert, „Catch” klingt wie Johnny Jewel, geremixt von Legowelt, und der Banger „Keflex” wäre da auch noch. Da ist die LP bei sich und sehr, sehr gut; davor und danach eben nicht so. Lars Fleischmann
DMX Krew – Loose Gears (Hypercolour)

Für Edward Upton gehört Humor definitiv hinein in die Musik. Und als DMX Krew gibt er immer wieder Kostproben seines Witzes, der durchaus albern sein kann, ohne sich zwangsläufig als Hindernis zwischen ihn und sein Publikum zu drängen. Ein Titel wie „Dejected Ambient Twerp”, zu Deutsch in etwa „Deprimierter Ambient-Heini”, von seinem jüngsten Album Loose Gears macht mit seiner traumtänzerischen Tupfenmelodie da schon mal ein im Zweifel selbstironisches Statement. Wobei die Platte insgesamt eine eher zurückgenommene, dafür aber gewohnt nostalgische Angelegenheit ist. Gleich zu Beginn verneigt sich „Unconnected” vor LFO und ihrem Frequencies-Album. An anderer Stelle rappelt aus seinem bevorzugt an Electro orientierten Beat eine Unbefangenheit heraus, die wie Eskapismus erscheinen mag. Was es womöglich auch ist. Doch die Frage ist ja ohnehin, wie Musik ihre Zeit angemessen reflektieren kann. Bei Upton beeindruckt allemal seine Fähigkeit, einfach so weiterzumachen und die Hörer*innen wie nebenbei mit guter Laune anzustecken. Beim aufgekratzt synkopierten Zusammenspiel von Blubberbass und Kreiselmelodie in „Torpedo Tube” jedenfalls fällt es schwer, unbeteiligt zu bleiben. Ob es ein bleibendes Werk oder sowas gewesen sein wird, müssen dann andere entscheiden. Tim Caspar Boehme
INIT – Gravity (Hivern Discs)

Schon lange nicht mehr spontan derart viele Assoziationen beim Hören eines neuen Albums gehabt – in order of appearance: Krautrock, New Wave, Can, Jungle, Stereolab, 60s-Psychothriller-Soundtracks, Dark Wave, Nico & Velvet, Lee & Nancy, Acid-House, Arab-Disco, Joy Division, Minimal Music. Was bei anderen Acts unterm Strich zu völliger Beliebigkeit führen würde, ergibt bei dem Duo INIT ein kleines Wunder, eine in ihrer spezifischen Zusammensetzung neue musikalische Welt – was immer wieder, wenn solch ein seltenes Ereignis denn stattfindet, ein klein wenig aus den Schuhen haut. Im zweiten Stück des Albums beispielsweise verschmelzen Erinnerungen an Can und Jungle zu einem hypnotischen, rhythmischen Konglomerat, über dem melancholisch-unaufgeregt die Stimme von Nadia D’Alo im subtilen Verfremdungsmodus liegt, und deren Zusammenspiel mit den begleitenden Soundschlieren kein Entkommen erlaubt. Diese Musik packt, tuckert nicht beliebig-lieblich dahin, lässt nicht teilnahmslos. Erinnerungen an Sixties-Filmscores werden wach und verstärken diese berührende, stark assoziative und Bilder hervorrufende Wirkung. Wobei Gravity trotz all der genannten Bezüge kein in erster Linie eklektisches Album ist, nicht nur wegen der zeitgenössischen Bezüge zu diversen Electronica-Spielarten oder Singer/Songwriter-Pop bis hin zu Lana Del Rey – letztere besonders ausgeprägt in dem Stück „Half Life”. Der Track „Disk O” beispielsweise lässt jeden historisierenden Bezugsrahmen hinter sich und steht voll im Hier und Jetzt von Acid-House mit arabisch anmutenden Melodie-Elementen. Aber auch auf diesem trendigen Terrain erschaffen Benedikt Frey and Nadia D’Alo eine eigene Atmosphäre, die den Track nicht aus dem Albumgefüge herausfallen lässt. Schon gar nicht, weil in „Jungle”, der nächste Song, das Arabisch-Orientalische wieder aufgreift und mit vorher eingeführten Elementen perfekt fusioniert. Bis zum Ende bleibt Gravity trotz aller stilistischen Verästelungen in sich geschlossen und vor allem auf gleichbleibend hohem Niveau. Erscheint übrigens neben der obligatorischen Download-Darreichungsform auch auf Kassette. Mathias Schaffhäuser
John Tejada – Year of the Living Dead (Kompakt)

Nach seinen zahlreichen, vielbeachteten Alben in den 2000ern scheinen auch die Pandemie und ihre Lockdowns den in Los Angeles lebenden gebürtigen Wiener John Tejada nicht aus der Ruhe gebracht zu haben. Ein weiterer Wurf in seiner bereits ellenlangen Diskografie ist Year of the Living Dead. Wie gewohnt ein genreübergreifender Sound, der es schafft, sämtliche Gefühlsfarben des Regenbogens abzustecken und dabei stets eine grundsätzliche Leichtigkeit zu behalten. Doch der Titel des Albums – selbsterklärend –, ist nicht ohne Grund gewählt. Eine gewisse Melancholie ist zu spüren, sei es auch nur eine ganz leichte wie beim Opener „The Haunting of the Earth” oder „Eidolon”. Sie drückt sich aus im schön dubbigen Sound der Stücke, eingesprenkelten Molltönen hier und da. Es wird stets spielerisch mit dem Material umgegangen, es herrscht kein Stillstand, es geht trotzdem weiter. Muss ja. Das Minimal-Stück „Sheltered” scheint dagegen irgendwie aus der Zeit geraten, könnte gut im Spielemenü von Need for Speed 2 im Hintergrund laufen. Früher hätte man sich gefragt: wer zum Teufel ist eigentlich für diese verdammt geile Musik zuständig? Mit „Abbot of Burton” findet sich eine warme, straighte House-Nummer auf der LP, das coole „Panacea” geht in eine ähnliche Richtung. Am Ende fügt dann „Anchorities” dem Gefüge noch ein paar experimentelle Sounds hinzu, sodass, wie gesagt, alles abgesteckt ist. Passt. Und doch hört man, dass hier eigentlich jemand für den physischen Dancefloor kreiert. Bald dann, wenn die lebenden Toten wieder vom Tode auferstehen und ihre Kadaver zum Tanz bewegen. Lutz Vössing
Laughing Ears – Blood (Infinite Machine)

Der Fenriswolf, der seiner Wildheit wegen seinerzeit an die Kette gelegt wurde, ist vermutlich nicht gerade das, was man ein wohlgeratenes Kind nennen würde, selbst wenn er einen Gott, in dem Fall Loki, zum Vater hat. Wobei auch letzterer nur eingeschränkt zum role model taugt. Betrug, Hauen und Stechen gehören in der nordischen Mythologie zum Alltag, was immerhin für interessante, konfliktreiche Familiengeschichten sorgt. Diesen hat sich die chinesische Produzentin Laughing Ears auf ihrem Debütalbum Blood verschrieben. Musikalisch zeigt sie sich alles andere als archaisch, vielmehr nutzt sie ein Arsenal an perkussiv gehaltenen Breakbeats, die sie auch schon mal ins Kaputt-Trümmerhafte übersteuert, kombiniert mit artifiziellen, digitalen Seltsamkeiten. Sie bevorzugt leicht schleppende Tempi in Anlehnung an Clubgenres wie Trap und hält ihre Rhythmen so bei aller Komplexität gern tanzbar. Dem Thema des Albums gemäß ist die Stimmung ungemütlich-bedrohlich, Beats und atonale Melodien peitschen Ängste auf, kellertiefe Subbässe künden von nahendem Unheil. Da die kinetische Energie des Ganzen jedoch auf repetitive Körperbewegung abzielt, dient Blood weniger zur Akkumulation trübseliger Gedanken als eindeutig zur Flucht nach vorn. Dance the fear away. Tim Caspar Boehme