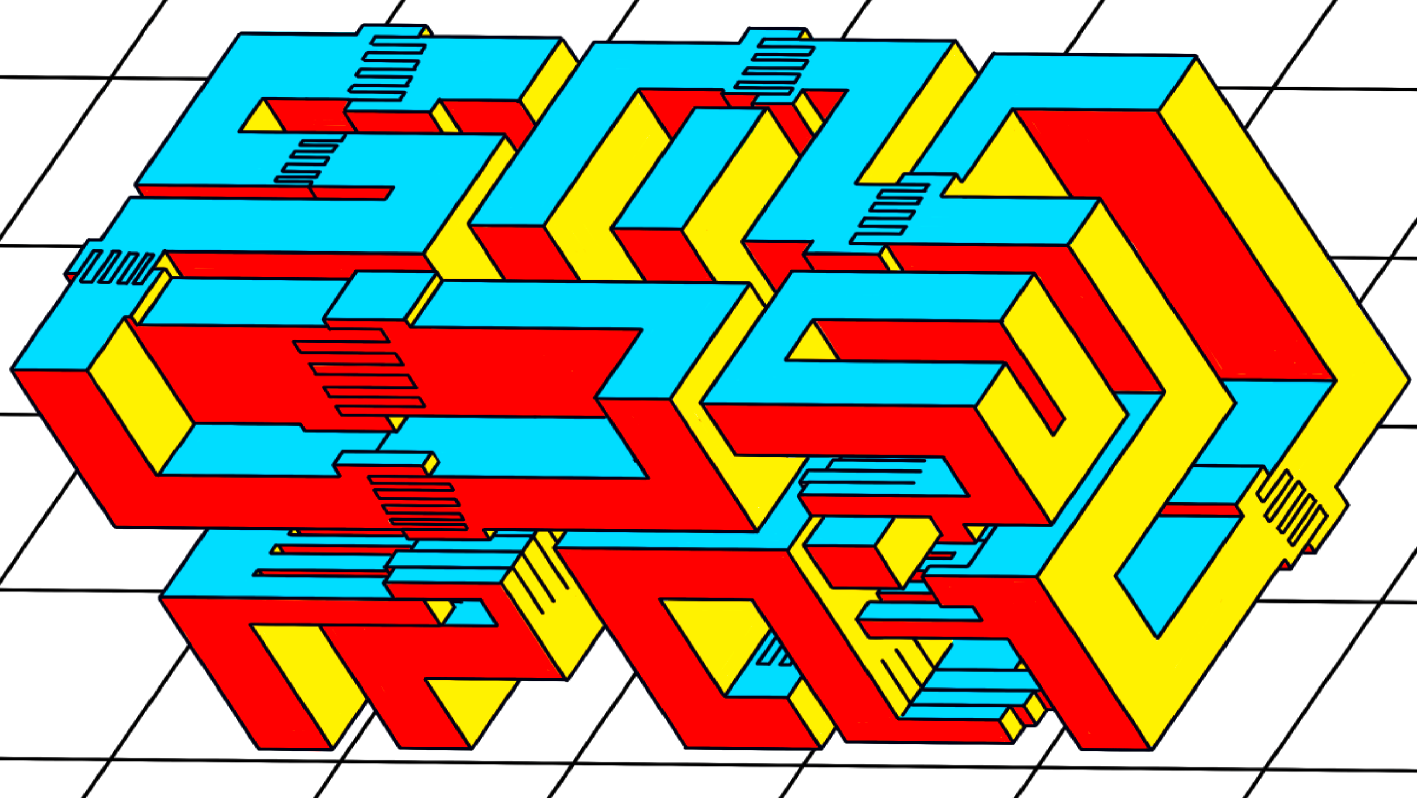Wenn es immer nur eine Schlumpfine geben kann
Andere Menschen in verschiedensten Kontexten als Konkurrent*innen zu betrachten, lernen alle Menschen in unserer kapitalistischen Gesellschaft sehr früh. Judith bemerkt dabei jedoch einen geschlechtsspezifischen Unterschied: „Du machst den Fernseher an und siehst Männer, wie sie im Team Fußball spielen, im Team gewinnen oder im Team zusammen traurig sind. Dann zappst du weiter, Germanys Next Topmodel läuft und eine total hübsche, glattgebügelte Frau sagt in eine Kamera: ‚Es kann nur eine geben.’” Während Jungs oft über ihre körperliche oder geistige Leistung definiert werden und so aufgrund dessen konkurrieren, spüren Mädchen schnell, dass sie von der Gesellschaft nach anderen Kategorien beurteilt werden. So werden sie darauf geprägt, zum Beispiel mit ihrem Aussehen, ihrer Kleidung oder ihrer Bewertung durch Jungs in permanenter Konkurrenz zueinander zu stehen.
„Wir haben nicht gelernt, den weiblichen Nachwuchs nachzuholen, ihm den Weg zu bereiten. Wir haben gelernt, allein die eine Schlumpfine zu sein.”
Im Fall von weiblich sozialisierten Menschen kann die Kombination aus Konkurrenzdenken und ‚Es kann nur eine geben’-Prinzip laut Judiths Beobachtung dazu führen, dass die eine Frau, die als einzige weibliche Künstlerin in einem Line-Up steht oder als einzige weibliche Mitarbeiterin im Leitungsbüro des Clubs sitzt, eigentlich ziemlich zufrieden damit ist, die einzige Frau in der Männerrunde zu sein. „Ich kenn’ auch einige Frauen, von denen ich glaube, dass die es gar nicht so gut finden, dass viele weibliche DJs nachkommen. Die denken: ‚Vielleicht bin ich dann bald weg’, weil es ja immer nur eine geben kann. Wir haben nicht gelernt, den weiblichen Nachwuchs nachzuholen, ihm den Weg zu bereiten. Wir haben gelernt, allein die eine Schlumpfine zu sein. Anstatt dass wir uns daran gewöhnen, dass es mehrere Schlumpfinen in Schlumpfhausen geben kann!”
Unter Männern ist es anders, vermutet Judith: „Männer, die schon Erfolg haben, holen den männlichen Nachwuchs ran. Sie wollen zwar nicht übertrumpft werden, aber der männliche Nachwuchs darf auch erfolgreich sein. Deshalb funktioniert das ja auch so in der Clubbranche: Kumpels buchen Kumpels. Ich würde mir von jeder Frau, die Erfolg hat, wünschen, dass sie andere nachholt und pusht.” Früher war es selten, dass erfolgreiche Frauen andere Frauen förderten oder ihnen Zugänge erleichterten, meint sie. „Aber das hat sich zum Glück geändert!”
Eine Entwicklung, die die Macht patriarchaler Strukturen schwächen kann. Wer keine andere Frau neben sich zulässt oder die Frauen um sich herum als Konkurrenz begreift, kann leichter isoliert und unterdrückt werden. Wer sich hingegen vernetzt, verbündet und unterstützt, kann sich mit vereinter Stärke gegen patriarchale Unterdrückung zur Wehr setzen.
„Es ist manchmal gar nicht so leicht, unter DJ-Kolleginnen nicht neidisch zu sein”
Judith wäre nicht Judith, würde sie bei ihrer ganzen Kritik an den patriarchalen Zuständen nicht auch ihre eigenen sexistischen Denk- und Verhaltensmuster kritisch reflektieren. Das Konkurrenzdenken gegenüber anderen FLINTA* hinter sich zu lassen, ist ihr zum Beispiel noch nicht gelungen – auch heute kommt es noch ab und an vor, dass Judith ein ‚Boah, warum ist die besser als ich?’ durch den Kopf schießt, wenn sie sieht, dass eine ihrer Kolleginnen statt ihr für einen Rave gebucht wurde. Bei männlichen DJs passiert ihr das deutlich seltener.
„Es ist manchmal gar nicht so leicht, unter DJ-Kolleginnen miteinander cool und fair zu sein, nicht neidisch zu sein. Ich will das meinen Kolleginnen ja auch gönnen, aber du wirst durch diese eine Quotenfrau total zur Konkurrenz gemacht, weil es immer nur eine von uns geben kann.” Aus dem Grund sind auch Aussagen wie ‚Du bist meine liebste Frauen-DJ’ – ein Satz, den ein Fan mal wohlmeinend zu Judith sagte – ziemlich kritikwürdig.
Judith ist sich der Problematik ihrer impulsiven Konkurrenzgedanken bewusst – „Eigentlich darf ich so nicht denken.” Der Fehler liegt auch bei Booker*innen, die die Handvoll weiblich gelesener DJs auf ihrem Zettel einzeln auf ihre Line-Up verteilen, kritisiert sie. „Viele sind zu faul, ihren Booking-Job zu machen und mehr Frauen zu recherchieren, die auflegen.”
Lateral Violence: „Das Spiel der Unterdrückung mitspielen”
Die sozial erlernte Überzeugung, Männer seien Frauen überlegen, haben alle Geschlechter tief verinnerlicht, stellt Judith fest. Der Glaube daran sitzt so tief, dass viele ihren internalisierten Sexismus nicht bewusst wahrnehmen – auch diejenigen, die selbst davon betroffen sind. „Das sind zum Beispiel Frauen, die sagen: ‚Ich komm mit Männern besser klar, Frauen sind so zickig und emotional.’” Angeblich weibliche Charakterzüge werden negativ konnotiert, vermeintlich Feminines wird abgewertet. Früher hat Judith selbst Sätze wie diesen gesagt. Stolz darauf ist sie nicht, betont sie. „Aber man ist eben in diesem System groß geworden. Von Männern gemocht zu werden, war eine Überlebensstrategie.”
„Ich habe auch schon über eine Frau gelästert, um einen Typen davon zu überzeugen, dass ich die bessere Wahl bin. Eklig.”
In der Konsequenz versuchen manche Frauen, sich selbst ‚aufzuwerten’, indem sie andere Frauen abwerten. Ein Beispiel: „Wenn eine DJ einer Kollegin vorwirft, hübsch zu sein und deshalb Erfolg zu haben – ‚Die war ja auch Model früher, kein Wunder dass sie überall gebucht wird.’ Da wertest du ja total ab, dass die geil auflegen kann. Und gleichzeitig wertest du doch indirekt auf – ‚Ich kann technisch toll auflegen, nimm mich!’”
Wer sich so verhält, spielt das Spiel der Unterdrückung mit, meint Judith. Hinzu kommt: Die Betreffenden werten durch die sexistische Abwertung anderer im Grunde auch sich selbst ab und tragen damit zu ihrer eigenen Unterdrückung bei. Wenn Angehörige marginalisierter Gruppen aufgrund ihrer Unterdrückung selbst diskriminierende Vorstellungen verinnerlicht haben und diese reproduzieren, wird das als ‚Lateral Violence’ bezeichnet. Judith kennt dieses Phänomen aus eigener Erfahrung: „Ich habe auch schon über eine Frau gelästert, um einen Typen davon zu überzeugen, dass ich die bessere Wahl bin. Eklig. Das würde ich heute nicht mehr machen – weil ich verstanden habe, dass ich das nur gemacht hab, um Anerkennung von einem Mann zu bekommen.”
Anfangs fiel es Judith schwer, solches Verhalten anderen gegenüber einzugestehen – „Wer gibt denn schon gerne zu, dass man scheiße war?” Heute fällt es ihr leichter, offen damit umzugehen. „Ich weiß, dass ich es jetzt viel besser mache. Und früher erkenne, wenn ich schon wieder solche Anzeichen habe.”
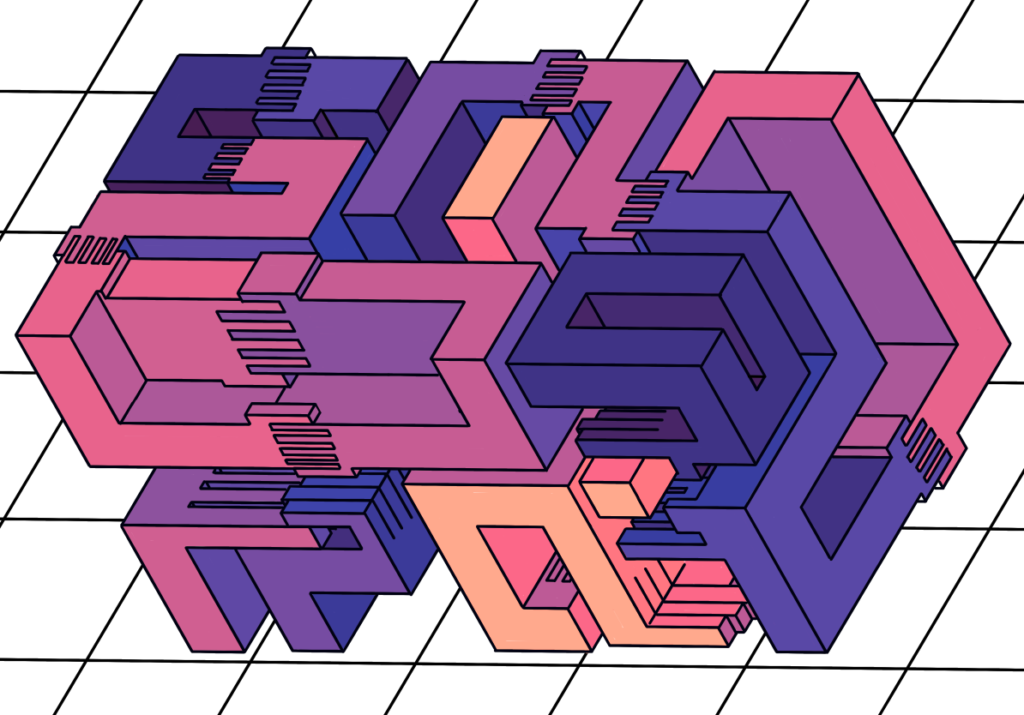
Einfluss im Backstage: Macht schlägt Solidarität
Einflussreiche Stellen im Musikbetrieb – Clubbetreiber*in, Festivalleitung, Booking, Promoter*innen – haben sowohl eine soziale als auch monetäre Machtposition gegenüber den Künstler*innen. Sie entscheiden schließlich, wer gebucht wird und wer nicht – und damit, wer Geld verdient und der eigenen Leidenschaft nachgehen darf. Wenn diese Positionen nicht divers, sondern allein oder überwiegend von weißen cis Männern besetzt sind, wird das sowieso schon vorhandene soziale Machtgefälle noch verstärkt.
„Du springst Leuten zur Seite, die offensichtlich scheiße sind. Aber du brauchst die in diesem Business.”
Judith nennt ein Beispiel: Wenn Kolleginnen sich bei ihr für ihre Aufklärungsarbeit bedanken und sich mit ihr solidarisieren, kann es passieren, dass ihnen im entscheidenden Moment der Mut fehlt, antisexistische Positionen auch gegenüber mächtigen Männern zu vertreten. Für Judith sind solche Situationen besonders schmerzhaft. „Wenn im Backstage ein Gespräch stattfindet, wo es genau darum geht, halten die komplett die Klappe. Oder sagen auch: ‚So schlimm ist es doch nicht, Judith.’ Und du weißt genau, das passiert hier, weil der Veranstalter hier sitzt, der Veranstalter ist da, der Booker hat nächste Woche ein Festival, wo sie spielt. Ich fühle mich in solchen Momenten super im Stich gelassen.”
Doch Judith wirft diesen Kolleginnen nichts vor – schließlich stecken sie ebenso wie sie selbst in den patriarchalen Strukturen fest. „Du springst Leuten zur Seite, die offensichtlich scheiße sind. Aber du brauchst die in diesem Business. Wir wollen ja auch spielen – wir lieben den Job.”
Systemrechtfertigung als Selbstschutz
Es muss nicht immer das Machtgefälle sein, das weiblich gelesene Menschen dazu bringt, die Existenz sexistischer Strukturen zu verneinen. „Mir haben auch Frauen zurückgemeldet, dass sie das alles gar nicht so erleben wie ich.” Wie erklärt sie sich das? „Entweder können sie das gut verdrängen, oder erleben sie es tatsächlich nicht so wie ich. Weil es bei denen ganz anders ankommt, oder weil sie diese Strukturen so verinnerlicht haben. Wie ich ja auch lange Zeit.”
Judiths Vermutung wird von der Theorie der ‚Systemrechtfertigung’ gestützt. Diese besagt im Fall von Sexismus, dass das Leugnen sexistischer Diskriminierung – oder die Behauptung, die Betroffenheit von Sexismus sei das individuelle Problem einzelner – für Frauen eine (unbewusst angewandte) Strategie sei, um sich vor der Erkenntnis zu schützen, durch die sozialen Machtverhältnisse keine vollständige Kontrolle über das eigene Leben zu haben.
Das Problem: Den Betreffenden scheint nicht klar zu sein, dass die eigenen Erfahrungen nicht mit denen anderer identisch sind, nicht sein können. Indem sie Judith ihre gemachten Erfahrungen absprechen – ‚Sicher? Also ich hab das ja noch nie erlebt’ – reproduzieren auch sie die Narrative des Victim-Blaming. Judith wünscht sich, dass andere FLINTA* DJs die Erfahrungen ihrer Kolleg*innen anerkennen, auch, wenn sie nicht die gleichen gemacht haben. „Wir haben alle ein unterschiedliches Tempo und unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Bei einigen braucht es diese Initialzündung, selbst etwas zu erleben. Andere nehmen es trotzdem wahr, auch wenn sie es nicht selbst erlebt haben.”
Solidarität bringt uns aus dem Patriarchat
Ob die fehlende Solidarität von Frauen und weiblich gelesenen Menschen mehr wehtut als fehlende Solidarität von Männern? „Ja, für mich schon”, sagt Judith entschieden. Die Frage erinnert sie an eine schmerzhafte Situation: Nachdem sie einen sexuellen Übergriff erlebt hatte, hatte sie sich an eine Freundin gewandt, um von ihr Unterstützung zu bekommen. Doch die Freundin wollte Judith schlicht nicht glauben, wie schrecklich diese Gewalterfahrung für sie war, sondern beteuerte, dass es ja ‚nicht so schlimm’ sei. Vor diesem Hintergrund sagt Judith: „Ich wünsche mir von FLINTA*, genau wie von Männern, dass mir meine Erfahrungen nicht abgesprochen werden. Dass anerkannt wird, dass ich das so erlebt hab’. Und dass wir uns supporten, anstatt zu Konkurrentinnen zu werden, wie es uns beigebracht wird.”
„Ich hab so tolle FLINTA* kennengelernt. Die hätte ich doch alle verpasst, wenn ich weiter dieses doofe Spiel mitspiele und nur bestehen kann, wenn ich andere Frauen aussteche.”
Dass FLINTA* sich vernetzen, unterstützen und miteinander solidarisieren, ist Judith ein wichtiges Anliegen – gemeinsam kämpft es sich leichter als allein. „Ich hab’ so tolle FLINTA* kennengelernt. Die hätte ich doch alle verpasst, wenn ich weiter dieses doofe Spiel mitspiele und nur bestehen kann, wenn ich andere Frauen aussteche.” Ein stabiles Netzwerk zu haben, empowert und schafft ein Gefühl der Sicherheit. „Wenn ich falle, falle ich nicht ins Nichts, sondern ich werde aufgefangen. Und wenn eine von euch fällt, bin ich auch da und fange auf. Das finde ich ganz wichtig – dass man auch mal scheitern und schwach sein darf.”
Es braucht also eine übergreifende Solidarität – die feministische Solidarität unter FLINTA* und die profeministische Solidarität von cis Männern mit FLINTA*. Manche sehen diese Solidarität sogar als das entscheidende Mittel, um das Patriarchat zu überwinden. So schlussfolgert Journalistin Laura Freisberg in einem Kommentar zu diesem Thema: „Es sind die Beziehungen zwischen Feminist*innen, die uns aus der patriarchalen Matrix herausführen.”
Zwischen Stolz und Erschöpfung: Wie ihr Kampf für Gleichstellung Judith verändert hat
Bei aller Kritik an den gegenwärtigen Zuständen der Clubszene im Speziellen und der Musikbranche im Allgemeinen beobachtet Judith auch positive Entwicklungen: Inzwischen stehen mehr FLINTA* an DJ-Pulten; Line-Ups sind generell etwas diverser geworden als noch vor fünf, sechs Jahren. Doch auch hier gibt es ein Aber: „Ich bin so unzufrieden mit dem Tempo und wie das passiert ist. Es ist nämlich passiert, weil wir uns das krass eingefordert und dafür ganz doll gekämpft haben.”
Wie hat dieser Kampf sie selbst, ihre Persönlichkeit, ihr Selbstbild verändert? „Ich bin nicht weniger selbstbewusst, aber ich bin auch nicht mehr selbstbewusst geworden. Man kriegt schon echt viel ab, und, wie gesagt, in schwachen Momenten glaube ich das. Aber ich traue mich, mehr zu sagen, weil ich weiß, dass das richtig ist.”
Eigentlich will sie gar nicht so ein wütender Mensch sein, wie sie gerade ist, sagt sie – doch eine andere Wahl bleibt ihr nicht. „Dann bin ich aber auch stolz. Nicht nur auf mich, sondern auch auf einige Menschen in meinem Umfeld, die gemeinsam mit mir diesen Prozess durchmachen oder durchgemacht haben. Ich bin auch gerade nur so mutig, weil ich mittlerweile weiß, dass einige hinter mir stehen. Aber ich glaube, ich war auch noch nie so am Boden wie jetzt. Ich kann bald echt nicht mehr, ich bin wirklich ausgebrannt. Es ist ganz komisch – früher war ich psychisch im gesunden Mittelfeld, und jetzt geht die Klaviatur ganz weit auseinander.”
„Es geht nicht um mich, es geht um das Ganze. Um Clubkultur, Gleichberechtigung unter uns und in allen anderen Lebensbereichen, für alle diskriminierten Gruppen.”
Zum Zeitpunkt des Gesprächs, im Frühling 2021, geht es Judith auch physisch schlecht. Ihr Körper signalisiert ihr, dass er dringend eine Pause braucht. „Ich hab’ Erschöpfungserscheinungen, als hätte ich eine Weltreise hinter mir – aber nicht, weil ich ein Wochenende lang durch die Region fahre und Gigs spiele.” Emotionale Unterstützung bekommt Judith durch ihre Netzwerke, Freund*innen und Familienmitglieder. Diese sorgen sich inzwischen um Judiths Gesundheitszustand. „Tatsächlich bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich mir wirklich Beratung suche, damit ich das alles nicht immer nur in meinem Umfeld ablade.”
Unabhängig von der Unterstützung einer Beratungsstelle versucht Judith, selbst Strategien zu entwickeln, um mit der Belastung umzugehen. Dazu gehört der Austausch mit anderen Betroffenen und Unterstützer*innen. Ein Satz, den sie sich immer wieder selbst sagt: „Es geht nicht um mich, es geht um das Ganze. Um Clubkultur, Gleichberechtigung unter uns und in allen anderen Lebensbereichen, für alle diskriminierten Gruppen.” Sich diese Botschaft in verzweifelten Momenten zu vergegenwärtigen, hilft ihr, solche Phasen durchzustehen.
Auf die Frage, was sie der 20-jährigen Judith, ihrem jüngeren Ich, gern sagen würde, antwortet sie: „Oh. Das ist eine schmerzhafte Frage. Ich weine wirklich um viele Jahre, die mir verloren gegangen sind. In denen mir eingeredet wurde, dass ich bestimmte Sachen nicht kann und mein Platz da nicht ist. Aber ich frage mich auch, ob ich vor 15 Jahren überhaupt stabil genug gewesen wäre, dieses Haifischbecken auszuhalten. Deshalb würde ich sagen: ‚Du kannst es doch. Oder: Probier’ es aus und lass’ dir nicht reinquatschen, dass es nichts für dich ist. Und wenn du es wirklich nicht kannst, ist es auch okay.’”
Das Patriarchat hat Hausverbot – Blick in eine Utopie
Seit dem Gespräch im Frühling ist bei Judith viel passiert: „Ich hab’ jetzt eine Agentur, die sich voll viel kümmert, ich hab öfter Fahrer*innen, ich hab’ Hotels.” Die Agentur ermöglicht ihr, sicher von A nach B zu reisen. So kommt Judith entspannt bei ihren Gigs an und kann sich auf ihre Arbeit konzentrieren, statt eventuell verstörende Erlebnisse auf der Anreise verarbeiten zu müssen. „Ich hab’ durchgehalten, bis ich dahin gekommen bin – dass ich sicher zum Gig komme, einen vernünftigen Schlafplatz hab, wo ich keinen Übergriff erleben kann wie im WG-Wohnzimmer vom Kumpel vom Booker. Newcomer*innen haben das nicht.”
Judiths individuelle Arbeitssituation hat sich durch die Agentur zwar erheblich verbessert, doch die strukturelle Diskriminierung von FLINTA* bleibt unverändert bestehen. Also wird sie sich weiter dafür einsetzen, ihrer Utopie näherzukommen. „Natürlich hab’ ich die romantische Vorstellung, dass wir mal viel mehr Bookerinnen haben, mehr Technikleiterinnen, irgendwann auch mehr Clubbesitzerinnen, Festivalmacherinnen. Ich habe wirklich Bock, in diversen Line-Ups zu stehen. Ich habe Bock auf diversen Nachwuchs, weil die ganz tollen Input geben und uns inspirieren. Ich hab’ richtig Bock, auf ein Festival zu fahren und mich da sicher und verstanden zu fühlen und ernstgenommen zu werden – als Gast, als DJ, als Veranstalterin, als you name it. Und zu wissen, dass auch die Gäste, die nicht cis-männlich und weiß sind, sich da fallen lassen können.”
Damit das eines Tages Wirklichkeit wird, muss die Auseinandersetzung mit Rassismus und Sexismus auch über den Corona-Veranstaltungsleerlauf hinausgehen, appelliert Judith. Unabhängig von pandemischer Lethargie oder hektischem Veranstaltungstrubel müssen sich Crews, Clubs, andere clubkulturelle Akteur*innen – letztlich wir alle – kontinuierlich mit Macht- und Diskriminierungsmechanismen beschäftigen, eigene problematische Strukturen reflektieren und Präventionsmaßnahmen erarbeiten. Nur so kann es einen Fortschritt in der Clubkultur geben, nur so können wir irgendwann Vielfalt, Gleichstellung und Gerechtigkeit erreichen.
Trotz aller Versuche, sie zum Schweigen zu bringen, hat sich Judith ihren Optimismus und Kampfgeist bewahrt – zu verstummen, ist für sie keine Option. „Die letzten Jahre haben wir ganz schön viel weggeguckt und ganz schön viel geschwiegen. Aber das hört jetzt auf. Wir werden jetzt lauter. Und ich glaube nicht, dass es wieder leise wird.”
Transparenzhinweis: Judith und GROOVE-Autorin Lea Schröder sind Mitglieder des Leipziger Netzwerks fem*vak.