Gene On Earth – Time On The Vine (Limousine Dream)

Ja ist es denn zu schön, um wahr zu sein? Mit seinem zweiten Album nach dem 2019er Debüt Local Fuzz legt Gene On Earth so etwas wie den perfekten Deep-House-Blueprint vor. Alles sehr geschmackssicher, geschmeidig, ein scheinbar lang gelagertes Tröpfchen edler Natur, das so fein wie fühlig ins geneigte Ohr fließt, wohltemperiert. Das beginnt mit dem entspannten Breakbeat des geheimnisvoll blubbernden Openers „Snooze Operator”, ja, auch Humor ist vorhanden, und steigert sich über drei perfekt produzierte Titel in den House-Himmel. Hier hat jemand seine Hausaufgaben gemacht, kennt die Formeln und weiß gewandt, mit ihnen umzugehen, ohne dass die Musik verstaubt oder durchgepaust klingt. Nach „Studio Dobra”, einem kurzen Downtempo-Intermezzo, geht’s dann wieder nach vorn und Gene On Earth vereint mühelos Purist*innen wie Laufpublikum auf dem Dancefloor, wo’s nun auch mal bleept und angejazzte Jungle-Rhythmen wirrlig-träumerische Melodie-Bögen umrahmen, moderat temperiert. Der abgehangene Valium-Funk von „Aston Martinez”, ja, auch in Popkultur ist er bewandert, beendet das Album dann adäquat.
Alles super so weit. Oder? Schwer zu sagen, denn auch wenn hier alles perfekt ineinanderzugreifen scheint, bleibt man – ich zumindest – am Ende mit einem etwas unbefriedigten Gefühl zurück. Ist dann doch alles zu gut, um gut zu sein? Fehlt vielleicht die unberechenbare Spannung, die durch Imperfektion entsteht? Ist, in diesem Fall, das Ergebnis doch dann mal geringer als die Summe aller Teile? Ist es letztlich ein Beleg dafür, dass im Wort „Kunsthandwerk” meist Handwerk groß und Kunst eher kleingeschrieben wird? Denn perfektes Handwerk findet man hier. Alles andere bleibt dem persönlichen Empfinden überlassen. Tim Lorenz
Innere Tueren – Opening Night (A Futura Memoria)
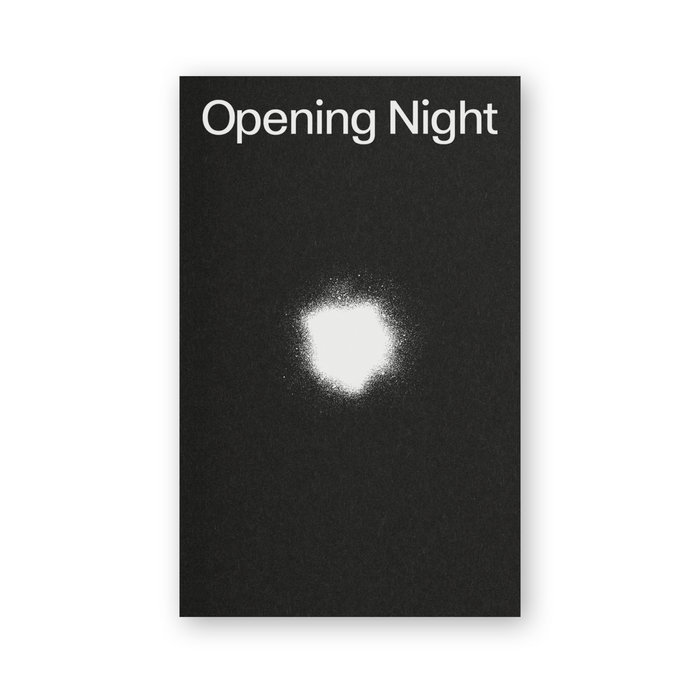
Das Debütalbum von Ergin Erteber auf Kann begeisterte mit einem ganz eigenen Sound zwischen großen Pop-Gesten und wunderbarer 90er-Jahre-Elektronika, deren verzaubernde Romantik sich auch in den gerne mal die Grenze zum Pathos überschreitenden Titelbezeichnungen wie „In Her Wilderness Is My Shelter” Bahn brach. Das überzeugte vor allem, weil es so zwischen allen Stühlen stand und sich auch nicht vor großen Gefühlen scheute.
Auf Opening Night geht es nun wesentlich skizzenhafter zu. Getragen von Field Recordings und Samples, verwebt der Leipziger hier eine ganze Reihe von Klängen zu einem konstanten Soundteppich, der nicht nur stark nach Film Noir und Hitchcock klingt, sondern auch von John Cassavetes gleichnamigen Film inspiriert wurde. Der große Pathos findet hier nur noch in den immer noch sehr schmachtenden Titelnamen statt („An Unrequited Love”) und ist ansonsten einem wesentlich weniger greifbaren Ansatz gewichen, der vor allem auf Atmosphäre, Soundfragmente und eine in sich sehr geschlossene Dichte setzt und damit mehr Raum für Interpretation und Assoziation lässt. Stefan Dietze
ISOR29 – Moon Phase Gardening (Second Circle/Music From Memory)

Hinter ISOR29 steckt der kolumbianische Musiker Tomas Garcia Station, dessen Debütalbum 5.1398° N, 3.3238° W vor zwei Jahren noch unter dem Künstlernamen Irie Nation erschien. Moon Phase Gardening wurde nun mit minimalem Equipment während des ersten Lockdowns in Lissabon aufgenommen, und diese Beschränkung hat Spuren hinterlassen. Natürlich reicht in Zeiten totaler Verfügbarkeit über quasi alle Instrumente und Sounds dieser Welt im Netz ein mittelprächtiger Laptop aus, um hochkomplexe Produktionen herzustellen, andererseits kann die Abwesenheit von Gewohntem, Vertrautem trotz Zugang zur Weltbibliothek die Sicht auf die eigene Kunst verändern.
Auf Moon Phase Gardening äußert sich diese Situation vor allem im weitgehenden Verzicht auf klassische Four-to-the-Floor-Beats, die noch Garcia Stations Debüt prägten. Viele Stücke ziehen ihren Groove vor allem aus sequenzierten Synthiespuren und lassen unweigerlich Assoziationen mit früher Elektronik und Pionier*innen des Genres wie Klaus Schulze aufkommen. Da durch die angenehm nicht auf Hochglanz polierte Produktion auch ein Hauch Kraut, ohne Rock, weht, gleichzeitig aber auch lange Sprachsamples eine wichtige Rolle spielen, bekommt das Album einen ganz eigenen atmosphärischen, verwischt-dokumentarischen Touch – als würde eine Geschichte durch einen Schleier erzählt, weil sie eigentlich gar nicht richtig verstanden werden soll.Diskutierbar bleibt unterm Strich nur die Länge mancher Samples und des einen oder anderen Stückes, etwas Verknappung hätte das Album womöglich noch packender gemacht. Das schmälert aber den Spaß an Moon Phase Gardening nur mikroskopisch, und der zentrale Track und Höhepunkt des Albums „Doll House City” ist mit seinen elf Minuten und 33 Sekunden ohnehin keine Sekunde zu lang. Mathias Schaffhäuser
JB Dunckel – Carbon (Prototyp)
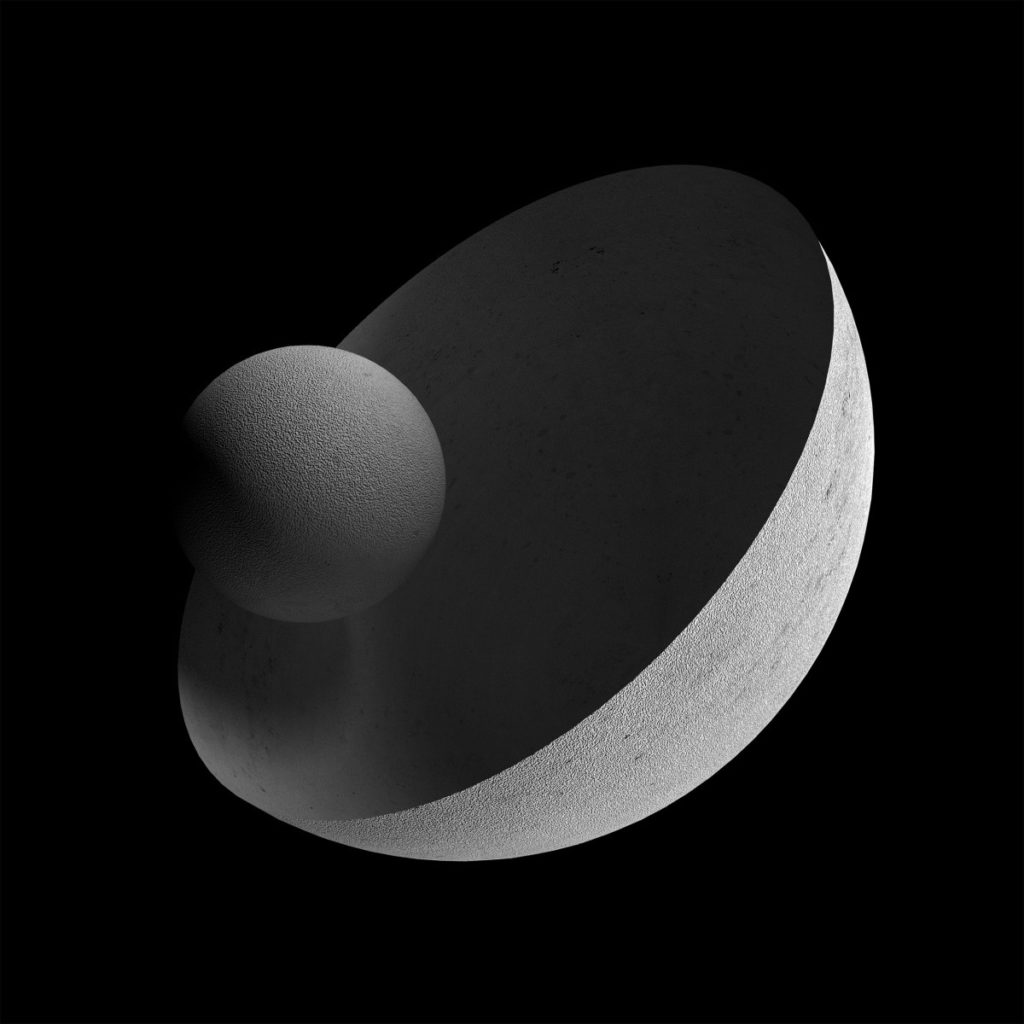
Albenbesprechungen verlangen ein mehrmaliges Hören ebendieser, und wenn nach dem dritten Durchgang ein Song wie „Zombie Park” bereits nach einem alten Bekannten klingt, dann linst das Hitpotenzial nicht nur mit einem Auge um die Ecke. Ein Stück von solchem Format wünschen sich unzählige Musiker*innen in ihrem Werkverzeichnis, JB Dunckel hat bereits mehrere davon geschrieben. Klar, er heißt vollständig ja auch Jean-Benoît Dunckel und ist eine Hälfte des französischen Duos Air. Auf Carbon legt er es aber nicht darauf an, Pop-Perlen aneinander zu reihen, und auch nicht darauf, plakativ auf seine Vergangenheit zu verweisen. Sein mittlerweile drittes Soloalbum ist in keiner Hinsicht Retro-orientiert.
Dunckel baut hier nicht detailverliebt den Sound vergangener Epochen nach, sondern lässt sich – ohne allzu tief in einen bestimmten Kontext einzutauchen – durch das riesige Einflussspektrum treiben, das ihn und natürlich auch Air geprägt hat. Was automatisch mindestens alle zehn Minuten zu einem Seufzen wegen einer neuerlichen Air-Assoziation führt. Aber daran stört rein gar nichts, im Gegenteil, wenn diese Erinnerungen angestoßen werden, geschieht dies eben nicht durch schnödes Anbiedern an die Großtaten der eigenen Band – genauso wenig wie seine Vorbilder kopiert Dunckel nämlich sich selbst.Carbon glänzt und glitzert auf schwer bestimmbare und einnehmende Weise, das Album ist zeitloser (Art-)Pop, der weder um den Coolness-Preis der Jetztzeit kämpfen noch an irgendwelche Trends andocken will. Ein Glück, Beispiele misslungener Versuche dieser Art gibt es zur Genüge – nein, keine Namen jetzt! Dafür lieber die Empfehlung, sich die erste Vorab-Single des Albums anzuhören: „Corporate Sunset” ist ein Uptempo-Instrumental mit Kraut-Rock-DNA und einer erst im letzten Drittel eingeführten, euphorisierenden Synthesizermelodie, die so schnell wieder verschwindet, wie sie spät aufgetaucht ist. Absolut nicht mainstreamradiotauglich, jenseits von gängigen Playlists, und dafür umso mitreißender. Und am Ende ist Carbon eben doch ein Hit-Album, aber eines für die ganz persönliche Top-Ten. Mathias Schaffhäuser
Levon Vincent – Silent Cities (Novel Sound)

Der New Yorker House-Produzent Levon Vincent widmet sich zum zweiten Mal ausgiebig einem Stadtthema. Nach For Paris aus dem Jahr 2017, das unter dem Eindruck der Anschläge auf den Pariser Club Bataclan entstanden war, ist Silent Cities jetzt eine abstraktere Angelegenheit. Vincent, der seit einigen Jahren in Berlin lebt, machte die Aufnahmen zu dieser Platte in einem Studio, das ausnahmsweise nicht sein Schlafzimmer war. Der tägliche Weg zur Arbeit mag da in die Stimmung der Tracks Einzug gehalten haben. Vor allem aber ist das weniger ein Clubalbum denn ein Mixtape, es erscheint auch als Kassette, und die Mehrheit der Stücke nutzt Repetition nicht zur direkten Ansprache des Körpers im Sinne von rhythmischer Aktivität, sondern erzeugt mit unaufdringlichen Akkordpatterns einen Strom, der mehr auf innere Bewegung abzielt.
Einige Nummern lassen eine große Liebe zu diversen Spielarten von Synthpop aus den Achtzigern erkennen, in „Wolves” könnte man mit etwas Fantasie gar eine Art Update des Joy-Division-Hits „Atmosphere” erkennen. Silent Cities ist dabei eine Platte mit eigenwilliger Drift, was gleichermaßen ihre Stärke wie Schwäche ist: Zum Teil auf schräge Art beruhigend,die Dudelsäcke in „Mother Earth”!, dann wieder mit ihren durchaus vorhandenen Rumpelanteilen leicht beunruhigend, macht sie an anderer Stelle durch seltsam unentschlossen wirkende Parts ebenso ratlos. Tim Caspar Boehme
Luke Vibert – GRIT (Hypercolour)

Es gibt nicht allzu viele Hans-Dampf-in-allen-Gassen-Produzent*innen, die über die gesamte Zeit ihrer Karrieren bis heute nichts an Frische, Verspieltheit und inspirierter Freude vermissen lassen. Es gibt Todd Osborn, Richard D. James, Mike Paradinas, und es gibt eben den unglaublichen Luke Vibert. Gleich mehrere Alben dieses Tausendsassas fallen sofort ein, die zu unkaputtbar erfrischenden, fast schon mysteriös guten Musikerfahrungen zählen.
GRIT auf dem englischen Hypercolour macht keine Ausnahme und wieder mal keine Gefangenen. Die Maschinenkonfiguration ist ganz klar gesetzt: Luke Vibert an der 303, 808, 606. Dass er diese Zahlen im Schlaf beherrscht, hat er schon vielmals bewiesen. Umso unglaublicher ist es, was er immer noch aus dieser reduzierten und somit limitierten Aufstellung herausholt, als ob es nichts Leichteres für ihn gäbe.
Alles swingt so unglaublich locker daher, und die Basslines zwirbeln so elegant und eloquent bis an die äußere Hirnrinde und wieder zurück, dass man die Freude am Jammen und Produzieren, klar und deutlich mitzelebrieren kann. Besonders schön ist die 303, eher melodiös-reichhaltig programmiert, zu hören. Diese Rolle, obwohl fast ein wenig ungewöhnlich, ringt ihr auf ihre alten Tage fast noch eine ganz neue Facette ab. Ein extrem großer Spaß. Richard Zepezauer
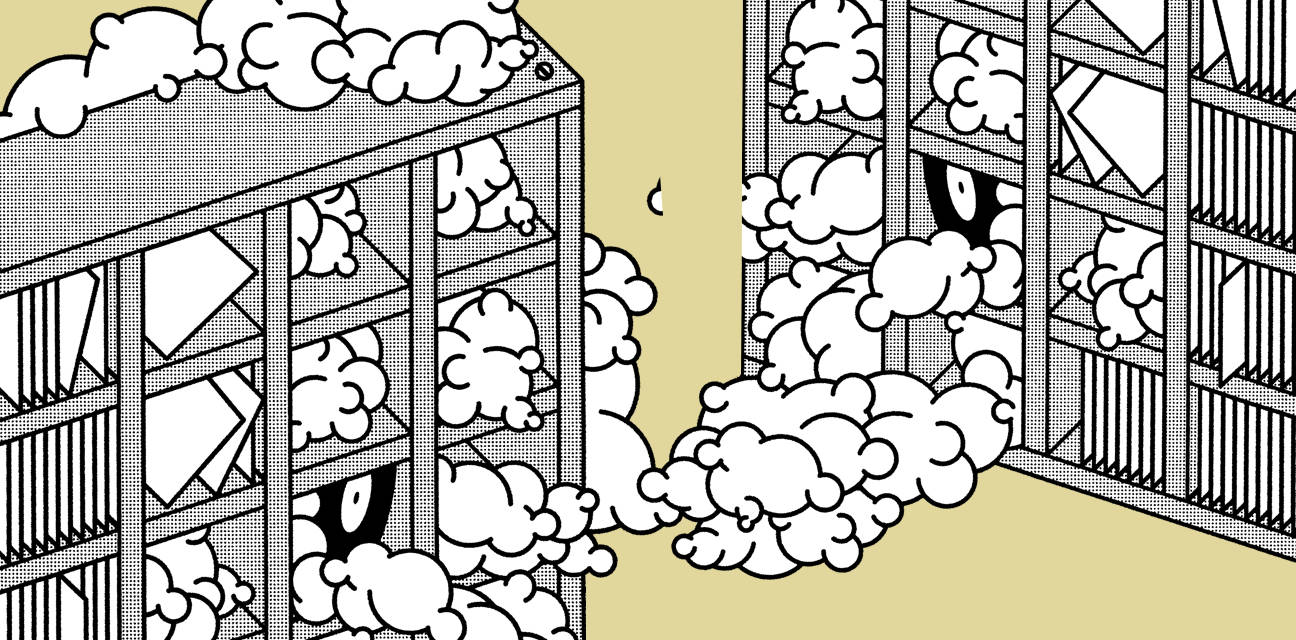

![[REWIND2023]: Die 20 besten Singles des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2023/12/rewind2023_singles-218x150.jpg)


