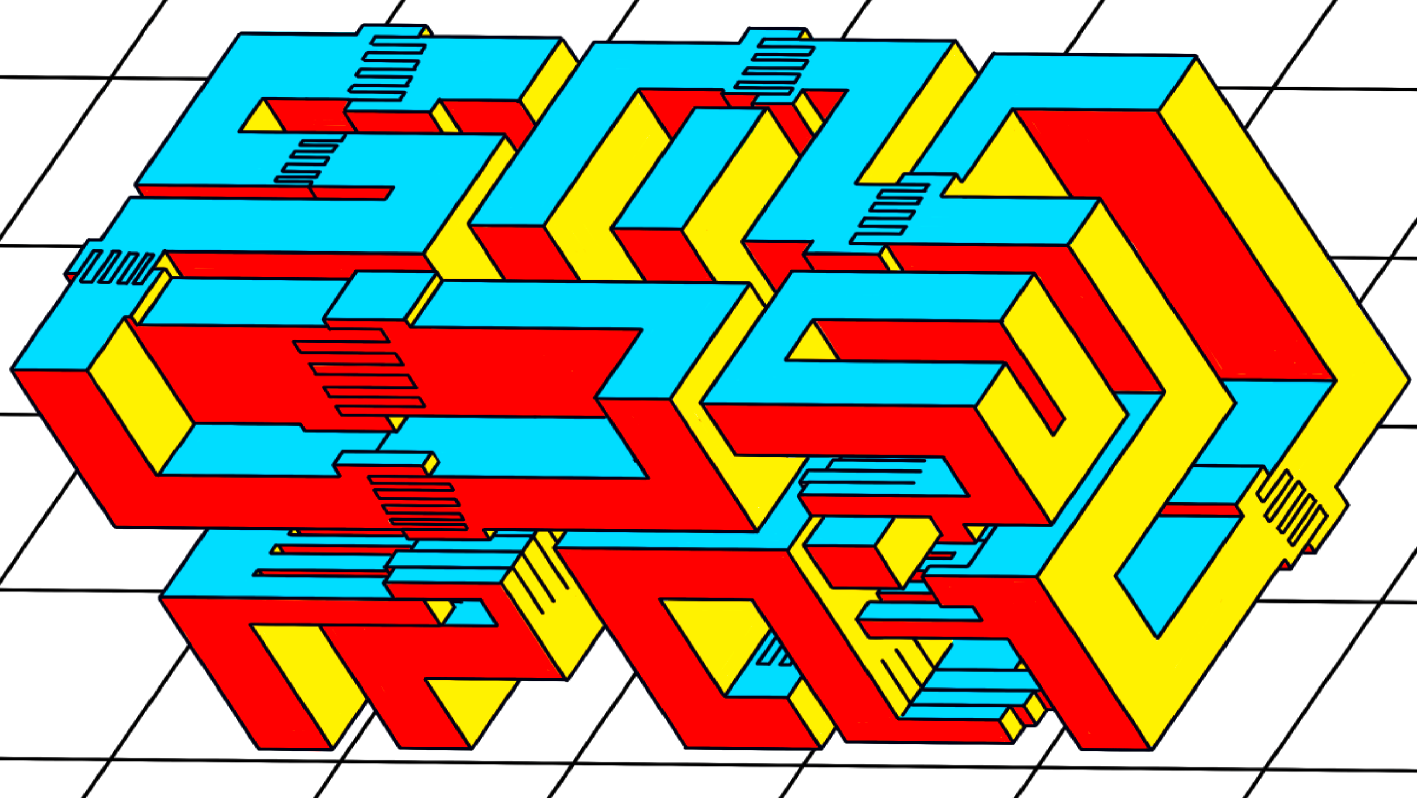„Heute traue ich mich, mehr zu sagen, weil ich weiß, dass das richtig ist”, sagt Judith van Waterkant. (Illustration: Dominika Huber)
Hier geht’s zu Teil I, Hier zu Teil II.
Die sexistischen Missstände in der Clubkultur werden nicht von selbst verschwinden. Die DJ und Aktivistin Judith van Waterkant hat viele Ideen, was jede*r von uns tun kann, um zur Gleichstellung aller Geschlechter beizutragen – ob hinter dem DJ-Pult oder auf dem Floor.
GROOVE-Autorin Lea Schröder ist wie Judith van Waterkant Mitglied des Leipziger Netzwerks fem*vak und hat Judith im Winter bei Online-Plena kennengelernt. Im Frühling haben sie sich zu einem sechsstündigen Realtalk über Sexismus in der Clubszene getroffen. Das Resultat ist unsere Reihe von drei Artikeln, die im Wochenrhythmus erscheinen.
Im dritten Teil der Reihe geht Judith der Frage nach, was wir alle tun können, um die patriarchalen Missstände der Clubszene zu überwinden und der gleichgestellten Gesellschaft näher zu kommen – von konkreten Handlungstipps für Veranstalter*innen, Clubs, Crews, DJs und Gäst*innen bis hin zur strukturellen Analyse patriarchaler Phänomene, an denen männlich wie weiblich sozialisierte Menschen ihren Anteil haben.
Wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist die faktische Gleichstellung aller Geschlechter im Jahr 2157 erreicht. Schön für die Kinder der Kinder der Kinder unserer Kinder – doch die vier vorangegangen Generationen von Frauen, Lesben, inter, nicht-binären, trans und agender Menschen (FLINTA*) müssten die 136 Jahre bis dahin damit leben, weiterhin in allen Bereichen des Lebens diskriminiert und unterdrückt zu werden.
So lange will Judith nicht auf Gerechtigkeit warten. Sie will vor allem eins: Veränderung – und die nicht erst im nächsten Jahrhundert. Aus dem sexistischen Gegenwind, der ihr mal als hasserfüllte Drohung, mal als vermeintlich sachliche Kritik entgegenschlägt, übersetzt sie das Gegenteil: „‚Kann bitte alles so bleiben wie früher? Können wir bitte weiter unsere Boys-Club-Partys haben? Die Typen werden abgefeiert, und die Frauen sind zum Abschleppen da.’” Auf eine Szene mit diesem Mindset hat Judith keine Lust. „Das würde ja bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens, das ich Teil der Clubkultur bin, auf dieselbe Party gehe.” Wie schaffen wir es also, vorwärtszukommen, statt in den immergleichen anachronistischen Mustern der Unterdrückung zu verharren?
Judiths Ideen und Lösungsansätze richten sich an Veranstalter*innen, Clubs und Crews, aber auch an all diejenigen, die sich als Teil der Clubszene sehen. Und selbst wer sich nicht als Teil der Clubszene sieht, kann aus ihren Vorschlägen sicherlich einiges mitnehmen.
Gerechte Gagen
Der wohl simpelste Schritt zur Gleichstellung in der Clubbranche ist die Überwindung der Gender Pay Gap: „Zu allererst bei diesem Thema wünsche ich mir einfach gerechte Gagen. Punkt.”
Diverse Line-Ups
Ein weiterer nicht weniger wichtiger Schritt, den Judith benennt: Weg von White-Men-only-Line-Ups und ‚Quotenfrau’-Bookings, hin zu echter Diversität am DJ-Pult. Als antirassistisches Feigenblatt einmal im Quartal eine Veranstaltung von einem Kollektiv von Schwarzen, indigenen und DJs of Colour kuratieren zu lassen und beim Rest der Events wieder nur weiße Männer zu buchen, reicht dafür allerdings nicht aus. FLINTA*, die DJs sind, und BIPoC, die DJs sind, gibt es viele. Da sie strukturell bedingt weniger sichtbar als weiße cis männliche DJs sind, braucht es vielleicht ein wenig mehr Recherche – aber die gehört ja wohl auch zum Job von Booker*innen.
Im Fall von weiblichen, lesbischen, nicht-binären, trans und agender DJs haben FLINTA* bereits Strukturen geschaffen, um es Booker*innen zu erleichtern, entsprechende Künstler*innen zu recherchieren. Zum Beispiel hat das Netzwerk Music Women* Germany eine bundesweite Datenbank für FLINTA* in der Musikbranche angelegt, in der sich unter anderem DJs eintragen und vernetzen können. Eine weitere Anlaufstelle ist die globale Datenbank des FLINTA*-Netzwerks female:pressure. Hier können Veranstalter*innen Ort, Genre und den gesuchten Beruf in der Club- und Veranstaltungsbranche – unter anderem DJ – angeben und bekommen eine Liste von FLINTA*, die auf das Profil passen.
Darüber hinaus gibt es zahllose feministische Kollektive, Labels und Netzwerke aller möglichen Genres, die in ihren Podcast-Reihen FLINTA* sichtbar machen, beispielsweise der Feat.Fem Podcast, den Judith mitkuratiert. Das Techno-Label Subverted hat neben einer FLINTA*-Podcast-Reihe auch eine umfangreiche Liste von FLINTA* Techno-Produzent*innen erstellt. Die Künstler*innen und ihre Potenziale sind da – nur ein paar Klicks entfernt.
„Dann brauchen wir halt Quoten – auch, wenn ich es traurig finde. Wir haben die letzten Jahrzehnte ja bewiesen, dass es ohne nicht funktioniert.”
Es ist nicht nur mangelnde Recherche, die Judith stört. „Es wird nur angezapft, was schon da ist – viele Crews und Clubs haben nicht einen Finger krumm gemacht, um Nachwuchs zu fördern.” Sie hat Verständnis, dass es nicht immer einfach für Veranstalter*innen sei, das Booking jedes Events paritätisch zu gestalten. Allerdings können es sich Veranstalter*innen – zumindest auf längere Sicht – leichter machen: „Man könnte jetzt sagen: ‚Wir haben die letzten Jahre gepennt und tun jetzt was dafür, etwas zu verändern. Wir machen jetzt niedrigschwellige Angebote: Ein DJ-Workshop auf unserem Festival, oder wir stellen bei uns im Club die Technik für Workshops bereit.’”
Beim Thema ausgewogene Line-Ups fällt bei der Frage nach Lösungen öfter mal das Wort ‚Quote’. Nicht gemeint sind besagte ‚Quotenfrau’-Bookings – „30 Slots, eine Frau – Quote erfüllt” –, sondern aufrichtige, selbst auferlegte und vom Verhältnis her faire Quoten. Von dieser Idee war Judith nicht immer überzeugt. Aber: „Es hat sich über die letzten Jahre entwickelt, dass ich jetzt auch sage: Gut, dann brauchen wir halt Quoten – auch, wenn ich es traurig finde. Wir haben die letzten Jahrzehnte ja bewiesen, dass es ohne nicht funktioniert. Natürlich fände ich es schöner, wenn wir uns mehr mit den Ursachen, nicht nur mit den Symptomen, also dem Line-Up, beschäftigen würden. Aber es ist durchaus eine legitime Methode, auch an den Symptomen rumzuwerkeln. Und dann irgendwann müssen wir da nicht mehr drüber reden – dann haben wir uns alle daran gewöhnt, dass FLINTA* auf der Bühne stehen, dass BIPoC auf der Bühne stehen.”

Diverse Stellenbesetzungen
Als Judith auf einer Diskussionsveranstaltung über Sexismus in der Musikbranche anspricht, dass diverser besetzten Booking-Stellen für diversere Lineups notwendig seien, entgegnet ein Booker aus der Runde: Der Job sei eben super anstrengend und komplex, viele würden diese Aufgabe unterschätzen. „Das war seine Antwort auf meine Anmerkung, dass dieser Beruf hauptsächlich von Männern ausgeübt wird. Er hat nicht mal gemerkt, dass er eigentlich gesagt hat: ‚Männer sind einfach schlauer. Die können eben solche komplexen Aufgaben bewältigen – Frauen nicht.’ Auf einer Veranstaltung, auf der es um diverseres Booking gehen soll!”
Die sexistische Aussage dieses Bookers offenbart ein tieferes Problem: „Wer entscheidet hier, wer mitmachen darf? Es sind die Männer. Ich kenne fast nur Booker, Clubbesitzer, Fesitvalmacher.” Für Judith ist der Zusammenhang klar: Ein undiverses Lineup ist Ausdruck von undivers besetzten Stellen im jeweiligen Club oder Festival. „Bis wir mal Strukturen haben, wo auch Frauen entscheiden, ist es noch ein Weg. Aber den fangen wir jetzt an.”
An dieser Stelle sei klargestellt: Es reicht nicht, Stellen – vor allem die in Entscheidungspositionen – (und DJ-Slots) einfach nur mit mehr (cis) Frauen zu besetzen. Es braucht Menschen, die unsere Gesellschaft in all ihrer Diversität und in ihren unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten repräsentieren, die ihre jeweilige Perspektive einbringen und Probleme und Lösungen sehen, die andere aus ihrer Perspektive nie bemerkt hätten.
Diverse Stellenbesetzung heißt also: Mehr Schwarze Menschen und Menschen of Colour, mehr queere Menschen, mehr Menschen, die nicht cis-geschlechtlich sind, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte, mehr Menschen mit Behinderung, mehr Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen, und eben auch mehr Frauen. Dadurch gewinnen nicht nur Veranstalter*innen und Crew: „Das wird Auswirkungen auf das Publikum haben – wie geht man miteinander um, wer findet statt, wem hört man zu, wer hat was zu sagen. Hoffentlich wir alle, irgendwann.”
Lebenswirklichkeiten mitdenken: ‚Artist-Dixis’ und sicherere Reisen für DJs
Weiterhin wünscht Judith sich, dass Veranstalter*innen die Lebenswirklichkeiten von FLINTA* DJs bei ihrer Veranstaltungsplanung berücksichtigen. Das bedeutet zum Beispiel, schnell erreichbare ‚Artist-Dixis’ neben Festivalbühnen zu platzieren.
Beim Gig kein Klo in Reichweite zu haben, kann nämlich zu äußerst unangenehmen Situationen führen, wie Judith von einem Festival-Gig berichtet: „Es war ein langes Set, und ich musste auf Toilette. Ich hätte bis zu den normalen Klos laufen und mich anstellen müssen. Die haben komplett verpasst, dass da jemand wie ich auflegt und nicht einfach nur gegen den nächsten Zaun pinkelt.” In diesem Fall war Judith auf die Unterstützung eines Security-Mitarbeiters angewiesen. „Das war ein großer, breitschultriger Typ. Der ist mit hinter die Bühne gegangen, hat sich vor mich gestellt, netterweise weggedreht und ein Tuch vorgehalten. Und ich hab mich dann da hingehockt und gepinkelt. Ich weiß nicht, ob den meisten klar ist, dass das auch ein bisschen entwürdigend sein kann.” Zudem ist es Judith schon passiert, dass sie beim Pullern im Festivalwald von Fans gesichtet wurde, die sie währenddessen um ein Selfie baten.
Ein ‚Artist-Dixi’ wäre also die Rettung für all jene DJs, die bei ihrem Gig nicht mal easy hinten von der Bühne runterpinkeln können oder keine Lust haben, während ihres Sets in einem lichten Busch neben der Bühne mit ihrem blutigen Tampon zu hantieren.
Doch vor allem muss die Situation der Künstler*innen bei der An- und Abreise vom Club mitgedacht werden. Wenn der international bekannte DJ per Shuttle Bahnhof abgeholt wird, kann dort auch die Newcomerin aus der Nachbarstadt eingesammelt werden. „Das klingt jetzt nach noch mehr Arbeit. Aber ich finde das wichtig für die Sicherheit der Künstlerin.”
„Ist doch toll, wenn dieser Nachtberuf für Frauen attraktiver wird, weil man weiß, da wird für meine Sicherheit gesorgt.”
Das begründet Judith mit eigener Erfahrung: „Ich weiß nicht, ob das den meisten Crews und Booker*innen so klar ist, was es heißt, eine Frau nachts allein in eine andere Stadt zu schicken. Ich bin zum Teil wirklich verängstigt irgendwo angekommen, aufgrund der Erfahrungen, die ich da draußen gemacht habe. Das lässt sich doch beheben, indem man, wenn man eh schon Leute dahin fährt, mich einplant und mitnimmt.”
Falls der Aufwand für die Shuttle-Orga den jeweiligen Veranstalter*innen zu hoch ist, ist es vielleicht Zeit, All-In-Deals durch eine separate Gage plus individuelle Fahrtkosten zu ersetzen. Zu letzteren kann eine Taxipauschale aufgeschlagen werden, die Künstler*innen je nach Sicherheitsbedürfnis zusätzlich zu den Fahrtkosten in die Stadt beanspruchen können. Laut Judith lohnt sich dieser Mehraufwand auch für die Veranstalter*innen: „Die Künstler*innen können sich auf das konzentrieren, wofür sie da sind – nämlich Musikmachen und ein Publikum begeistern. Ist doch toll, wenn dieser Nachtberuf für Frauen attraktiver wird, weil man weiß, da wird für meine Sicherheit gesorgt.”
Awareness schaffen – auf eigenen Veranstaltungen und darüber hinaus
Um Übergriffe auf eigenen Veranstaltungen vorzubeugen und eine niedrigschwellige und zuverlässige Unterstützung für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt zu gewährleisten, sind Awareness-Teams unerlässlich. „Bei der Awareness wird gerne mal gespart. Ich finde wichtig, dass die Schichten gut besetzt sind und ernstgenommen werden. Ich wünsche mir, dass das ins Club- und Festivalgeschehen installiert wird. Dass es Anlaufstellen und Teams gibt, diese Arbeit bezahlt wird und dass sie nicht nur von FLINTA* gemacht wird. Und ich wünsche mir, dass cis Männer Arbeit abnehmen.”
„Ich finde, wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der man nicht mehr sagen kann, man sei unpolitisch.”
Veranstalter*innen, Festivalmacher*innen und Clubbetreiber*innen können außerdem Bildungs- und Aufklärungsarbeit in ihr kulturelles Programm integrieren, indem sie zum Beispiel Workshops, Diskussionen und Vorträge organisieren oder ihre Räume dafür zur Verfügung stellen. Die Frage, wie weit der politische Bildungsauftrag für die eigenen Gäst*innen geht, würde sicher unterschiedlich beantwortet. Judiths Haltung dazu ist eindeutig: „Ich finde, wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der man nicht mehr sagen kann, man sei unpolitisch. Und ich finde auch: Wenn man eine Reichweite hat, hat man eine Verantwortung.”
Platz im Plenum für Reflexion von Diskriminierung
Doch es reicht nicht, sich allein auf der Arbeit der Awareness-Teams und der Aufklärung und Weiterbildung der Gäst*innen auszuruhen. Auch die Crew und jedes einzelne Mitglied muss lernen, ‚aware’ zu sein – also sich aktiv und bewusst mit Diskriminierung auseinanderzusetzen. Ein Ansatz dafür ist, der kritischen Reflexion von eigenen diskriminierenden Strukturen, Gedanken und Handlungen in den internen Arbeitsabläufen einen festen Platz zu geben und sie so genauso zur Routine werden zu lassen wie das tägliche Zähneputzen. Raum dafür kann in den gewöhnlichen Arbeitstreffen geschaffen werden. „Es muss ja nicht immer vier Stunden gehen. Einfach in zehn, 15 Minuten in der Gruppe überlegen, wie es gerade mit Diskriminierung aussieht und was besser gemacht werden kann – Hauptsache, es ist dabei.”
Die Arbeitsgruppen beim ‚Hack Sexism’-Hackathon haben zahlreiche weitere konkrete Tipps und Handlungsvorschläge für Crews, Clubs, Festivals und andere Veranstalter*innen erarbeitet. Diese werden in den Ergebnis-Videos des Hackathons zusammengefasst.
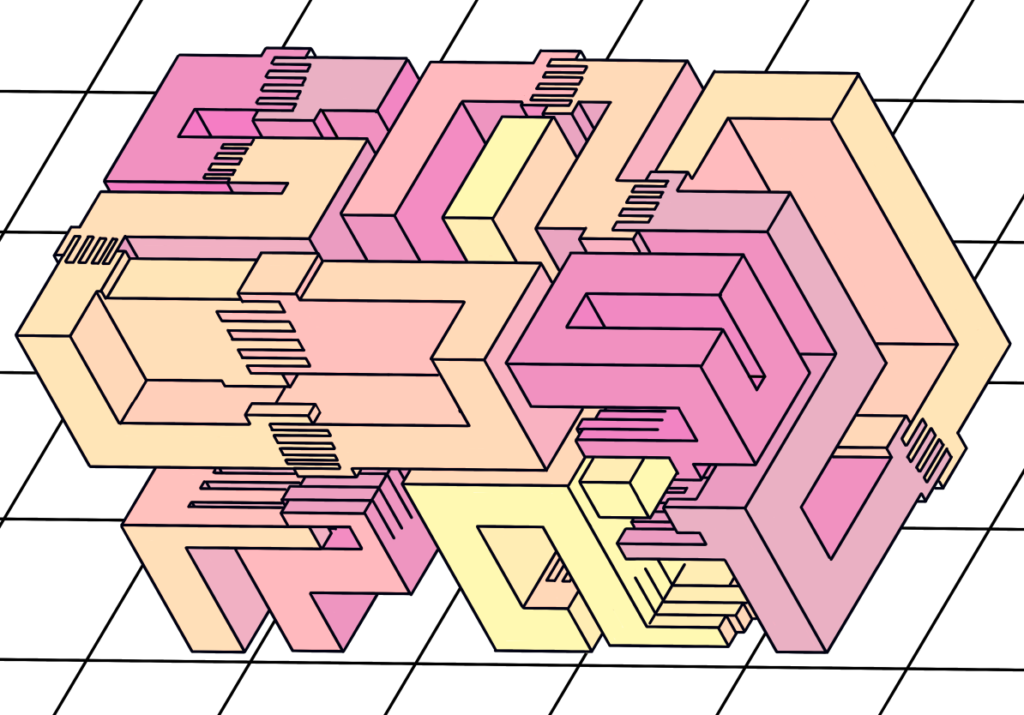
Neuer Umgang mit Betroffenen und Gewaltausübenden
Judith erkennt ein weiteres Problem, das es zu lösen gilt: Der gegenwärtige Umgang mit Menschen, die gewaltvolle Erfahrungen gemacht haben, ebenso wie der Umgang mit jenen, die die Gewalt ausgeübt haben. Kein Thema, das nur Veranstalter*innen anspricht – alle müssen sich damit auseinandersetzen.
Auch in der Clubszene erfahren Täter bislang nur in Ausnahmefällen Konsequenzen, wie zum Beispiel eine Recherche des Onlinemagazins frohfroh über Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt durch DJs zeigt. Auch Henning F., der Täter von Monis Rache, war laut einem Statement von Bewohner*innen des linken Hausprojekts, in dem er bis zur Veröffentlichung der Recherche lebte, von Mitwissenden aus dem Haus und aus der Orga-Crew von Monis Rache gedeckt worden.
Dass die Täter – vor allem die in Machtpositionen – in der Regel individuell, kollektiv und strukturell gedeckt statt sanktioniert werden, hat auch Judith bemerkt: „Ich bin manchmal negativ beeindruckt davon, was man sich als Typ alles erlauben kann und immer noch da ist, noch spielt und Partys schmeißt, kein Hausverbot hat, eine riesige Plattform bekommt. Sogar die, die sich offensichtlich scheiße benehmen, haben immer noch Gigs, immer noch Reichweite, immer noch einen Haufen Follower und werden immer noch abgefeiert. Wir haben schon zu oft erlebt, dass die damit durchkommen.”
Betroffene unterstützen statt beschuldigen
Statt die Täter zu schützen, müssen die Betroffenen geschützt und unterstützt werden. Doch in der Regel ist das Gegenteil der Fall: Während diejenigen, die Gewalt ausüben, wenig zu befürchten haben, befinden sich diejenigen, die sie erfahren, oft in einer verzweifelten Lage. Betroffene müssen nicht nur einen Weg finden, die gewaltvolle Erfahrung zu verarbeiten – sie müssen sich auch noch Verharmlosungen und Schuldzuweisungen – sogenanntem Victim-Blaming – aus ihrem Umfeld entgegenstellen.
„Ich wurde auch schon gefragt, warum ich überhaupt noch mitmache, wenn die Musikszene wirklich so sexistisch ist, wie ich sage. Dass ich gehe, soll die Lösung sein? Das sehe ich gar nicht ein!”
Judith geht offen mit ihren Gewalterfahrungen um, teilt sie auch in ihren öffentlichen Posts. So erlebt auch sie, was vielen Betroffenen widerfährt, wenn sie über das sprechen, was sie durchmachen und durchgemacht haben – unabhängig davon, ob es um sexistische Mikroaggressionen oder sexualisierte Gewalt geht. „Ich hab’ mir fast schon abgewöhnt, mich darüber auszutauschen. Weil man dann eben diese Rückmeldung öfter bekommt – ‚Bist du dir sicher?’; ‚Meinst du nicht, dass du zu sensibel bist?’”
Eigentlich sei das Geschehene doch gar nicht so schlimm, vielleicht übertreibe sie einfach und überhaupt, habe sie eigentlich Beweise dafür? Wer so reagiert, macht damit deutlich, weder Judith noch ihre Erfahrung ernst zu nehmen. Das tut weh, sagt sie. „Ich wurde auch schon gefragt, warum ich überhaupt noch mitmache, wenn die Musikszene wirklich so sexistisch ist, wie ich sage. Dass ich gehe, soll die Lösung sein? Das sehe ich gar nicht ein! Ich will ja mitmachen.”
Das Victim-Blaming führt dazu, dass Schweigen manchmal die leichter zu ertragende Option für Betroffene ist. Oder sogar zu der Entscheidung, aus Selbstschutz das eigene Umfeld zu verlassen. „Ich hab’ auch erlebt, dass Frauen aus der Szene verschwunden sind. Die haben einen Übergriff erlebt, haben nicht die Unterstützung bekommen, die sie gebraucht hätten. Und in der Konsequenz sind sie aus Kollektiven ausgestiegen oder weggezogen.”
Nur die Täter sind für ihre Konsequenzen verantwortlich
Die einen Mitwissenden relativieren, verharmlosen und stellen sich auf die Seite der Täter. Die anderen fordern Betroffene dazu auf, Täter öffentlich zu benennen, zu outcallen. Wie schwierig es sein kann, als Betroffene mit den Identitäten der Täter umzugehen, thematisiert Judith in einem Text, den sie im Frühling unter dem Titel ‚Wer sind die Typen’ auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat. Denn Forderungen nach Outcalls setzen Betroffene unter Druck und können ihre Lage noch verschlimmern: „Ich will mich nicht nochmal erklären müssen, weil es nicht ‚schlimm genug’ ist. Mein Stressempfinden ist aber, dass es schlimm ist! Dass ich Angst hab’ und mich wahnsinnig viel damit beschäftigen muss, welche Konsequenzen das für mich hat.”
Die Konsequenzen, die Judith anspricht, können schwerwiegend sein. „Im schlimmsten Fall werde ich aus der sogenannten Szene ausgeschlossen. Wenn die Netzwerke so stark und mächtig sind, wie sie sind, muss ich befürchten, dass ich diejenige bin, die gehen muss. Die nicht mehr spielen kann, nicht mehr Teil von Gemeinschaften ist.”
„Wir müssen aufpassen, dass sich diese Narrative nicht verfestigen. Es muss heißen: Er war scheiße, er hat keine Andeutung gemacht, dass er sich bessern wird. Also muss er gehen.”
Warum müssen sich Betroffene sorgen, wegen Gewalt, die ihnen angetan wurde, selbst sanktioniert zu werden? Grund für diesen absurden Widerspruch ist eine weitere Ausdrucksform des Victim-Blaming, die Judith aus eigener Erfahrung kennt: „Es gab auch wegen mir schon mal einen Ausschluss von jemandem aus dem Kollektiv. Es hatte ewig gedauert, bis das passiert ist. Und dann konnte ich mir echt lange anhören, dass ich ihm sein soziales Umfeld nehme, obwohl er sich scheiße benommen hat.”
Judith appelliert, nicht zu verwechseln, wer die Gewalt ausgeübt hat und für das eigene Handeln zur Verantwortung gezogen wird, und wer von der Gewalt betroffen ist und sich angemessene Unterstützung einfordert. „Wir müssen aufpassen, dass sich diese Narrative nicht verfestigen – dass Menschen, die Sachen aus ihrer Betroffenenperspektive transparent machen, schuld sein sollen, dass jemand Konsequenzen erlebt. Es muss heißen: Er war scheiße, er hat sich nicht adäquat dazu verhalten, er hat keine Andeutung gemacht, dass er sich bessern wird. Also muss er gehen.”
Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Judith bislang auf Outcalls verzichtet: „Wenn man Namen nennt, ist es vielleicht zu einfach, diese Person zu ächten. Aber es ist nicht nur ein Typ oder ein Club, wir alle hängen da drin. Es ist ein kollektives Problem. Ich will, dass wir unsere eigenen Anteile daran erkennen, was wir alle in diesem Konstrukt zu tun haben.”