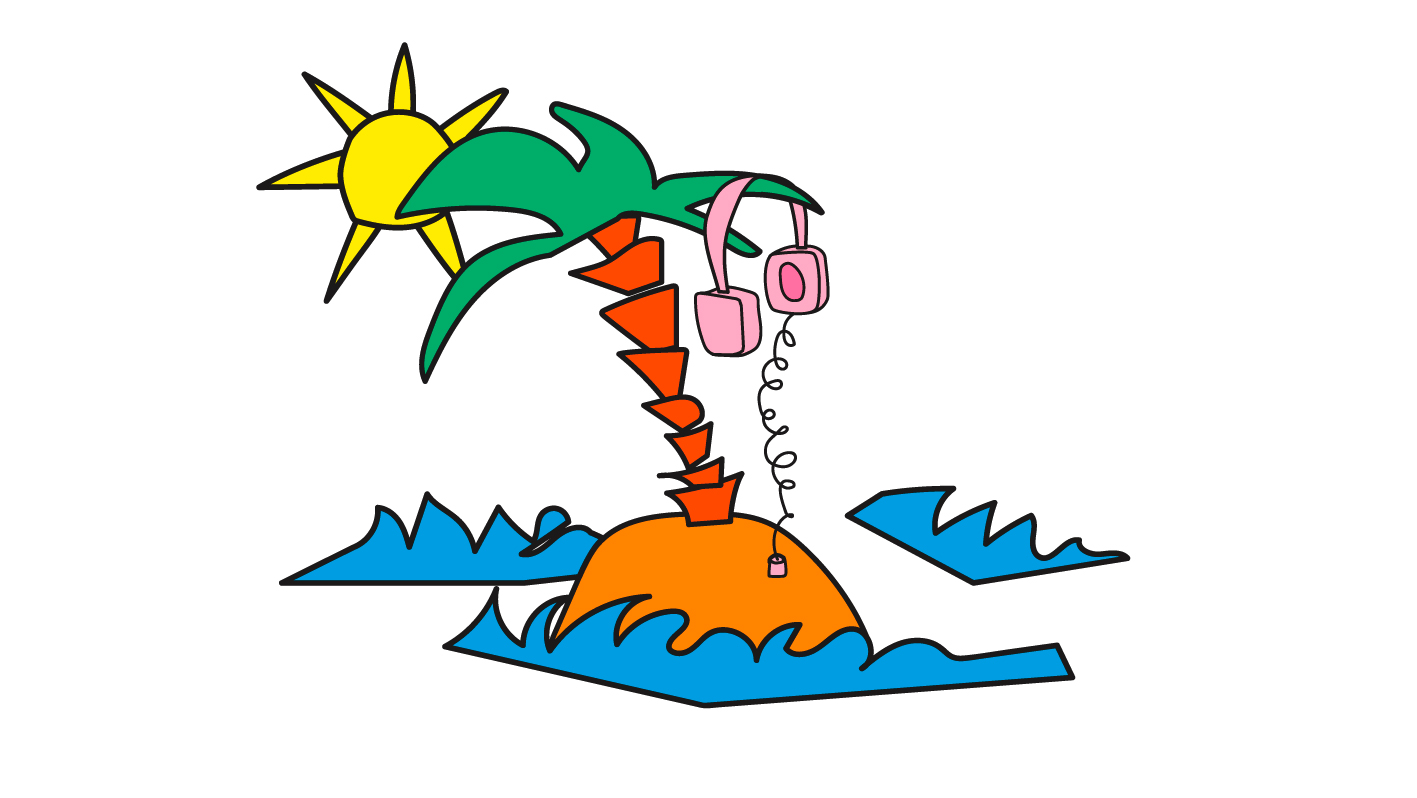Illustration: Dominika Huber. Alle Fotos im Beitrag: Peter Marley/ Privat
Peter Marley ist DJ, Weltenbummler und gelegentlicher Autor der GROOVE. Die Coronakrise hat ihn im März in Thailand eingeholt. Einer Intuition folgend entschloss er sich, nach einem abgesagten Festival-Gig nicht den letzten Flieger in die europäische Heimat zu nehmen, sondern dort zu bleiben. Für die GROOVE hat Marley aufgeschrieben, was er in den zehn Monaten dort erlebt hat.
Im März diesen Jahres für ein Festival extra nach Thailand zu fliegen – das erntete im Umfeld erstmal skeptische Blicke. So weit weg für so kurze Zeit, und das in Zeiten von Corona? Ich war mir ähnlich unsicher, doch Berichten zufolge waren die Strände dort schon seit Wochen menschenleer, keine Infektionsgefahr also. Und als DJ hat mir Asien immer gut getan: nirgendwo sonst konnte ich in der Vergangenheit so leicht neue Kontakte knüpfen und spontan Gigs über Ländergrenzen hinweg aneinanderreihen. Die Szene dort ist unkompliziert und offen, von Sättigung oder Konkurrenzdenken keine Spur. Wer einen guten Vibe mitbringt, hat es dort in der Regel leicht. Ich spielte also mit dem Gedanken, vielleicht einfach spontan länger zu bleiben. Dass es am Ende das ganze Jahr werden würde, hatte ich allerdings nicht erwartet.

Denn als dann klar wurde, dass das Festival gar nicht stattfinden würde und sich die Ereignisse in der Welt überschlugen, musste eine Entscheidung her: entweder noch schnell in den vielleicht letzten Flieger nach Hause steigen – oder auf unbestimmte Zeit in Thailand festsitzen. Wir waren zwar weit weg von Corona, aber die Auswirkungen des ersten drastischen Lockdowns würden auch hier in der thailändischen Urlaubsprovinz spürbar werden. Würde man bald überhaupt noch Lebensmittel kaufen können? Oder sich frei bewegen? Wie verhielt es sich mit meinem bald auslaufenden Touristenvisum? Und wann könnte man überhaupt wieder mit einer Wiederaufnahme des Flugverkehrs rechnen? Und wie ging es wohl meinen Eltern (Risikogruppe) in Berlin? Alles große Unwägbarkeiten, die immer wieder drohten, ein Klima der Angst heraufzubeschwören.
8500 Kilometer entfernt von Zuhause, am Vorabend der Pandemie
Glücklicherweise bestreitet man so ein Festival ja nicht alleine, sodass ich mich inmitten der ebenfalls vergeblich Angereisten zumindest in guter Gesellschaft befand. Viele kannte ich schon aus Vorjahren, ein paar hatten gute Verbindungen zu Nachrichtenkanälen. So fühlte ich mich trotz allem Trubel, aller Hysterie in der Welt da draußen, in der bestmöglichen Ausgangssituation: weit weg von allem, in einem tropischen Paradies, umgeben von neuen und alten Freund*innen, die alle im gleichen Boot saßen. Egal, was jetzt auch kommen sollte, ich nahm uns stark genug wahr, um gemeinsam alles zu überstehen.

So entschloss ich mich gegen die Angst und aus dem Herzen heraus, zu bleiben. 8500 Kilometer entfernt von Zuhause, am Vorabend der Pandemie. Wenn man sich den restlichen Verlauf des Jahres für mich wie für den Rest der Welt anschaut, kann ich mich nur als extremen Glückspilz bezeichnen. Die Entscheidung, entgegen aller Unwägbarkeiten im fernen Osten inmitten einer durch ein Festival vereinten Schicksalsgemeinschaft zu bleiben, hat mich vor einem Jahr voller Isolation, Abschottung und Stagnation in der Heimat gerettet – und stattdessen ein außergewöhnliches, aufregendes Leben als Tropen-Aussteiger in Thailand ermöglicht, das mich als Teil einer internationalen Community von Corona-Exilanten auf unterschiedlichsten Ebenen hat wachsen lassen.
Es fühlte sich komisch an, mitunter sogar gespenstisch. Kilometerlange, verlassene Strände.
Die ersten paar Wochen verschanzten wir uns also In einem Resort am Strand, ließen die Außenwelt im Chaos versinken und hofften, dass bald alles wieder zur Normalität zurückkehren sollte. Aber auch einen Monat später, als das Hotel endgültig seine Pforten schließen musste, war von Normalisierung keine Spur zu erkennen. Restaurants geschlossen, Alkoholverkauf verboten, Ausgangssperre ab 21 Uhr, und auch die Mobilität zwischen den Provinzen war stark eingeschränkt. Mithilfe einiger Formulare und eines schnell ausgestellten Gesundheitszeugnisses hofften wir, es bis auf die Insel Koh Samui im Golf von Thailand zu schaffen; dort, hieß es, sei das Leben schon wieder einigermaßen restriktionsfrei zu genießen. Dort lockerten sich nach und nach die Vorsichtsmaßnahmen.
Corona-Infektionen waren in Thailand bereits auf Bangkok beschränkt, und die Landesgrenzen blieben weiterhin geschlossen. Ich fühlte mich also sicher genug, um die Krise weiterhin in Fernost auszusitzen. Außerdem offenbarte sich nun langsam ein tropisches Eiland, das sonst von Rentner*innen und Tourist*innen bevölkert ist, jetzt ausnahmsweise fast menschenleer. Es fühlte sich komisch an, mitunter sogar gespenstisch. Kilometerlange, verlassene Strände, an denen vielleicht eine von einem Dutzend Bars geöffnet hatte.

Geschlossene Ladenfronten an jeder Ecke und große Supermärkte mit zehnmal mehr Angestellten als Kund*innen. Gleichzeitig war die Situation für die wenigen verbliebenen Corona-Gestrandeten von Vorteil, weil Unterbringungen nun für einen Bruchteil des normalen Saisonpreises angeboten wurden. Auf den leeren Straßen und Stränden kam es mir oft so vor, als wären wir in ein Thailand von vor 20, 30 Jahren katapultiert worden.
Ein neues Zuhause
Ein paar Wochen später verließ ich die eingeschworene Gruppe und setzte auf die Nachbarinsel Koh Phangan über. Die hat mit ihren ca. 10.000 Einwohner*innen noch viel weniger Infrastruktur als der große Bruder Samui und besteht zum größten Teil aus Dschungel. Zum Leben reichte mir ein einfacher Holz-Bungalow, das war günstig genug, um bis auf weiteres zu bleiben.
Das Leben auf der Insel versprühte dabei die totale Freiheit, die mir bis dato höchstens an einem Fusion-Festival-Sonntag begegnet war.
Von der Idee, in absehbarer Zeit nach Hause zu fahren, hatte ich mich verabschiedet. Deswegen war ich jetzt umso aufgeregter, diese neue Insel zu erschließen. Drei Jahre zuvor war ich als reisender DJ schon mal kurz dort gewesen. Ein kleines Festival hatte mich netterweise eingeladen, und dort fand ich mich am Ende tatsächlich als letzter DJ beim Sonnenaufgang am Strand wieder! Dieses Abenteuer hatte sich für immer in mein Herz gebrannt, und die Beziehung zu Phangan als eine kurze, aber umso innigere Liebesaffäre abgespeichert.

Die Vorurteile eines von Pauschaltouristen heimgesuchten Südostasien-Ballermanns waren schnell Geschichte. Stattdessen präsentierte sich hier eine aus aller Welt stammende Community, vernetzte Nomaden, die sich in jeder Saison für einige Monate wieder treffen. Das Leben auf der Insel versprühte dabei jene grenzenlose Offenheit, bedingungslose Liebe und totale Freiheit, die mir bis dato höchstens an einem Fusion-Festival-Sonntag begegnet war.
Die Auswirkungen der globalen Krise hatten auch vor diesem Ort keinen Halt gemacht. Ohne Touristen blieben die meisten Geschäfte oder Restaurants geschlossen und viele Saisonarbeiter*innen saßen ohne Jobs und die Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren, fest. Ich lernte eine Gruppe Thais kennen, die seit Monaten Bedürftige mit Essen versorgte. Mein Bungalow grenzte an ihren Bambushain, der bis vor kurzem noch Campingplatz für einige hundert gestrandete Ausländer*innen gewesen war, die ohne Geld und Lebensmittel festgesessen hatten. Die Allermeisten sind seitdem heimgekehrt, die wenigen Verbliebenen haben sich langsam mit dem neuen Status Quo arrangiert.
Die Krankheit spielte in meinem thailändischen Leben eigentlich keine Rolle mehr.
Während ich durch wöchentliche Telefonate mit der Familie und gelegentlichen Austausch mit engen Freunden weiterhin im Bilde bleibe, was sich daheim in Sachen Corona tut, spielt die Krankheit in meinem thailändischen Leben eigentlich keine Rolle mehr. Mit Dankbarkeit denke ich an die Möglichkeiten, die Freund*innen hier ohne Umstände täglich sehen und berühren zu können, anstatt sich in einem grau-kalten deutschen Winter auch noch einigeln zu müssen. Wir dürfen tanzen, kuscheln, schwimmen, und sogar in der aktuellen Regenzeit ist es stets warm genug, in kurzen Hosen und Tanktop herumzulaufen.

Wer sich jetzt vielleicht versucht fühlt, selbst den Absprung nach Fernost zu wagen, dem*der sei gesagt, dass die Einreise nach Thailand immer noch mit einer zweiwöchigen Zwangsquarantäne im ebenso schäbigen wie kostspieligen Staatshotel verbunden ist. Diese konsequente Politik ist keine leichte Entscheidung für ein Land, das rund 20 Prozent seines Bruttoinlandproduktes mit dem Tourismus verdient. Doch aufgrund dieser rigorosen Haltung ist das Leben hier wieder sicher und quasi ohne Einschränkungen möglich.
Seit dem Moment kann ich voller Überzeugung sagen: ich wohne hier, das ist mein Zuhause.
Bemerkenswert ist deshalb die immer noch währende Gastfreundschaft der Thailänder*innen den verbliebenen Ausländer*innen gegenüber. Ohne die mehrfach verlängerte Amnestie hätten wir zum Beispiel schon längst das Land verlassen müssen. Ganz zu schweigen von den überall heruntergesetzten Preisen, die einen längerfristigen Aufenthalt erst möglich gemacht haben. Trotz ökonomisch katastrophaler Zeiten nehmen die Einheimischen in ihrer Gastlichkeit also brüderlich Rücksicht auf die finanzielle Situation der Corona-Exilant*innen. Gleichzeitig besteht ein gewisser Argwohn den Nachbarnationen gegenüber, aus denen bereits mehrmals vereinzelt Infizierte illegal an den Kontrollen vorbei über die Grenze geschlüpft sind.

Wer wie wir allerdings schon länger hier ist, die meisten zwischen acht und zwölf Monaten, hat sich in der Regel von der geografischen Heimat verabschiedet und fokussiert sich jetzt auf ein neues, wenn auch nur temporäres Leben in Thailand. Bei mir dauerte es bis Juni, als mein zweiter Heimflug gestrichen wurde. Zuerst hatte ich gedacht, es sei jetzt doch mal gut mit dem Limbo-Dasein und der Sommer in Europa wäre ein guter Zeitpunkt für meine Heimkehr. Als sich das Flugdatum näherte, bekam ich erste Zweifel. Dann die völlig unerwartete Absage seitens der Lufthansa – und plötzlich fühlte ich mich frei, so lange zu bleiben, wie es sich richtig anfühlt. Seit dem Moment kann ich voller Überzeugung sagen: ich wohne hier, das ist mein Zuhause. Was als zweiwöchiger Urlaub in Thailand beginnen sollte, hat sich als völlig neuer Lebensentwurf entpuppt.
Man kennt sich zumindest vom Sehen, es herrscht gegenseitiger Respekt, Offenheit und ein Gefühl der Verbundenheit.
Ein Leben, für das ich jeden Tag dankbar bin. Mittlerweile beginnen meine Tage hier regelmäßig noch vor Sonnenaufgang. Mit Yoga und Meditation, seit kurzem sogar Qi Gong. Jeden Morgen trifft sich eine Gruppe von Freund*innen zur gemeinsamen Praxis, dann startet nach dem Frühstück jede*r in den eigenen Tag. Meine Bekanntschaften auf der Insel kommen dabei aus der ganzen Welt. Viele von ihnen habe ich schon auf anderen Reisen kennengelernt, meistens auf einem Festival. Den einen in Lettland, die andere in Costa Rica, wieder andere in Vietnam. Die Insel ist so winzig und die Gruppe derer, die noch hier sind, so stark geschrumpft, dass man sich wirklich immer wieder über den Weg läuft. Es fühlt sich an, wie ein großes Dorf, und trotz allem gibt es nach wie vor dieses starke Gefühl von Zugehörigkeit.

Sogar die einst so aktive Partyszene der Insel ist langsam wieder zum Leben erwacht, wenn auch ganz anders als früher. Die berühmt-berüchtigten Vollmond-Raves, die Monat für Monat Horden von Sauftourist*innen anlockten, sind passé. An ihrer Stelle sind es zahlreiche Mini-Partys, die um die kleine Schar der Partygänger*innen buhlen. Was früher noch getrennt voneinander existierte und sich in verschiedenen Sub-Communitys abspielte, kommt jetzt auf diesen sehr familiären Veranstaltungen zusammen. Egal ob Yogis, Hippies, digitale Nomad*innen oder russische Oligarchen – wir alle sind nun mehr oder weniger die letzten Vertreter*innen unserer Art. Man kennt sich zumindest vom Sehen, es herrscht gegenseitiger Respekt und Offenheit und ein Gefühl der Verbundenheit. Ganz einfach, weil man immer noch hier ist.
Bei mir hat sich der Jieper inzwischen dennoch gelegt. Nur selten bleibe ich noch länger als ein, zwei Stunden auf den Events.
Eine so heterogen durchmischte Szene hat natürlich auch andere Musik-Schnittmengen als der Underground in Europa oder gar in Berlin. Die Leute hier haben die unterschiedlichsten Hintergründe, und viele sehen die Party mehr als Ort der Begegnung und des Austauschs. Dass die Musik dann eher zur Nebensache wird und einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden muss, mag aus ästhetischer Sicht zwar traurig erscheinen, ist aus soziokultureller Perspektive der Realität aber wahrscheinlich angemessener. In der Regel findet sich auf den Feiern auch etwas zu essen, oftmals ein kleiner Markt mit selbstgemachten Produkten von Schmuck oder Kleidung bis zum Kokosnuss-Joghurt. Die meisten Locations sind outdoor und nehmen kaum Eintritt, man fließt deshalb eher ungezwungen rein und raus und fühlt sich kaum verpflichtet, einem nicht so prickelnden Set ganze fünf Stunden lang zuzuhören.

Denn leider krankt Koh Phangan nach wie vor am Umstand, dass sich eine kleine Gruppe von Resident-DJs die allermeisten Spielzeiten unter sich aufteilt. Man hört also immer wieder den gleichen Kram, zwischen uninspiriertem, breitwandigem Melodic Techno, bassigem Progressive House und einfallslosem Ethno-Sample-Downbeat. Puristische Techno- und Housemusik oder einfach etwas Deeperes als die Beatport-Top-100 sucht man hier meist vergeblich. Doch mit Blick auf den Rest der Welt kann man froh sein, überhaupt noch ausgehen und Freunde treffen zu dürfen; geschweige denn sich auf einer Party aufzuhalten, ohne an Abstandsregeln denken zu müssen.
Die Rückkehr der Party
Bei mir hat sich der Jieper inzwischen dennoch gelegt, nur selten bleibe ich noch länger als ein, zwei Stunden auf den Events. Dafür sind mir Schlafrhythmus oder Zeit in der Natur doch wichtiger. Eine bemerkenswerte Alternative zum herkömmlichen Feiern bieten allerdings die sogenannten Ecstatic Dances. Sie sind für viele hier fester Bestandteil des Lebens. Das Konzept ist simpel: Partys ohne Substanzen, auf denen entweder gar nicht oder nur kaum gesprochen wird und das pure Tanz-Erlebnis im Vordergrund steht. Die DJs spielen hier meist ziemlich abwechslungsreiche Sets, die sowohl energetisch als auch stilistisch einen großen Bogen spannen.
„Wozu jetzt zurückkommen? Bleib bloß da!”
Dazu kein Anbaggern, kein Gequatsche, einfach Abgehen und Loslassen. Das bringt eine ganz eigene, unglaublich starke Energie auf den Dancefloor, die man sich eigentlich für jede Party wünschen würde. Gerade wenn man an herkömmliche Clubnächte denkt, in denen zuerst stundenlang nichts passiert, bis endlich die Hüllen fallen. Da ist es umso inspirierender zu sehen, dass es auch anders geht und diese kollektive Kraft von null auf hundert entfesselt werden kann. Sowas einmal die Woche, und das persönliche Tanzpensum ist garantiert wieder aufgefüllt.
Einen konkreten Plan, irgendwann nach Hause zurückzukehren, habe ich momentan nicht. Meine Freunde von dort begrüßen meine Entscheidung, länger zu bleiben. Sie sagen: „Wozu jetzt zurückkommen? Bleib bloß da! Hier ist es grau und kalt und langweilig.” Mit Sympathie und Feingefühl für die Situation in Deutschland versuche ich die Kontakte zu pflegen und wenigstens ein paar gute Vibes aus der Ferne zu senden. Das wird in der Regel zum Glück auch so angenommen und wohlwollend kommentiert, während andere Bekannte hier sich schon mehrfach neidischen Anfeindungen auf Social Media ausgesetzt sahen, nachdem sie Bilder und Eindrücke vom Inselleben gepostet hatten.

Mit Familie und Freunden im Rücken versuche ich also guten Gewissens, möglichst viel aus dieser besonderen Zeit mitzunehmen. Seit einem Monat geht es endlich mehrmals die Woche in den Sprachunterricht. Thai ist keine leichte Sprache, aber selbst die einfachsten Begrifflichkeiten eröffnen eine neue Dimension der Auseinandersetzung mit dem Land und seinen Leuten, ihrer Kultur und Denkweisen. Auch wenn ich regelmäßig Gelächter ernte, macht es doch unglaublichen Spaß, sich in gebrochenem Thailändisch mit den Locals zu unterhalten.
Ob es irgendwann im Frühjahr überhaupt noch als Option erscheint, wieder in eine Großstadt zu ziehen?
Zum Glück habe ich mittlerweile auch eine Reihe von Thai-Freunden, mit denen ich üben kann. Die meisten von ihnen kommen aus Bangkok und haben internationale Schulen besucht oder im Ausland studiert; sie stellen also gewissermaßen eine interkulturelle Verbindungsbrücke dar zu der älteren Generation, die kaum Englisch spricht und sich nicht für den westlichen Lebensstil interessiert. Diese jungen, gut ausgebildeten Thais stecken ebenfalls in einer tiefen Sinnkrise, und viele von ihnen haben sich vom ganzheitlichen Yoga-Leben auf der Insel Koh Phangans anstecken lassen. Gemeinsam wollen wir um Weihnachten herum nach Bangkok reisen, ich habe sogar einen DJ-Gig bei einem kleinen Festival im nahegelegenen Badeort Pattaya bekommen.

In ruhigen Momenten versuche ich nach wie vor, meinem Uni-Abschluss näher zu kommen. Doch sich zwischen Palmen und Pad Thai auf Paragraphen und Fristen zu konzentrieren, ist schwieriger, als es sich anhört. Ob es irgendwann im Frühjahr – nach über einem Jahr auf der Insel und in der Natur – überhaupt noch als Option erscheint, wieder in eine Großstadt zu ziehen? Ich hege starke Zweifel – und meinen ausländischen Freund*innen hier geht es ähnlich. Wir sehen uns auch in der Post-Covid-Welt weiterhin als Nomad*innen. Zuhause in unserer Welt und organisiert in kleinen Communitys, die möglichst unabhängig vom System und in nachhaltiger Zusammenarbeit von Mensch und Natur leben. Das ist die Zukunft, in die ich blicken möchte.
Dieser Text ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2020. Alle Artikel findet ihr hier.