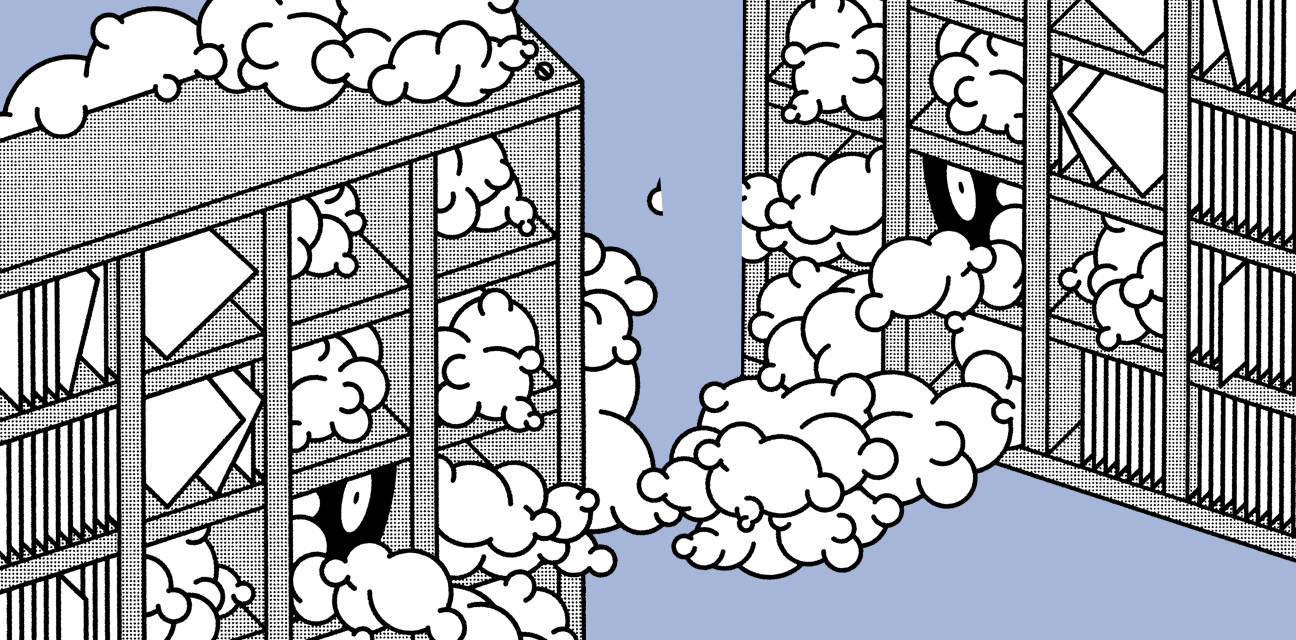Ricardo Villalobos – Matsu (Rawax)

Ricardo Villalobos gilt deshalb als Genie, weil er keines ist. Denn Genies im klassischen Sinne erheben sich über die Dinge, Villalobos aber gibt sich ihnen hin. Seit geraumer Zeit sind diese Dinge bunt blinkende Gerätschaften und auch wenn gefühlt die halbe Producer-Welt sich in den Zehnerjahren ein Doepfner-Abo gelöst hat: Am Modularsystem wird ihm niemand so schnell das Wasser reichen. Nachdem er sich zuletzt gemeinsam mit seinem immer-wieder-Studiopartner Max Loderbauer unter dem Namen Vilod im Spannungsfeld von Formstrenge und Free Jazz im Albumformat an den Maschinen spielfreudig bewies, folgen auf eine weitgehend clubkompatible EP mit Maher Daniel nun zwei Singles namens AsloHop und Neunachi auf Rawax. Begleitet wird Neunachi von einer einstündigen Live-Aufnahme, die digital veröffentlicht wird. Auf Matsu nimmt Villalobos Klangmaterial und Ideen aus den vier Stücken der beiden Maxis auf, die sich ebenfalls auf insgesamt einer Stunde Spielzeit ausbreiten. Vor allem aber lässt er aber den Dingen seinen Lauf und gibt sich ihnen hin.
Die erste Hälfte ist von einem komplexen Miteinander von Snare, Hi-Hat, Bassline und allerhand merkwürdigen Soundereignissen geprägt. Villalobos arrangiert die einzelnen Elemente miteinander, lässt die schräg verzahnten Rhythmen eine Weile laufen, tauscht dann eine Beigabe gegen die andere aus. Ein hörbar entspanntes Trial-and-Error-Verfahren, das sich ganz auf den Moment konzentriert, sich darin heillos verliert. Bis eine Kickdrum ins Klangbild poltert und so etwas wie ein Dancefloor-tauglicher Groove entsteht, dauert es schon eine gute halbe Stunde. Immerhin zieht der sich dann aber auch rund 18 Minuten hin, bevor der Track langsam in sich zusammenbricht, auseinanderbröselt und noch absonderlicher wird. In den letzten zehn Minuten läuft ein weit entfernt klingendes, offensichtlich von Vinyl abgespieltes und waghalsig schnelles Gitarrenstück, das von dumpfer Percussion und sehnsüchtigem Gesang begleitet wird. Es ist ein wundervoller Song, der ebenfalls auf der an das Hochleistungsgefrickel eines Richard Devine erinnernden B-Seite von Neunachi fast unhörbar im Hintergrund mitläuft. Sein Ursprung ist ein kleines, schönes Rätsel, und der abrupte Kurswechsel noch ein Beleg dafür, wie impulsiv und intuitiv, das heißt angenehm ungenial Villalobos’ Vorgehensweise geblieben ist. Kristoffer Cornils
Robert Hood – Mirror Man (Rekids)

Wer schon einmal mit Robert Hood gesprochen hat, weiß, dass seine Sätze wie gedruckt klingen. Kein Wort ist zuviel, die Stimme swingt warm und alles ist von einem enormen Sendungsbewusstsein getragen. Hood ist ein preacher man des Detroit Techno, und das nicht erst, seit er sich Ende der Neunzigerjahre auf ein christliches Leben besann. An der Seite von Jeff Mills und Mike Banks produzierte er als Underground Resistance um 1990 den politisierten Maschinenfunk, der aus der serbelnden amerikanischen Motorcity um die Welt ging. Mit seinen Alben Internal Empire und Minimal Nation schuf er Meilensteine elektronischer Tanzmusik. Seit Jahren feilt Hood in der ländlichen Abgeschiedenheit Alabamas an seinen Produktionen. Potenziert wurde diese Routine jetzt noch durch die Ankunft des Corona-Virus. Auf seinem neuem Album Mirror Man, das auf Matt Edwards‘ Label Rekids erscheint, greift die Hood’sche Losung: In der Beschränkung liegt die Kraft. Der cineastische Opener „Through a looking glass darkly” lässt einen eine Sci-Fi-Ruinenstadt überfliegen, nur um dann mit dem programmatischen „Nothing Stops Detroit” in medias res zu sein: Ein Schnarren hier, ein Plockern da, ein Zischen dort. Eine frenetische Stimmung pulsiert in diesen Tracks; brutal-schön in der Anmutung, rau und metallisch im Klang. Richtig gut: Das epische „A System of Mirror” und die lässige Wucht von „Face in the Water”. Überraschungen bietet Robert Hoods neues Album keine. Nur die Erkenntnis, dass dieser Sound selten so gut produziert klang. Und so aktuell. Unser Soundtrack zur Apokalypse. Bjørn Schaeffner
Ryuichi Sakamoto – Hidari Ude No Yume (Wewantsounds)

Unter dem Titel Left-Handed Dream erschien 1981 das dritte Soloalbum von Ryuichi Sakamoto. Allerdings hatte Epic Records das in Japan auf Alfa veröffentlichte Ausgangsmaterial stark für den europäischen Markt angepasst. WEWANTSOUNDS bringt jetzt ein Reissue der ursprünglichen Japanversion Hidari Ude No Yume heraus. Sozusagen befreit von allen westlichen Ästhetikvorstellungen. Und wie klingt der frühe Sakamoto dann? Weniger tiefgründig, dafür ziemlich verspielt und poppig. Und an vielen Stellen doch auffallend europäisch: Dieser ganz bestimmte Vibe, den man heute wohl einfach unter 80er-Sound subsumieren würde, klebt tief in den Rillen des Albums. Schon das Cover zieht eine Verbindungslinie zur Ästhetik David Bowies, die sich in der Unbedarftheit der Musik fortsetzt. Mindestens genauso prägnant ist allerdings der japanische Einfluss. Wieder und wieder treten Impressionen eines fiktiven, frühjährlich kostümierten Tokyos vor Augen, in dem man nie war, dass man als Entstehungsort dieser Musik aber lebhaft fühlen kann. Möglicherweise helfen mehrere Durchläufe, bis sich das voll entfaltet. Was zudem auffällt, ist der spontane, ganz unbekümmerte Charakter der Musik. Sakamoto lud eine ganze Handvoll Musiker*innen zu den Aufnahmen ein, um mit ihnen auf diversen (auch traditionell japanischen) Instrumenten zu jammen. Beim Hören hat man das Gefühl, die Lieder im Entstehen mitverfolgen zu können. Am stärksten ist der Mittelteil des Albums, „The Garden of Poppies”, „Slat Dance” oder das wirklich sehr japanische, nach Top-Notch-Anime-Soundtrack klingende, aber dennoch englisch betitelte „Dancing in the Dark”. Nach den zehn Songs packt WEWANTSOUNDS nochmal alle zehn als Instrumental Mix auf die LP. Ein spannendes Dokument aus Sakamotos frühem Schaffen, auch wenn der Avantgardismus von Hidari Ude No Yume über die Jahre doch an Leuchtkraft verloren hat. Moritz Hoffmann
S8jfou – Cynism (Parapente)

Diogenes von Sinope ist bis heute einer der berühmtesten Menschen ohne festen Wohnsitz. Sein freiwilliges Leben in Armut, zu dem auch das Übernachten in Tonnen gehört haben soll, war gelebte Philosophie, genauer: gelebter Kynismus. Nicht zu verwechseln mit dem Zynismus von heute. Bedürfnisse zu überwinden, war eines der Ziele. Dass der Musiker mit dem Künstlernamen S8jfou (gesprochen: suis-je fou) sein aktuelles Album Cynism genannt hat, ist da ein passender Tribut an den antiken Philosophen. Schließlich lebt S8jfou mit seinen analogen und digitalen, teils selbstgebauten Synthesizern und seiner Trompete in einer entlegenen, ebenfalls selbstgebauten Hütte in den Bergen. Die Klänge, die er in dieser selbstgewählten Einsamkeit findet, haben etwas vom staunenden Entdecken eines Kindes, ruhen spielerisch-selbstgenügsam in sich, können aber auch mit schroffem Beat von Wut und Trauer erzählen. S8jfou folgt darin der Tradition von eigenbrötlerischen Autodidakten wie Aphex Twin oder den freundlichen Schrulligkeiten, die auf Labels wie Pingipung ein Biotop finden. Man kann dazu intelligent tanzen oder sich eine Natur erträumen, analog wie digital. Tim Caspar Boehme
Sockethead – Harj-o-Marj (Youth)

Ganz selten ist ein Album wie großer Roman: es bildet eine Synthese privater Emotionen, subjektiver Erzählung und diverser ästhetischer Genremuster, die sich ständig wandeln und während ihres Wandels so tief mit der Gegenwart korrespondieren, dass deren Spiegelung das Kunstwerk überwältigend gestaltet. Jüngstes Beispiel: das sensationelle, aus dem Nichts erscheinende Debütalbum des in Manchester beheimateten Malers, Künstlers, DJs und Produzenten Richard Harris alias Sockethead. Harj-o-Marj erscheint auf Youth, jenem Label in seiner Nachbarschaft, das erst kürzlich mit Scorched Erden erste Album des Gunnar-Wendel-Projekts Seltene Erden veröffentlichte und mit einem abstrakt futuristischen Trip-Hop-Sampler zum in Kairo beheimateten Label Dijit für Aufsehen sorgte. Auch Harj-o-Marj bleibt der freigeistigen Haltung von Youth treu. Schwer experimentierende, elektronische Musik voll menschlicher Emotion. Produziert ohne ein auf den Gebrauchswert ausgelegtes Kalkül. Dafür mit einem großen Wissen zu all den vielen kleinen Varianten subkultureller Musik. Es gibt Momente, die klingen wie Hype Williams am Peak ihres Schaffens. Nimmt Sockethead das Mikro in die Hand, klingt er wahlweise nach Ian Curtis von Joy Division („All My Days Are Dark As Night”), Jhonn Balance von Coil („Weights, Chains & Forgetful Rememberance”), dem US-Amerikanischen Synthpionier John Bender („Hyena Clan”), Vincent Gallo („Webale”) oder Massive Attack zur Blue-Lines-Periode („Synchronicity”). Inhaltlich präsentiert er personal, neutral und allwissend Texte und minimale Reimformationen, die enorm viel Spiegelfläche für aufmerksame Zuhörer*innen bieten. Nicht zuletzt, weil seine Figuren die Ängste der Gegenwart bündeln: Einsamkeit, die Abwesenheit von Liebe, Orientierungslosigkeit, den Verlust gesellschaftlicher Solidarität und die generelle Frage nach dem Sinn in Zeiten des kapitalistischen Unsinns. Seine Worte tanzen zu verdrehten Vocal-Samples, loopigen Hip-Hop-Grooves, Cyber-Funk, hartem Jungle-Rave, Ketamin-Electro, Outsider-Folk, Tribal-Trip-Hop, rostigen Industrial-Sphären, 3D-Techno und kommen auch mal als besoffener Rap daher („Gravity Stone Ally”). Stets bereit für eine verstörende Drehung, die sich schnell wieder in den sonst gleichmäßigen Sog von Harj-o-Marj eingliedert. „He smashed the idols and quit the scene”, „Pissed and lonely” oder „Sockethead has lost touch with reality”, ist auf der Rückseite des Vinyl-Covers in der poetischen, selbstverfassten Legende zum Album lesen. Nicht weniger wird mit dem- oder derjenigen geschehen, der*die sich seinem Album hingibt! Michael Leuffen
The Black Dog – Fragments (Dust Science Recordings)

Die mit konstanter Regelmäßigkeit produktiven The Black Dog haben auf ihren neueren Alben vornehmlich Varianten von Techno durchgespielt. Mit Fragments knüpfen sie jetzt am ehesten an ihren Ambient-Klassiker Music for Real Airports von vor zehn Jahren an. Statt Schwebeflächen und Field Recordings dominieren diesmal allerdings Synthesizerpatterns. Im strengen Sinne ist Fragments auch kein Ambient-Album, sondern eine Sammlung weitgehend beatfreier oder -armer Stücke, die verschiedene Tonlagen von Dub Techno über Downtempo bis zu ins Offene mäandernden Nummern wählen. Was keinesfalls abwertend gemeint ist, ergibt die Stimmung von Fragments ein zwar loses, doch keinesfalls beliebig zusammengefügtes Bild. Alle Titel verbindet eine stark zurückgenommene Expressivität, ein Hineinhorchen in die Klänge durch Wiederholung. Dass die Platte dank Crowdfunding erst nach und nach entstanden ist und die Arbeit im Studio mit dem Ausbruch der Pandemie dem Austausch übers Internet weichen musste, hat diesen Fragmenten nicht geschadet. The Black Dog beweisen sich erneut als Langstreckenläufer, die im Vergleich zu ihren früheren Warp-Kollegen Aphex Twin oder Autechre zwar nie die gleiche Aufmerksamkeit bekommen haben, aber weiter ihren eigenen Platz im Kontinuum der intelligenten Tanzmusik behaupten. Oder wie sie selbst von sich sagen: „We make techno.” Tim Caspar Boehme