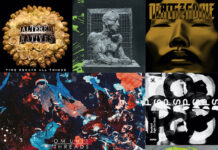Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Club-freie Zeit zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im zweiten Teil des September-Rückblicks mit Marie Davidson & L’Œil Nu, Róisín Murphy, Sophia Loizou und vier weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.
Marie Davidson & L’Œil Nu – Renegade Breakdown (Ninja Tune)

Adieux au Dancefloor war 2016, Marie Davidson, die kanadische Electronic-Abtrünnige ist zurück – mit Renegade Breakdown, das sie gemeinsam mit Pierre Guerineau und Asaël R. Robitaille (L’Œil Nu) produziert hat. Zwischen Varieté-Theater im Pariser Rotlichtviertel, Jazz-Absteige und Italo-Schmonzette klopft die Frankokanadierin auf den Genre-Mischmasch-Button, beschleicht aber auf Ninja Tune den Weg einer Musikerin, die ihre Stimme viel zu lang unter Technogeballer verbuddelt hat. „Ich hasse mich dafür, dass ich es nicht schaffe, einzuschlafen”, sagte Davidson 2019, angesprochen auf Jetlag und neverending-Solo-Touren neben Dopamindrops hinter den Decks und schlaflosen Nächten im Post-Party-Pendulum. Sie hatte schon auf Working Class Woman genug vom Club, zog sich später zurück – um „richtige Songs” zu machen. Renegade Breakdown blinzelt nur noch auf dem Opener in Richtung Rambazamba im Affenkäfig. Ansonsten weichen Kicks einem Kammermusik-Ensemble auf Speed. Die Stimme, die Texte, das ganze Drumherum schreit „Pop, Pop, Pop!” – ohne ein einziges Mal in den Pop-Baukasten zu greifen. Oder wie Davidson sagt: „I am feeling kind of lost, today I am back to rock!” Christoph Benkeser
MoMA Ready – Deep Technik (self-released)

Wyatt Stevens alias Gallery S alias MoMA Ready ist kein Unbekannter. A New Dawn hat dieses Jahr bereits eingeschlagen und beeindruckt. Die Schubladen-Einsortierer wurden nervös, weil der Typ nicht festzulegen ist. Ob wilder Jungle, Techno oder verspielte Breakbeats – alles versprüht die gleiche frische Energie und ist eben trotz aller Style- Diversität unverkennbar aus einem Guss. War der Vibe übergreifend meist ein frecher, roher und treibender, kann das neue Album Deep Technik doch wieder überraschen. Von wohlbekannten amerikanischen 80er-Vorbildern inspiriert, produziert der Wahl-New-Yorker hier nämlich Deep-House-Tracks und scheitert an der neuen Aufgabe nicht. Druckvolle, aber dumpfe Kicks verschwimmen in einem Meer von anmutig durch die Gegend gleitenden Pads, wie in „Honey Comb” oder „Feel For It”, und werden nur durch schärfere Hi-Hats im Wachzustand gehalten. Dazu dann die ein oder andere zart akzentuierende Bass-Schleife und der somnambule Meditationstanz kann beginnen. So etwas wie eine Katerstimmung entsteht allerdings nie, weil hohes Tempo und aufgeweckte Riffs wie in „Lavender” die Aufmerksamkeit schon zu binden wissen, ohne anstrengend zu werden. Bei „Tech Unlimited” bricht der verspieltere Drive früherer Werke kurz durch: Der von Lavendelduft umhüllte, Mantra-artige Dub fließt zwar weiterhin unschuldig in den Gehörgang, wird aber durch ein paar Drums ergänzt, die sich vorsichtig trauen zu scheppern und damit eine Reibungsfläche bieten, die den Track hochinteressant macht. Ein gelungenes Album, das nächste darf allerdings gerne wieder dreckiger sein! Lucas Hösel
Planisphere – Definitive Transmissions (For Those That Knoe)
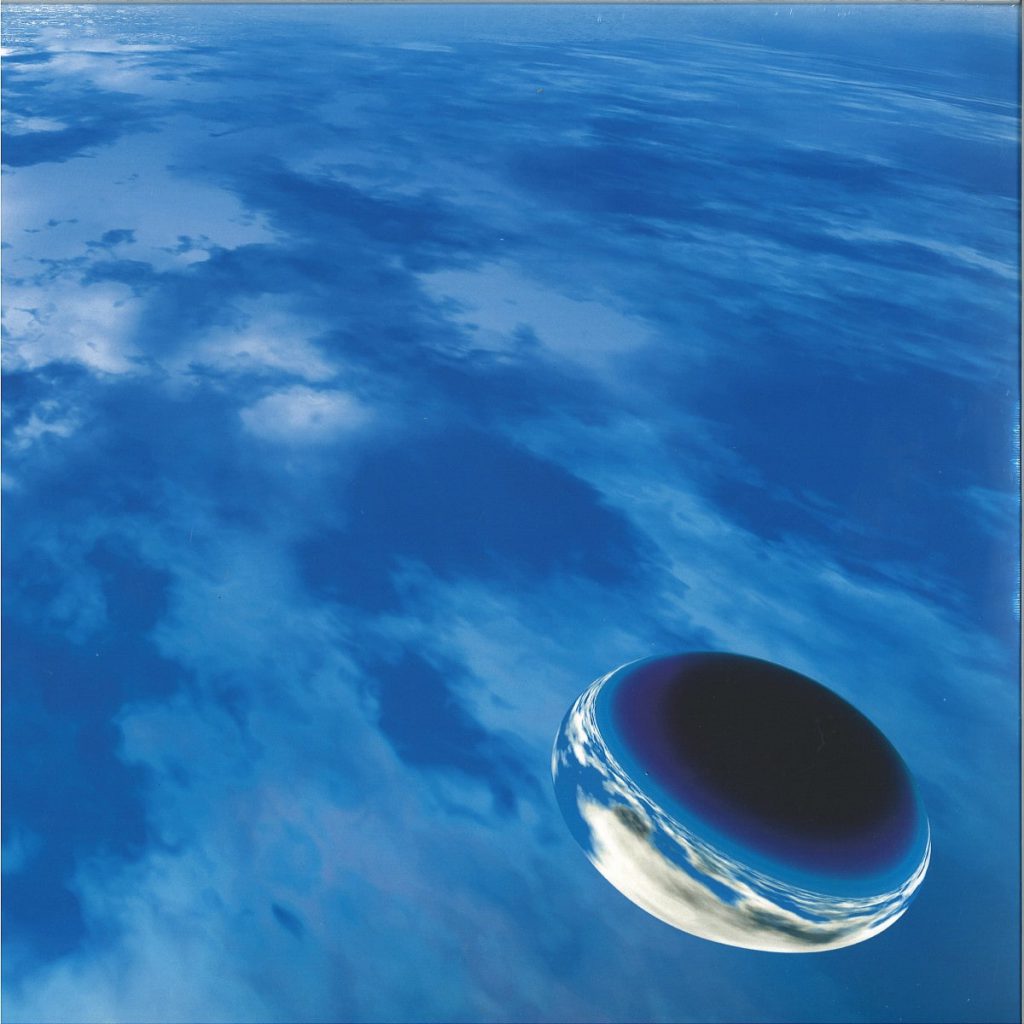
Diese Musik kommt von einem Ort weit weg, wo sich die Welt irgendwie warm anfühlt. Durch die Musik von Planisphere schimmert eine luminose Essenz, eine intime Schläfrigkeit schlummert in ihr, eine Musik, die aber trotzdem ausreichend Swing hat, um auf der Tanzfläche lange in Bewegung zu halten. Deep House war schon immer zu gleichen Teilen ein Spiegel persönlicher Vergeistigung wie ein Vehikel impliziter Körperlichkeit. Hört man sich 2020 die Tracks an, die der Australier David Swatten ums Jahr 2000 produziert an, diese smooth perlenden Sounds, erkennt manche*r Plattenkäufer*in darin eine Zeit der Unschuld, an die man sich jetzt umso sehnsüchtiger erinnert. Da ist der großartige, klassizistische Vocal-Opener „Is it Tears or Rain”, da sind die Klangbilder, die einen wie auf „Illuminate” oder „Shores” mit einer Nu-Groove-mäßigen Melancholie anwehen. Da ist „Solid Ground”, die balearisch-pazifische Ambiance einer australischen Day-Party verströmend, da ist eine Nummer wie „Moonlit Serenade”, die sich mit seiner kühl-planetarischen Anmutung leicht vom Rest der Platte abhebt. Man kann als Glücksfall bezeichnen, was der englische DJ Ben Boe auf seinem Label For Those That Knoe aus dem Archiv zu Tage gefördert hat und jetzt der Gemeinde zugänglich macht. Das Album Definitive Transmissions versammelt elf Tracks: Nur drei waren schon veröffentlicht, auf der South EP von 2000, auf weitere acht dürfen sich Exegeten des Deepen jetzt freuen. Bjørn Schaeffner
Pretty Sneaky – Pretty Sneaky (Mana)

Sehr raffiniert, was Pretty Sneaky – Identität des Urhebers derweil noch geheim – da musikalisch gestaltet. Mit sommerlich frischen Feldaufnahmen, dem Plitsch-Platsch zweier Füße, die auf dem aufblasbaren Flamingo über einen See paddeln, und Vogelzwitschern, gleich bunten Streuseln auf einem Zitronenkuchen, startet die erste der vier von 15 angenehm lichternen Ambient-Techno-Nummern. Wässrig und quirky geht es auch auf der zweiten zu, jedoch düsterer, atmosphärischer, jetzt auch mit dem Grillenzirpen des späten Abends, um dann ab der Hälfte die Richtung zu wechseln und dubbige Partymucke, vermutlich für genannte zirpende Grillen, einzusprengseln. Seite C: bisschen schneller, aber gelassen und etwas spacig verträumt. Zum Ende dann tropische Tiergeräusche. Die letzte Seite geht dann von einem IDM-igen Teil stark ins Dubbige. Insgesamt interessantes Werkchen, nicht zuletzt wegen seiner stylischen Aufmachung (kleine Bananenschale auf orangenem Grund). Lutz Vössing
Róisín Murphy – Róisín Machine (Skint)

Róisin Murphy ist vielleicht die letzte Diva der vom Disco-Soul beeinflussten Clubmusik. Seit Mitte der 1990er Jahre, als sie zusammen mit dem Produzenten Mark Brydon das Duo Moloko gründete – sie riss Brydon auf einer Party mit dem Satz „Do You Like My Tight Sweater?” auf und erklärte sich mit dieser ironisch-entlarvenden Appropriations-Methode zur reflektierten Emanzipations-Ikone –, ist Murphy eine andauernde Erfolgsstory. Ohne bisher gänzlich im aufdringlichen Mainstream zu versinken. Unvergessen ist Matthew Herberts Remix von „Sing It Back” oder das Downtempo-Stück „Night For Day”. Ihr neues Album Róisín Machine wurde zusammen mit Crooked Man alias DJ Parrot produziert und setzt gänzlich auf Disco im Edit-Gestus. „Simulation” ist ein relativ uninspirierter Disco-House-Loop auf dem sie – engelsgleich verklärt – dem*der Hörer*in vorschlägt, dass eigene Wahrnehmung und auch das Zuhören an sich Simulation sind. Mit dieser Meinung steht sie nach 40 Jahren Four-To-The-Floor-Disco-Redundanz und der Edit-Wucherung des Sounds durch die Demokratisierung der Produktionsmittel möglicherweise nicht alleine da. Bei dem Gospel-artigen „Something More” wünscht man sich tatsächlich wesentlich mehr als vorhersehbare Slowdisco-Langeweile. „Shellfish Mademoiselle” paart einen UKG-Beat mit einer Slapbass-Simulation, die an Bernard Edwards Chic-Mainstream-Pop erinnert. Dieser Basssound wird prompt zweitverwertet in „Incapable”. „Murphy’s Law” simuliert überraschend gut den Yacht-Rock-Westcoast-Ease. Den führt „Game Changer” in die Broken Beats Westlondons, die sich Murphy seit jeher aneignet. Und „Narcissus” reproduziert die Cowboy-Bauarbeiter-Feuerwehrmann-Disco im kommerz-homosexuellen Mainstream a lá „YMCA”. „Jealousy” referenziert revivalt French Filterhouse, der im Jahr 1997 die Pop-Disco der 1970er Jahre samplete. Die Grafik des Albums – Bondage, Fischnetz, toupierte, dauergewellte Haare und 80s-Make-Up – ist stringent der Electrotrash-Welle um das Jahr 2000 oder den tatsächlichen Discopunk-Roots von 1978, der NYC-Downtown-Szene, Bronx & CBGB, entlehnt. Beutet Murphy hier etwa mit der Fratze des mittelmäßigen Pop zum vierten Mal in der Musikgeschichte die Disco-Subkultur aus? Mirko Hecktor
S-File – Balance (GND Records)

Der Bremer Musiker S-File ist schon längst Teil der berühmten Stadtmusikanten des kleinen Bundeslandes im Norden Deutschlands. Seit nunmehr 26 Jahren ist der Technoveteran schon als DJ tätig. Ab 1994 zuerst mit einer eigenen Radioshow, später auch im Club. Vor ungefähr zehn Jahren hat er außerdem begonnen, selbst zu produzieren und bis dato 22 EPs herausgebracht. Mittlerweile wird S-File regelmäßig von führenden DJs der Techno-Landschaft wie Amelie Lens, Marcel Fengler oder Luke Slater gespielt. Doch trotz seines großen Outputs und seiner Erfahrung brachte er erst kürzlich sein erstes Album heraus. Balance heißt die neue Arbeit, welche als Speerspitze seiner Diskographie erschienen ist. Wenn man sich das Album anhört, merkt man schnell, dass der Name Konzept ist. S-File der neben seinem DJ-Jetset-Leben im beschaulichen Bremer Umland zuhause ist, kreiert mit seinem Album einen Balanceakt zwischen reminiszentem House, ultra fokussiertem Electro und stürmisch-melodischem Techno. Ohne dabei ins Straucheln zu geraten, fügt er die Subgenres zu einem stimmigen Club-Album zusammen. Balance startet mit einem fulminanten House-Track, der an erster Stelle klarmacht: „Things Have Changed”. Mit diesem Statement und jeder Menge Energie steigt die Hörerschaft in das Debütalbum des Künstlers ein. Angeführt von fetten, melodisch wechselnden Pads, stürmt im ersten Track ein klassisches 909-Pattern wild voran. Gekämpft wird mit den klassischen Waffen der Techno-Produzent*innen; während S-File auf dem Album zwischen Stilen springt, bildet die ikonische TR-909 das einende Glied. In vielen Titeln präsent, stellt die Drummachine gleichermaßen das Fundament zum Rave-Techno des Tracks „Restrictions” wie zum Electro-esken Titel „The Fear” dar. Wirklich Neues kommt dabei nicht zustande. Dafür aber eine Reihe fokussierter und technisch gut produzierter Tracks mit Erfolgsgarantie auf der Tanzfläche. Johann Florin
Sophia Loizou – Untold (Houndstooth)

Bisher eher unter dem Radar unterwegs, veröffentlicht Sophia Loizou nun ihr neues Album, Untold, auf Houndstooth. Begleitet von einem Gedichtband, Lesungen und audiovisuellen Performances ist es Teil eines umfassenden Projekts, in dem Loizou plant, die „Symbiose mehrerer Systeme der Erde” zu thematisieren und dazu „einladen [will], die Welt durch die Augen anderer zu sehen”. Auch unabhängig von den philosophische Ansätzen beim Produzieren ist ihr ein großartiges Album aus Ambient, Experimental und Break- und Jungle-Anleihen gelungen. Mit ihrem Sound lässt sie sich irgendwo zwischen etablierten Künstlern wie Peder Mannerfelt, Klara Lewis und Lee Gamble einordnen. Auf 42 Minuten gelingt ihr zum einen eine mitreißende, einnehmende Reise durch mystische Orte und abenteuerliche Höhen, zum anderen schafft sie ein seltenes Gleichgewicht aus kreativen Melodien, Hochglanz-Produktion und vertrauter Wärme. Insbesondere ihr Umgang mit Vocals sticht heraus und verfolgt noch Stunden nach dem Hören. Auf „Anima” und „Inner Dreams” beweist sie durch gekonntes Verzerren und Mantra-artige Wiederholung von Worten ihr Verständnis von Komposition. Die Herkunft dieser Expertise ist leicht auszumachen: Loizou ist Dozentin der Musikproduktion und promoviert gerade auf diesem Gebiet an der Goldsmith University in London. Da ist es wenig überraschend, dass eines der spannendsten experimentellen Alben des Jahres aus ihrer Feder stammt. Christoph Umhau

![[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2025/12/Alben2025_klein-218x150.jpg)