Prosumer (Foto: Presse).
Als einziger klassischer House-Act auf Ostgut Ton verkörperte Prosumer die Leidenschaft und Sehnsucht der Panorama Bar wie kein anderer Musiker. In der Biographie von Achim Brandenburg, so heißt Prosumer bürgerlich, ist Berlin aber nur eine Episode. Schon in seiner Heimatstadt Saarbrücken war er ein einflussreicher DJ. Vor sechs Jahren verabschiedete er sich aus Berlin und dem Berghain-Zusammenhang und zog ins schottische Edinburgh. Von dort aus ist er nicht nur als DJ aktiv, sondern auch als Klangtherapeut. Vor einem Gig in der Berliner Palomabar besuchte er Groove-Chefredakteur Alexis Waltz in der Redaktion, um über seine Zeit im Saarbrücker Hard Wax (ja, das gab es mal), sein ambivalentes Verhältnis zu Berlin und seinen zweiten Beruf als Klangtherapeut zu sprechen.
Heute Abend trittst Du in der Palomabar auf. Wie hast du dich auf diese Nacht vorbereitet?
Prosumer: Für dieses Wochenende habe ich so ein bisschen Multitasking gemacht, weil ich drei sehr verschiedene Sets spiele. Ich gehe davon aus, dass der Samstag technoider wird. Da spiele ich in Cardiff im Kong. Zwischendurch bin ich noch in Manchester bei einer kleinen gay night von einem Freund von mir, der eigentlich Pop hört. Insofern werden da vielleicht auch Platten wie Dee D. Jacksons „Automatic Lover” ausgepackt (lacht) – keine Ahnung. Da habe ich so ein bisschen wilder gepackt. Und für heute, für die Palomabar, natürlich housiger, so eine Mischung von Ist-gut-für-den-Anfang und Hab-ich-gerade-Bock-drauf und Sollte-ich-nochmal-spielen.
Sollte-ich-nochmal-spielen, was ist das für eine Kategorie?
Das sind Platten, die ich dort gerne mal spielen will. Ich war ja schon ein paar Mal da, das ist ein bisschen intimer vom Sound. Finn [Johannsen, Booker des Clubs] ist meine Verbindung zu dem Laden, der ist ja auch alter Houser, das geht dann im Hinterkopf in die Auswahl mit rein.
„Es gibt so viele schöne Kenny-Dope-Geschichten, die sehr hüftig sind, da habe ich, glaube ich, ein paar mit eingebaut. Was ich sonst gemacht hab, weiß ich gar nicht mehr so genau.”
Das habe ich noch nie gehört, dass ein DJ bei der Musikauswahl an seine Kontaktperson in dem betreffenden Club denkt.
Echt? Der MK-Mix von The B-52’s „Tell It Like It T-I-IS” – das ist beispielsweise eine Platte, die kann ich nicht hören, ohne an Finn zu denken. Weil ich die Platte über ihn kennengelernt habe. Die habe ich jetzt nicht dabei, aber so gibt es da Verbindungen.
Was ist eine andere typische Finn-Johannson-Platte?
Ich hatte mit Finn bei einer Washing Machine [von Terrible, Clé, Daniel Best und Dixon betriebene Partyreihe, d.Red.] damals im WMF in der Klosterstraße aufgelegt. Da hat Terrible E.S.P.s „It’s You” gespielt. Mit dem Vocal und allem, das war irgendwie so ein großer Moment. Das ist auch so eine Finn-Verbindungsplatte für mich. Terrible hat die Platte aufgelegt, aber Finn war da.

Wie gehst du im Gegensatz zu den oben genannten Abenden ein Set auf dem Love International, einen Sommerfestival an der kroatischen Riviera an? Ich war überrascht, wie hart du dort aufgelegt hast, wie gradlinig und monoton. Du hast den Engländern eine Ansage gemacht, die sie elektrisierte. In diesem sehr britischen Kontext habe ich deinen Sound als sehr berlinerisch wahrgenommen. Später wurdest du dann spielerischer und dynamischer. Dann gab es melodiöse und fast kitschige Momente, mit denen man in dem Zusammenhang nicht rechnet.
Die Stage ist mir ja ziemlich vertraut. Ich mache das schon recht lange, und ich will auch immer nur dort spielen. Die Mainstage finde ich viel unattraktiver, was auch mit dem Kiesboden zu tun hat Da kann man nicht richtig tanzen. Natürlich ist es geil, beim Auflegen auf das Meer gucken zu können. Das macht halt Spaß. Ich bereite mich darauf langfristig vor. Da merke ich dann irgendwie, dass mir manche Platten in den Monaten davor im Kopf hängen bleiben. Da bekomme ich Lust drauf, die dort zu spielen. Ob ich die dann spiele, das ist natürlich was ganz anderes. (schmunzelt) Aber auf jeden Fall gibt es da schon früh eine recht lange Liste von Sachen, die man machen könnte.
Speziell für das Love?
Ja. Sachen, die ich dafür im Hinterkopf habe, passen generell eher für Sommer und Outdoor. Was ich im Endeffekt draus mache, das ist immer so ein Produkt aus: Wo bin ich gerade? Wo ist das Publikum gerade? Was hat der DJ vor mir gemacht? Im Normalfall fang ich an mit einer Wohlfühlplatte. Letztes Jahr war das Uncanny Alliances „I Got My Education”, das weiß ich noch. Die hatte ich ganz lange nicht gespielt. Da habe ich mich selbst überrascht, dass die als erste Platte kam, weil das nicht comfort zone war. Aber auf die hatte ich da gerade Bock. Der Rest hat sich dann so daraus ergeben. Es gibt so viele schöne Kenny-Dope-Geschichten, die sehr hüftig sind, da habe ich, glaube ich, ein paar mit eingebaut. Was ich sonst gemacht hab, weiß ich gar nicht mehr so genau.
Du spielst viel alte Musik. Wie konzeptualisiert du das Verhältnis von alten und neuen Platten?
Gar nicht. Das sehen natürlich andere Leute ganz anders. Aber ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, aktuelle Musik zu spielen. Wir haben so viele Jahre von Musikgeschichte, auf die wir zurückblicken können, wo tolle Musik dabei ist. Wahrscheinlich ist bei mir prozentual alles relativ gleichmäßig vertreten. Zwar gibt es bei mir einen Neunziger-Schwerpunkt, aber ich würde mir jetzt nie sagen: Du musst mehr neue Sachen einpacken. Es gibt aber schon Sets, wo mehr Neues dabei ist, weil in dem betreffenden Bereich mehr passiert, was ich spannend finde.
„Als ich anfing auszugehen, sind mir da zum ersten Mal in meinem Leben queere Leuten begegnet. Das ist in den 80ern und 90ern wahrscheinlich den meisten Leuten noch so gegangen. Eine größere Präsenz gab es nur im Nachtleben.”
Wenn du von comfort zone sprichst: Wo liegt die? Bist du auch mal gestresst, wenn du auflegst?
Oh, immer. Da sind viele Leute, die haben Geld bezahlt, um unterhalten zu werden. Und du willst natürlich einen guten Job machen. Dass ich das 25 Jahre lang mache, ändert daran nichts. Das ist jetzt nicht so, dass mir schlecht wird und ich mich übergeben muss und sage „Nein, ich kann das nicht!”. Aber da ist schon Nervosität und eine Aufregung, und das braucht es auch: Ich feiere nicht so mit, wie das viele andere tun. Aber wenn ich da komplett cool und nüchtern dran gehen würde, würde sich das nicht wirklich mit einer Tanzfläche verbinden. Da brauchst du ja (flüstert) Aufregung.
Wo liegt dann genau deine comfort zone?
Es gibt für mich halt einfach ein paar Platten, die dort funktionieren. Das können auch Sachen sein, die ich schon lange und gerne spiele, das können Sachen sein, die für mich mit einer kleinen Anekdote verbunden sind. Da war lange eine Platte dabei, die ich mit einem Babysitter-Kind gehört habe. (lacht)
Was sind die schwierigsten Momente in deinen Sets? Was ist die größte Herausforderung?
Es gibt Abende, wo man sich fehl am Platz fühlt. Wo die Leute einfach ganz woanders sind als ich. Was natürlich auch viel mit den Veranstaltern zu tun haben kann. Wenn du dich als nüchterner Mensch zwischen Leuten bewegst, die sich komplett weggeballert haben. Da fällt es mir schwer, einen Kontakt aufzubauen.
An glatten, kommerziellen Orten ist es wahrscheinlich auch schwer.
Da ist es eher ein Authentizitätsproblem. Wenn Leute so sind, wie sie sind, dann kann ich damit meistens umgehen.

Du hast gesagt, dass du nicht mehr in Russland spielst, weil du die Verhältnisse dort problematisch findest, mit den Oligarchen und Prostituierten in den Clubs, der weit verbreiteten Homophobie und Queerphobia.
In dem Fall kann ich nicht ignorieren, dass ich in der Situation sicher bin, weil ich da bin, wo das Geld ist. Ich kann nicht ignorieren, dass es mir dort sehr anders ergehen würde, wenn ich nicht Gast aus dem Ausland wäre. Läden, wo die jungen hübschen Mädels dem Türsteher einen blasen müssen, um reinzukommen und sich dann einen Ehemann angeln wollen. Dazu kann ich nicht die Unterhaltungsmusik spielen.
Ich finde es super, dass du diese schwierige Thematik ansprichst. Es ist interessant, dass etwa der Background der Red Bull Music Academy immer wieder ausgeleuchtet wurde, dass die Strukturen hinter Clubs und Festivals aber so gut wie nie thematisiert werden. Viele DJs werden irgendwo auf der Welt von Veranstaltern gebucht, die Teil von Firmengebilden sind, die diskriminierende oder sexistische Praktiken ausüben. Andererseits kannst du als DJ oder Booker nicht den Background jeder Veranstaltung recherchieren.
Das ist ein Stück weit schon die Aufgabe des Bookers. Ich bilde mir nicht ein, dass ich alles mitkriege. Aber wenn ich sowas persönlich beobachte, kann ich es nicht ignorieren. Ich bin der Meinung: Wenn du solche Sachen mitkriegst, schadet es nicht, darauf zu reagieren. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Bei Russland habe ich dann gesagt, dass ich dort spiele, wenn der betreffende Ort ein Safe Space für Queers ist. Das hat sich aber ganz schnell erledigt gehabt.
Safe Space ist heute ein entscheidender Begriff. In den Neunzigern gab es natürlich auch den Anspruch, den die Wendung ausdrückt, er wurde aber weniger so direkt thematisiert. Was hat sich da verändert?
Ich habe mich heute mittag mit einer Kollegin darüber unterhalten, dass heute viel in der Theorie stattfindet, aber praktisch immer weniger passiert. Konkret war da früher mehr vorhanden. Als ich anfing auszugehen, sind mir da zum ersten Mal in meinem Leben queere Leute begegnet. Das ist in den 80ern und 90ern wahrscheinlich den meisten Leuten noch so gegangen. Eine größere Präsenz gab es nur im Nachtleben.
Was hat dich damals am Nachtleben fasziniert?
Das war das erste Mal, dass man einen Raum gemeinschaftlich genutzt hat. Das hört sich gerade nach Vereinsheim an. (lacht) Das gemeinsame Erlebnis der Veranstaltung, der Nacht, der Musik und allem. Dass das mit mehreren Leuten stattfand, dass sich der Kreis der Leute ständig erweitert hat. In Saarbrücken ging das noch vor der Loveparade los, noch vor dem „Das macht man jetzt so”. Das war schräg.
„Das war Musik, mit der ich mit meiner Hard Wax-Schulung – wenn auch nur Hard Wax Saarbrücken – okay sein konnte.
Der wahre Underground also.
Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Wort Underground. In Berlin wird das anders ausgesehen haben, im Saarland war das kein Massenphänomen. Sagen wir, es war Underground. Als jemand, der sich zu ganz vielem nicht zugehörig fühlte, hatte ich das Gefühl, dort besser stattfinden zu können. Das habe ich damals aber gar nicht reflektiert. Ich habe das mit dem Schwulsein auch erst spät gerafft – oder raffen wollen. Das war damals nicht aktiv Thema.
Es war eher ein allgemeines Gefühl, anders zu sein?
Es war das Gefühl: Es ist ok, dass du hier bist. Das hatte ich im Clubkontext, das hatte ich nicht in anderen Kontexten.
Im Berlin der 1990er war die Schnittmenge zwischen Techno & House und dem damals weniger queeren, sondern hauptsächlich schwulen Nachtleben verglichen mit heute eher klein. Zwar brach der Techno-Spirit mit der Homophobie der Rock- und Rap-Welt. Dennoch waren queere Menschen dort kaum sichtbar, Schwule noch eher als Lesben. Schwules Ausgehen fand in den Clubs in Mitte am Rand statt. Etwa in Form des GMF, des Gay MF sonntags im WMF, wo gelegentlich Westbam spielte.
Das wollte ich gerade sagen. Das GMF war in den Neunzigern noch qualitativ hochwertige Housemusik, nicht die Britney-Remixe, die dort später liefen. Auch wenn das das käsigere Ende war, hatte es noch einen gewissen Anspruch. Ich weiß nicht mehr, wen ich da gehört habe. Ich war 1997 in Berlin, um genau zu sein in Potsdam bei einem Sommercamp meiner Fachhochschule. Am Sonntag sind wir ins GMF im WMF, da war jemand aus New York da. Das war weit weg von Britney-Remixen. Es war Musik, mit der ich mit meiner Hard-Wax-Schulung – wenn auch nur Hard Wax Saarbrücken – okay sein konnte. (lacht)
Du hast dort gearbeitet. Heute ist es unvorstellbar, dass es mal ein Hard Wax in Saarbrücken gab.
Es gab drei Läden, der dritte neben Berlin und Saarbrücken war in Dresden. Der hat aber vor Saarbrücken aufgegeben. Die haben aber auch 1994 aufgemacht.
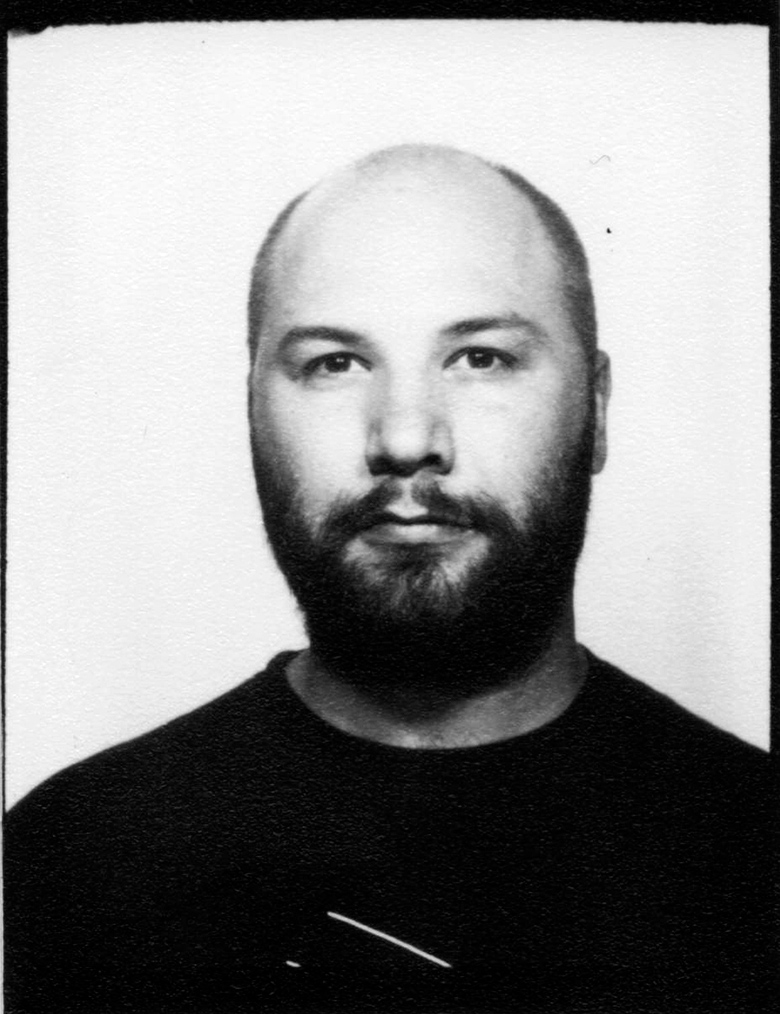
Wie ist der Laden in Saarbrücken entstanden?
Das war keine Entscheidung des Berliner Hard Wax nach dem Motto „Oh, lass uns dort mal einen Laden aufmachen”. Das war so, dass es in Saarbrücken Henner Dondorf gab, der den Laden zuerst allein gegründet hat und später mit Geschäftspartnern betrieb. Es ging damit los, dass er zum Platten kaufen nach Frankfurt gefahren ist. Da lagen dann auch die ersten GROOVE-Magazine rum. Dort hatte Henner eine Anzeige des Hard Wax gesehen. Da haben die für irgendwelche Platten geworben. Er hat eine Postkarte geschrieben: „Ich würde gerne was bestellen”. Daraufhin kam ein Anruf: „Ja, schöne Auswahl, wir hätten auch noch das und das”. Ihm wurden dann, wie man das damals gemacht hat, Platten am Telefon vorgespielt. In Saarbrücken hatten wir auch Telefonkunden und in Berlin gab es das ursprünglich auch. So kam der Kontakt zustande. Später hat Henner angefangen, für Freunde mitzubestellen. Er hatte dann Zuhause einen Mini-Plattenladen. Mark [Ernestus, Hard-Wax-Gründer] hat ihn dann darin unterstützt, einen richtigen Laden aufzumachen.
Wie bist du zu dieser Clique gestoßen?
Ich habe vorher versucht, bei Delirium in Saarbrücken Platten zu kaufen. Ich bin reingegangen, wurde von oben bis unten gemustert. Dann kam: „Ich glaube nicht, dass wir für dich das Richtige haben.”
Warum? Aus Homophobie?
Nein, weil ich ein unsicherer, unspektakulär angezogener Teenie war. Ich hatte halt keinen Daniel-Poole-Pulli und auch nicht irgendwas in Regenbogenfarben und Neon. Wenig später war ich in einem Club, da war hinter dem DJ-Pult eine LED-Leuchtschrift montiert, die wanderte. Da stand dann: „Kaufen Sie Platten mit klarem Verstand: Hard Wax Saarbrücken.” Mit klarem Verstand übersetzte sich für mich eindeutig in: „Nicht im Delirium”. Und das war auch so gemeint, das war ein pun. Da dachte ich: „Hey, da geh ich mal gucken”. So bin ich das erste Mal ins Hard Wax gestolpert. Später habe ich dort mein ganzes Azubigehalt gelassen.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Früher hieß das Druckvorlagenhersteller. Als ich das gelernt habe, hieß das Reprohersteller. Dann wurde das relativ schnell Mediengestalter print und digital.
Du bist also Grafikdesigner.
Ja. Ich habe im Hard Wax dann einen großen Teil meiner Zeit verbracht und mein ganzes Geld gelassen. Ich habe angefangen, auch mal was rüberzureichen, wenn jemand nach Platten gefragt hat. Irgendwann hieß es: „Kannst du mal eine Urlaubsvertretung machen?”
Das Nachtleben muss toll gewesen sein in Saarbrücken. Ich hab gelesen, wen du alles dort erlebt hast, New-Jersey-House-Legende Tony Humphries zum Beispiel. Was für Läden waren das?
Es gab größere Geschichten, die dann in der Kongresshalle stattgefunden haben. Dann gab es das Kühlhaus, die haben jetzt wieder unter einem neuen Namen geöffnet, das hieß lange Mo Club. Dann gab es das Hertz, das war echt super. Da hatte ich viele tolle Gigs.
„Die im Laden haben da auch einen guten Job gemacht, wichtige Platten in großer Stückzahl zu bestellen. Bis in die späten Neunziger konntest du da noch die eine oder andere Prescription normal kaufen.”
Da hast du auch selbst schon aufgelegt?
Ja. Blake Baxter war der erste größere DJ, für den ich Warm-up gemacht habe. Davor habe ich in einer kleinen Bar aufgelegt.
Wann hast du dir Plattenspieler gekauft?
Das habe ich tatsächlich erst in Edinburgh geschafft, ich habe nie Technics besessen. Ich habe mit dem Plattenspieler meiner Eltern mixen gelernt, wo man so ein kleines Dreh-Rädchen hatte, mit dem man den Pitch um ein paar Prozent verändern konnte – oder mit dem Finger die Platte langsamer machen.
Du warst virtuos.
Nein, ich kenne genug Leute, bei denen das genauso war, bei denen nicht in die Technics investiert wurde, sondern in die Platten. Man hat sich dann im Plattenladen festgesessen, und irgendwann gesagt: Darf ich mal an die Plattenspieler? (grinst) Um da dann halt ein bisschen zu mixen. Aber zurück zum Hertz; das war ein Superladen. Da habe ich viele, viele Leute gehört. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bestimmte Platten dort zum ersten Mal erlebt habe, „Altered States” von Ron Trent zum Beispiel.
Wer hat diese Platte gespielt?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich kriege nach wie vor Gänsehaut. Auch so Sachen wie die erste MMM, da kann ich mich auch noch an den Abend erinnern, als die dort das erste Mal lief. Im Hertz hatte ich gute Zeiten. Sollte man nicht meinen, was das Saarland mal zu bieten hatte. (lacht)

In einer Stadt mit 180.000 Einwohnern.
Die Grenzregion hilft da. Da kamen viele Franzosen zum Feiern, die Détroit (verwendet französische Aussprache) – Detroit – hören wollten. So war der Einzugsbereich ziemlich groß. Das galt dann auch für den Plattenladen. Viele Kunden kamen von weiter her, Paul David [Rollmann, Even Tuell, d.Red.] war zum Beispiel oft da, schon bevor es mit [dem Taschenlabel] Airbag Craftworks so richtig losging. Die im Laden haben da auch einen guten Job gemacht, wichtige Platten in großer Stückzahl bestellt. Bis in die späten Neunziger konntest du da noch die eine oder andere Prescription normal kaufen. Die konnten noch sehr lange Leute mit ungewöhnlichen Sachen glücklich machen.
Wann bist du dann nach Berlin gezogen?
1999. Ich habe dort aber nicht gleich im Hard Wax gearbeitet, das kam erst viel später.
Das war eine schwierige Zeit für das Berliner Nachtleben.
Aus der Smalltown-Perspektive war das total aufregend. Als ich hier gelandet bin, war das die Zeit von Jazzanova und dem Sonar Kollektiv. Das waren die Jahre, die ganz toll waren für das WMF. Dann gab es ja noch die Electroclash-Entwicklung, das war dann weniger meins.
„Irgendwann dachte ich dann, ich bin jetzt Resident. Das war damals noch nicht so wie heute oft, dass die Clubs die Residents für das Jahr ankündigen. Das gab es damals noch nicht. Irgendwann haben wir uns das gefragt: ‚Sind wir eigentlich Residents?‘ ‚Ich denke schon.’”
Wann hast du das Ostgut entdeckt?
Relativ spät. Wirklich erst relativ spät. Ich war damit ein bisschen überfordert. Bei meinem ersten Besuch war ich so: „Oh Gott, die haben Sex da!”
Das habe ich auch als krass empfunden, aber natürlich hat mich das als Hetero nicht direkt berührt. Ich hab es insgesamt als befreiend empfunden, auch, dass es nicht wie in den Clubs in Mitte um das Sehen und Gesehen werden ging, um Szene, sondern um das Feiern mit Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun hatte.
Als ich da das erste Mal hin bin, hatte ich immer noch die Vorstellung, dass ich irgendwann mal Frau und Kinder haben werde. Das hatte mit mir zu viel zu tun, als dass das eine comfort zone hätte sein können. Dann wurde mir auch relativ schnell klar, wie der Hase läuft.
Du hast dich da als schwuler Mann gefunden?
Nein, das war zuviel, als dass man da mal kurz den Zeh reinhält. (lacht) Das hat mich erstmal überfordert. Aber es war dann unignorierbar. Wie du sagst: du kannst da hingehen, ohne dass es dich unmittelbar berührt. Das war relativ klar, dass ich das nicht sagen konnte. Das war: „What the fuck is going on?”
Wie hast du angefangen, dich in Berlin als DJ zu etablieren?
Ich habe mit Leuten von der Uni in Potsdam Partys gemacht. Ich habe da Kommunikationsdesign studiert.

Dein Berufswunsch war damals noch Designer zu werden?
Während dem Studium habe ich ein Jahr in der Werbung gearbeitet. Nach einem Jahr war klar: „Ne, das mach ich auf keinen Fall.” Ich habe mit Leuten von der FH Potsdam Veranstaltungen in Berlin gemacht, auch im Weekend. Für mich zu Hause hab ich auch Musik produziert.
Aber relativ ambitioniert.
Ne.
Du hast Tapes geschnitten und so dein eigenes Analog-Sequencing gemacht.
Ich habe damit meine Zeit verbracht und so mein Leben gefüllt. Es gab eine Verbindung zwischen dem Hard Wax Saarbrücken und [dem britischen Minimal-Duo] Swayzak. So kam es zu einem Release auf deren Label 240 Volt. Und dann war ein bisschen mehr Selbstbewusstsein da, und ich habe mich überwinden können, etwas an Playhouse zu schicken. Und das, obwohl ich da so schrecklich gesungen habe. (lacht) In der Zeit habe ich auch Thilo [Schneider, ehemaliger Groove-Redakteur und Redakteur des Berghain-Flyers] kennengelernt. Dann machte auch das Berghain auf, bzw. zuerst ja nur die Panorama Bar. Da fand die erste Playhouse-Labelnacht statt. Ata war aber krank, er konnte nicht spielen und hatte genug Vertrauen, mich als Vertretung zu engagieren.
„Der Text von „The Craze”: ‚Join me on the dancefloor, won’t you dance with me?‘ Das war für den Achim, der das geschrieben und gesungen hat, absolut undenkbar.”
Hatte er dich schon mal gehört? Du hattest in Berlin noch keinen Ort, an dem du regelmäßig gespielt hast.
Ab und zu im Weekend. Ich glaube aber nicht, dass Ata mich schon mal gehört hatte. Aber Ata hatte über Saarbrücken und das Hard Wax schon von mir gehört. Von den Frankfurtern sind genug mal nach Saarbrücken gekommen zum Plattenauflegen – oder er hat einfach niemand anders gefunden. (lacht) Jedenfalls kam dann am Tag davor der Anruf, und ich habe das dann gemacht. Ich glaube Thilo, der ja auch im Booking involviert war, war damit auch einverstanden. So bin ich das erste Mal als DJ in der Panorama Bar gelandet. Dann haben sie mich einen Monat später nochmal gefragt und dann nochmal. Irgendwann dachte ich dann, ich bin jetzt Resident. Das war damals noch nicht so wie heute oft, dass die Clubs die Residents für das Jahr ankündigen. Das gab es damals noch nicht. Irgendwann haben wir uns das gefragt: „Sind wir eigentlich Residents?” „Ich denke schon.” (lacht)
Deine frühen Platten auf 240 Volt und Playhouse waren noch ziemlich streng, da gab es neben dem Deep-House-Moment auch noch dieses sehr strukturierte Minimal-Moment, das später aus deiner Musik verschwunden ist. Später hast du dich geöffnet und selbst gesungen. Auch durch die Kollaboration mit Murat Tepeli entstand eine neue Freiheit. Wie ist der dir begegnet?
Murat hatte ich schon in Saarbrücken im Hard Wax kennengelernt, der hat dort Medizin studiert. Der ist dann von Saarbrücken nach Köln gezogen, als ich in Berlin war. Dann haben wir uns nur noch gelegentlich gesehen, wenn man mal gleichzeitig in Saarbrücken war. Murat hatte dann irgendetwas produziert und Roger23 vom Hard Wax sagte zu ihm: „Schick das doch mal Achim.” So hat sich das ergeben. Wenn du sagst, mein Sound und mein Musikmachen hat sich geöffnet in dieser Zeit, ist das ziemlich zutreffend. Ich hatte halt jahrelang vor mich hingesumpft. Berlin war noch billig, man hat nicht viel machen müssen, um überleben zu können, und ich hab das eher schlecht als recht getan. Ich war hochgradig depressiv und habe vor mich hingewurschtelt.
Was hast dich so unglücklich gemacht?
Wo Depression so herkommt: Veranlagung und nicht gelernt zu haben, mit sich umzugehen. Dass Berlin auch viel Unschönes hat, dass die Stadt einen auch ganz schön runterziehen kann, das muss man niemandem groß erklären. Dabei wollte ich nirgendswo anders sein. Wenn man sich den Text anhört von „The Craze”: „Join me on the dancefloor, won’t you dance with me?” Das war für den Achim, der das geschrieben und gesungen hat, absolut undenkbar. Denkst du, irgendjemand interessiert das? Ne.
Und durch das Booking in der Panorama Bar war auf einmal alles anders.
Dass ich mit diesem Selbstausdruck in der Panorama Bar stattfinden durfte, das hat ganz viel in mir verschoben. Dann kam dazu, dass ich irgendwann gerafft hab: „Ja, ich bin dann wohl doch schwul.” Und dass ich das irgendwann angefangen habe zu leben. Endlich gab es Dinge, die ich mit meiner Zeit tun konnte. Dinge, die ich gut und schön fand. Wenn du sagst, da war eine Verschiebung in der Musik drin, dann kann das durchaus das gewesen sein. (lacht)

Du hast damals ja viele verschiedene Projekte gehabt. Da waren deine eigenen Produktionen, du hast mit Murat und Elif zusammengearbeitet und auch noch mit Tama Sumo einen ganz anderen Sound verfolgt. Das war eine kreative Explosion.
Ja, in der Tat.
In den letzten Jahren hast du aber gar nicht mehr veröffentlicht. Wie schaust du auf diese Zeit zurück?
Ich arbeite ja auch als Klangtherapeut, bin Gongmaster und dieses ganze Gedöns. Der künstlerische Ausdruck, der der Antrieb war, Musik zu machen, der geht jetzt komplett in die Gong-Geschichte rein.
Und ins Auflegen?
Das ist was anderes. Wenn du selbst Musik machst, ist das etwas anderes als aufzulegen.
Viele sehr aktive DJs leiden darunter, dass sie früher, vor dem Erfolg, mehr produziert haben. Dabei ist der ständige Austausch mit den Crowds, für die sie spielen, auch eine kreative Tätigkeit. Das ist der Ausdruck, den man gewählt hat.
Das ist nicht der gleiche Ausdruck. Für mich ist Auflegen – klar – Ausdruck. Da fließt meine persönliche Emotionswelt rein und wie ich mich durch den Abend bewege. Das findet aber immer im direkten Zusammenspiel mit dem Publikum statt. Ich hatte das schon, dass eine Platte in dem „Ach, könnte man jetzt mal demnächst spielen”-Stapel stand und dann Leute kamen, die gesagt haben: „Hast du die zufällig dabei?” Wenn du das eine Weile tust, begreifst du, dass da etwas gemeinsam passiert. Da hab nicht nur ich die Idee, da hat auch irgendjemand anders auf der Tanzfläche dieselbe Idee. Das sehe ich dann immer mehr als ein Gemeinschaftsprodukt. Wenn du da wirklich mit Geräten am Start bist, ist das anders.
„Für persönlich war das auf jeden Fall gut, mich zu verändern und mich von Berlin wegzubewegen. Das war aber nie ein: Berlin ist scheiße, ich will hier nicht mehr sein.”
Das Produzieren scheint bei dir auch mit Berlin verbunden zu sein. War diese Episode mit dem Umzug vorbei?
(denkt nach) Vielleicht. (lacht) Das war ja nie eine bewusste Entscheidung, das war auch immer eine Kombination. Ist ja immer die Frage: Findet man die Zeit nicht oder nimmt man sich die Zeit nicht? Das kann ich dir nicht beantworten, ob die Zeit nicht da war oder ob ich sie mir nicht genommen habe. Ich habe die Vermutung, es hatte einfach keine Priorität. Mit einem Umzug ist natürlich immer eine Neusortierung fällig.
Die meisten DJs ziehen nach Berlin, du bist aus Berlin weggezogen. Die meisten halten an ihrem Mutterschiff fest, du hast dich vom Berghain bzw. von Ostgut Ton getrennt. Das hat dir eine Freiheit gegeben. Du stehst jetzt mehr für dich. Das war eine Emanzipation.
Für persönlich war das auf jeden Fall gut, mich zu verändern und mich von Berlin wegzubewegen. Das war aber nie: Berlin ist scheiße, ich will hier nicht mehr sein. Das war ein Verschieben von Prioritäten. Berlin verändert sich. Und das, was ich toll fand, findet immer weniger statt. Und: Es gibt auch was anderes. (lacht)

Was hast du in Edinburgh, was du in Berlin nicht hast?
Es ist eine Entschleunigung, ich habe viel mehr Lebensqualität gewonnen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute in Berlin meistens auf dem Sprung sind. Ich konnte viele Beziehungen und Freundschaften aus der Berliner Zeit intensivieren, weil die mal fünf Tage in Edinburgh waren, und man da mehr quality time miteinander verbringen konnte als in der Zeit, als wir gleichzeitig in Berlin gelebt haben. Man ist verabredet und textet dann aber, dass man doch eine Stunde später kommt. Und eigentlich ist man eh auf dem Weg von hier nach da. Das findet zumindest für mich in Edinburgh nicht statt. Ich habe das Gefühl, ich lebe dort wesentlich bewusster, und ich erlebe alles um mich herum wesentlich bewusster. Ich bin gerade umgezogen. In meiner Gegend gibt es viele Parks und Gärten. Für 20 Pfund im Monat kann ich den schönsten und größten Park von Edinburgh mit einem tollem Ausblick zur ganzen Stadt und zum Meer hin nutzen. Das Geld wird dann dafür verwendet, um den Park zu pflegen. Sowas kann man sich in Berlin nicht vorstellen. Ich bin vorhin mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt gefahren – und da hatte halt jemand in den Bus geschissen. (lacht)
Das habe ich oft, wenn ich aus irgendeiner anderen Stadt nach Berlin zurückkomme. Der Berliner Busfahrer ist auf jeden Fall unfreundlicher als der in jeder anderen Stadt und über vielen Fahrgästen liegt ein melancholischer Schatten. Damit muss man fertigwerden.
Hier ist vieles toll, aber auch vieles scheiße. Du siehst viele Leute auf der Straße, wo du denkst „Mensch, Dir geht’s nicht gut”. Ich glaube, du musst anfangen, das automatisch herauszufiltern, sonst kommst du nicht klar. Nachdem ich beispielsweise hier eine Weile nicht mehr gewohnt habe, rieche ich, wie stark es hier im Sommer nach Scheiße stinkt. Man geht mit dieser Stadt nicht freundlich um, auch wenn man hier lebt.
War das für dich als DJ auch ein Bruch, weniger in Berlin und Deutschland zu spielen und mehr in Edinburgh und UK?
Bruch würde ich nicht sagen, das war eine Verschiebung. Musikalisch hat sich das inzwischen ein bisschen relativiert. Joes „Claptrap” ist eine Platte, an der ich ganz viel festmachen kann. Damit hat man hier am Anfang die Tanzfläche geleert, während das in UK natürlich überhaupt nicht der Fall war. Das ist anders geworden, in der Zeit ist in Deutschland ganz viel passiert. Aber in der Zeit, in der ich hier weg bin, da war vieles, was souliger oder funkiger ist zwar nicht unbedingt ein Problem, aber etwas, um das du kämpfen musstest, wenn du es unterbringen wolltest. Zu dem Zeitpunkt war in UK da mehr möglich.
„Wenn sich meine Eltern als ich Kind war gestritten haben, habe ich Musik angemacht. So bin ich wahrscheinlich DJ geworden.”
Als letztes Thema: Die Gong Meditation. Was bedeutet dir das?
Zu Berliner Zeiten habe ich eine Ausbildung als Mediator gemacht. Ich glaube, dass ich angefangen habe, die Dinge aufzuarbeiten, die man im Leben so mit sich rumträgt, die bei mir auch die Depression ausgelöst haben. Ich habe Therapie gemacht. Es gibt bei vielen im Leben den Punkt, wo man darüber nachdenkt, wie man sich irgendwelche Ressourcen heranpackt, wie man mit verschiedenen Sachen besser umgehen kann – egal ob man jetzt Yoga anfängt oder sonst was. So kam halt diese Ausbildung.
Was hast du da gelernt?
Das war meine erste Begegnung damit, Menschen einen unterstützenden Rahmen zu bieten. Und ihnen zu helfen, Dinge, die verhakt und verknotet sind, zu lösen. Im Mediationskontext sind das meistens Konfliktsituationen. Wenn man mit einer Situation nicht zurechtkommt, verengt sich der Blick und du hörst nur noch die Alarmglocken, die sagen: Alles Scheiße! Das Drumherum nimmst du gar nicht mehr so richtig wahr.
Und wie schreitest du da ein?
Diese Fokusveränderung versuchen wir als Mediatoren rückgängig zu machen. Wir geben den Leuten das Gefühl, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie unterstützen. Das bringt in der Meditation Leute dazu, dass das Feld wieder aufgeht und du auf Ressourcen zurückgreifst, von denen du vergessen hast, dass du über sie verfügst. Nicht mehr: „Du Arschloch.” Sondern: „Wir hatten schon mal was Ähnliches, das haben wir so gelöst.” Diese Verschiebung ist mir da zum ersten Mal begegnet. Wenn man da dabei sein darf, ist das ziemlich toll. Das macht einfach Spaß. Von da habe ich mich weiter fortgebildet. Zuerst kam die Hypnotherapie dazu. Es gibt zu diesem Ansatz eines lösungsfokussierten Raums ganz verschiedene Ansätze. Ein anderer ist die Klangtherapie.
Hast du in dem Feld auch schon in Berlin gearbeitet?
Ich habe das zuerst für mich gemacht. Ich brauchte ein breiter aufgestelltes Skillset. Heute verbinde ich verschiedene Sachen. Ich hab auch eine Zusatzausbildung für Trauma-Support gemacht. Für mich, der sein ganzes Leben mit Sound und Klang verbracht hat, ist es natürlich naheliegend, therapeutisch mit Klängen zu arbeiten. Wenn sich meine Eltern als ich Kind war gestritten haben, habe ich Musik angemacht. So bin ich wahrscheinlich DJ geworden. Wenn jemand Gong spielt, kann ich mein Hirn mit all dem, was die ganze Zeit vor sich hin quatscht, ausschalten und wirklich tiefenentspannen.

Wie läuft das ab mit dem Gong?
Ich mache als freier Therapeut Eins-zu-eins-Arbeit, aber auch Gruppen mit bis zu 35 Leuten. Die biete ich in Yogastudios an. Bei einer Gruppe arbeite ich mit einer Yogalehrerin zusammen, wo verschiedene Themen und eine geführte Meditation oder eine Visualisation Ausgangspunkt sind, wo man gemeinsam schaut, wie man über Körperarbeit zu dem Problem, das man hat, Zugang gewinnen kann. Am Ende steht dann das Gongbad von mir. Wenn ich Eins-zu-eins-Arbeit mache, wende ich Coaching-Techniken an. Im Endeffekt geht es um die Fragen: Wie könnte es dir besser gehen? Was wünschst du dir in deinem Leben? Wie würde das konkret aussehen? Und wenn das so wäre, wo spürst du das? Wenn du Leute eingeladen hast, Sachen nicht in ihrem Kopf auszumachen, sondern in ihrem Körper, und du den Menschen danach Entspannung ermöglichst, passiert auf einmal ganz viel.
Wo kommt da der Klang ins Spiel?
Ich spiel Gong, den Hauptteil der therapeutischen Arbeit mache ich mit Gongs und anderen Instrumenten, Klangschalen, Rasseln. Dabei bereite ich die Leute auf den Klang des Gongs vor, weil der sehr intensiv sein kann. Die Hauptarbeit findet aber mit dem Gong statt. Viele Leute nehmen das als Wow-Moment wahr.
Du drückst etwas mit dem Gong aus, was du nicht anders ausdrücken kannst?
Nein. Man spielt den Gong so, dass ihm zuhört. Ich hab Erfahrungen mit dem Instrument, ich weiß, wie ich was erreichen kann. Es ist aber so, dass ich mich eher aus der Situation des Vorgesprächs leiten lasse. Ich frage die Leute zum Beispiel, ob sie die beste Freundin treffen wollen, die ihnen die Meinung geigt, oder die beste Freundin, die sagt: „Du arme, du hast ja so recht.” Dann weiß ich, ob ich den Gong so oder so spiele. Das mache ich dann und wenig später bin auch ich in einer Trance.
Wie beim Auflegen.
Ja. Ich weiß, was ich am Anfang machen könnte, und was ich in meinem Repertoire habe. Dann fang ich mit irgendwas an, und dann ergibt sich daraus was. Und am Schluß hatte man ein Erlebnis.
Du spielst etwas vor, das heilsam ist?
Ich würde nicht sagen, dass ich etwas vorspiele. Es ist ein starkes Reagieren auf den Gong. Ich höre wirklich dem Gong zu und reagiere mehr auf den, als dass ich ihn spiele. Viele haben dann eine Art Erleuchtung. Die sagen: „Ich hatte keine Ahnung, dass ich so entspannen kann. Es ist häufig so, dass Leute absolute Aha-Erlebnisse haben und sagen: „Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.” Es gibt auch Leute, die schlafen ein. Auch das ist gut.





