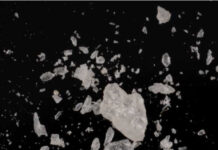Foto: Shawn Tron (Avicii)
Letzten Freitag wachte ich um 1 Uhr morgens deutscher Zeit in Kyōto auf und fiel am Samstagabend gegen 22 Uhr erschöpft in mein Berliner Bett. 10 000 schlaflose Kilometer hatte ich zurückgelegt, verteilt auf Hochgeschwindigkeitszüge und drei verschiedene Flüge, die mir wenig Beinfreiheit und noch weniger Zeit zur Erholung ließen. Als ich zwischen den Stopps in den Wartebereichen der Flughäfen von Nagoya, Helsinki und Berlin meine Social-Media-Apps öffnete, ging es vor allem um ein Thema: Avicii, der EDM-Produzent und -DJ Tim Bergling, war tot in Maskat im Oman aufgefunden worden.
Auf den ersten Blick mag meine persönliche Reise- und Leidensgeschichte in den Economy-Classes dieser Welt wenig mit dem tragischen Ableben des schwedischen Superstars zu tun haben. Aber durch die Social Media-Posts von bekannten Underground-DJs wie Honey Dijon ließ sich vor allem ein Tenor herauslesen: Es hätte uns allen so gehen können. Da eben findet sich die Schnittstelle zwischen meinem vom Jet Lag und miesem Flugzeugaufwärmfraß gebeutelten Körper und der Geschichte Aviciis, die zugleich näher an der Lebensrealität vieler DJs angesiedelt ist, als einige es zuerst glauben mögen. Denn was ich als Urlauber über mich ergehen lassen musste, das ist für nicht wenige in unserem Business der harte Alltag. Umso mehr noch: Von mir erwartet niemand, dass ich zwei Stunden lang vor tausenden Menschen Gas gebe, mir für Meet and Greets ein Grinsen abzwänge und zum Abschluss noch für einen rührseligen Dankespost auf Instagram posiere – bis zu über 100 Mal im Jahr.
Wer heutzutage als DJ erfolgreich ist oder sein will, muss dafür einiges wegstecken – sowohl körperlich wie auch geistig. Je größer der Erfolg, desto höher auch der damit einhergehende Druck, die Einsamkeit, die Entfremdung. Und wer sowieso schon angeschlagen ist – siehe unser „Stress, lass nach!“-Special in der Groove 169 – ist von vornherein geradezu ausgeschlossen. Es geht noch weiter: Aussetzer dürfen dabei nicht sein, denn sonst drohen Spott und gegebenenfalls sogar wirtschaftliche Einbußen. Wer versagt, bekommt selten eine zweite Chance. Das ist die knallharte, durch und durch neoliberale Realität unserer Szene – ob nun im selbsternannten Underground oder in der oberen Riege der EDM-Community. Es macht kaum mehr einen Unterschied, ob jemand mit dem Charterjet zum Tomorrowland düst oder sich mit der Plattentasche auf dem Schoß in einen RyanAir-Flieger zwängen. Es ist beides belastend, First Class oder nicht.
Als Bergling im März 2016 das Ende seiner Karriere als Live-Act – nicht allerdings als Produzent – ankündigte, spielten dabei wohl auch die gesundheitlichen Probleme mit rein, die ihn bereits zwei Jahre zuvor dazu bewegt hatten, eine Konzert-Tournee abzusagen. Angeblich resultierten diese Probleme aus dem übermäßigen Alkoholkonsum des damals 25-jährigen. Eine Berufskrankheit, hüben wie drüben. Drogen sind unserer Szene allgegenwärtig, siehe unsere Titelgeschichte in der Groove 157. Nicht selten werden sie zur Leistungssteigerung verwendet – DJs nicht ausgenommen. Spaß zu haben ist schließlich Teil des Jobs, ob nun hinter den Decks oder vor den Kameralinsen der Smartphones, die in quasi jeder freien Minute auf sie gehalten werden.
Auch darauf wurde mit Spott reagiert. Mehr als zynisch, schlichtweg unmenschlich lasen sich einige der Kommentare, als Avicii öffentlich über seine angeschlagene Gesundheit sprach. Als „Pussy“ bezeichnete mich ein britischer Techno-Produzent, als ich ihn in einer Diskussion darauf hinwies, dass ich seinen Hohn über Berglings Aussagen keinesfalls teilen könnte. Symptomatisch, denn so sieht es wohl eben aus: Wenn uns jemand in szeneideologischer Hinsicht nicht passt, nehmen wir auf seine Leiden keine Rücksicht, sondern drehen ihm einen Strick draus. Hallo, Ellbogengesellschaft. Eine Reaktion, die bezeichnend für die verkorkste Mentalität einer Szene steht, in welcher Selbstausbeutung zum idealisierten Standard erhoben wird.