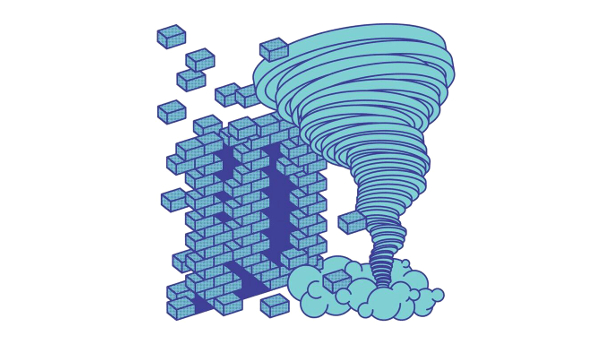Illustration: Super Quiet
Erstmals erschienen in Groove 158 (Januar/Februar 2016)
„What happens in Ibiza stays in Ibiza“ oder auch: „What happens in Vegas, stays in Vegas“. Einige kennen noch diese Losung fürs Nachtleben, das die elektronische Clubkultur wie einen diskret-eleganten, dicht gewebten Mantel über die vergangenen Jahrzehnte trug und eigentlich nichts anderes besagte als: Feiern, die Nacht, die Entgrenzung ist was Privates, das man in diesem einen Moment mit den anderen anwesenden Menschen teilt und die Erinnerung (wenn es denn eine gibt) das Einzige ist, was den erlebten Hedonismus am Leben hält. Es war mythisch und flüchtig. Man wusste nicht, was und wie genau der DJ die Musik zauberte, wo diese Musik herkam. Es war aber auch egal. Es ging um den perfekten Moment, der dann schon wieder vorbei war, wenn man ihn erkannt hatte. Die Zeit der Clubkultur vor Big Data und Social Media muss man nicht, aber kann man romantisieren. Doch seit einiger Zeit wird die DJ- und Clubkultur aus diversen Perspektiven neu durchleuchtet. Richie Hawtin twittert seine live gespielten Tracks in Echtzeit, DJs posten Tonnen an Instagrams aus Hotels, Flughäfen, Backstages und anderen exklusiven Orten und bedienen die gleiche Sozialneidlogik wie Kim Kardashian und Paris Hilton. Die mediale Aufarbeitung eines Festivals kann mittlerweile mehr Zeit in Anspruch nehmen als das Festival selber. Alles Dinge, die Anfang des Jahrzehnts im Zirkus keinerlei Relevanz hatten. Und natürlich steht auch das Social-Media-Mitteilungsbedürfnis der DJs und Künstler im Fokus der Community-Betrachtung.

Der Twitter-Blog DJs Complaining repostet beispielsweise fleißig Erste-Welt-Leiden von viel reisenden DJs (schlechte Airlines, langsames Internet und miserables Essen stehen hier im Vordergrund), wofür der Rest der Welt selbstverständlich nur ein trauriges Kopfschütteln übrig hat. 2015 war aber auch das Jahr, in dem Statements von Künstlern zum politischen Diskussionsobjekt wurden und viel Buzz erzeugten. Vor allem die Causa Ten Walls sorgte im Juni für Wirbel. Der litauische Producer Marijus Adomaitis outete sich auf seinem privaten Facebook-Account als homophober Vollidiot, der Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzte. Seine Karriere wurde daraufhin systematisch unter dem Deckmantel der Political Correctness und Moral öffentlich auseinandergenommen. Festivals sagten seine Bookings ab, vermeintliche DJ-Freunde, Labels, Plattenläden distanzierten sich via Twitter und Co. von ihm. Spott und Häme spielten bei dieser medialen Lynchjustiz genauso eine wesentliche Rolle wie das Zurschaustellen einer angeblichen moralischen Überlegenheit. Das Motto: Clubkultur ist ohne afroamerikanische und schwule Subkulturen in den USA der Sechziger/Siebziger nicht vorstellbar. Rassismus, Sexismus und Homophobie haben hier keinen Platz.
Das ist gut so und sollte auch so sein. Allerdings spricht hier eher ein nostalgischer Wunschtraum als die Realität. Handelt es sich bei der elektronischen Musikszene doch (wie in vielen anderen Bereichen auch) um eine von weißen, heterosexuellen Männern dominierten Szenerie, die von den gleichen kapitalistischen Wachstumsgedanken angetrieben wird wie die Mode- oder Autoindustrie. Der Fall Ten Walls war dieses Jahr im Shitstorm-Reigen keine Ausnahme, auch wenn er ohne Zweifel der drastischste gewesen ist. Das gehypte Label Berceuse Heroique geriet unter Beschuss, als es über Twitter misogyn-sexistische Kommentare teilte. Es gab einen Aufschrei, als die englische Künstlerin GFOTY (Girlfriend of the year) für Noisey als Festivalreporterin fungierte und einen Act als „schwarze Version des Bombay Bicycle Club“ beschrieb. Ihr Label PC Music distanzierte sich umgehend von ihr. Boddika rantete über Twitter, wie unerträglich es wäre, dass man in Restaurants in England keine englischsprachigen Bedienungen mehr fände. Und Levon Vincent wurde zur Persona non grata, als er sich nach den Terroranschlägen in Paris im November äußerte und forderte, dass man den bis auf die Zähne bewaffneten, bestausgebildeten Terroristen doch mit Messern, Pfefferspray und anderen Wurfgegenständen hätte entgegentreten müssen. Das sei doch alles zu verhindern gewesen.
Zwei Dinge kann man aus diesen Ereignissen lernen. Erstens, dass DJs und Musiker leider oft ignoranter, eindimensionaler und dümmer sind, als von vielen Fans erhofft. Zweitens aber auch, dass das Prinzip der Political Correctness, das der slowenische Philosoph Slavoj Žižek als ein gefährliches, totalitäres System beschreibt („I know better than you what you really want.“), zu moralistischen Hysterien neigt. Die Akzeleration der Gesellschaft lässt in den Medien kaum noch Zeit für Besinnung, Reflexion und Hinterfragung von Ereignissen. Das ist in der Weltpolitik so und scheint die Clubkultur mittlerweile genauso zu betreffen. Es ist ohne Zweifel wichtig, dass man auch in kreativen Branchen gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus eintritt. Nur über die Wahl der Mittel sollten alle nachdenken, bevor agiert wird. Ten Walls-Platten zu zertreten und sich im Shitstorm zu suhlen ist eine Möglichkeit, bringt aber nicht viel. Vielleicht sollten all jene Festivals, Promoter und Labels, die im Sommer noch ihre moralischen Würgereflexe wie ein Stroboskop-Gewitter in die Öffentlichkeit posaunten, anfangen, eigenverantwortlich für mehr Diversität zu sorgen. Denn wer sich die Musik-, Booking- und Festivallandschaft oder auch die Jahrespolls der einschlägigen Medien anschaut, wird feststellen, dass das Gros der Künstler seit Ewigkeiten männlich, weiß und heterosexuell ist. Eine emanzipierte, gleichberechtigte, gerechte und vielseitige Welt sieht anders aus. Zurzeit ist die Bigotterie innerhalb der sogenannten Szene das eigentliche Problem.