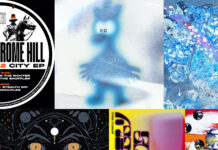Japanese Telecom – Virtual Geisha (Clone Aqualung Series)

„Detroit Style Electropop”: Diese Consumer-Info prangte auf dem im Artwork integrierten Sticker auf dem Cover von Virtual Geisha, als das Doppelalbum 2001 auf Gigolo Records erschien. Das Rätselraten um die Identität des hinter dem Act steckenden Künstlers war bereits seinerzeit als wohlkalkulierte Aufmerksamkeitsboosterkampagne zu erkennen; schließlich hatte man hinreichend oft die Namen Dopplereffekt und Drexciya in die Debatte geworfen, um für Gerüchte zu sorgen. Gerald Donald wurde mit beiden Projekten in Verbindung gebracht, auch mit anderen wie Arpanet, Der Zyklus, Heinrich Mueller, Rudolf Klorzeiger, Xor Gate, Glass Domain und einer ganzen Reihe mehr.
Wie die meisten dieser Acts hat auch Japanese Telecom keine große Diskografie hinterlassen: Virtual Geisha ist das bis dato einzige JT-Album geblieben; zuvor war lediglich eine EP auf Intuit-Solar erschienen. Clone haben den lang vergriffenen Longplayer remastern lassen und machen Virtual Geisha mit neuem Cover wieder verfügbar.
Was Kraftwerk für Dopplereffekt darstellt, ist für Japanese Telecom Dopplereffekt („Beta Capsule” vor allem) plus Yellow Magic Orchestra, was besonders in „The Making Of Ultraman” zum Tragen kommt. Frappierend, die Unkaputtbarkeit von „Virtual Origami”. Dafür scheint das „Sharevari”-Echo in „Virtual Geisha (She Interacts)” mit dem Abstand von zwei Dekaden umso deutlicher zu vernehmen sein. „Mounting Yoko” wiederum hätte sich auch auf dem ungefähr zeitgleich erschienen Album von The Other People Place gut gemacht. Miniaturen wie „Enter Mrs. Suzuki” oder „Japanese Matrix” werfen ihre Schatten voraus auf kommende Entwicklungsschritte. Entwaffnend: das City-Pop-Kleinod „Pagoda of Sin”. Bestürzend: Wie im zweiteiligen „Remote Transmitter” die perfekte italo-balearische Cyber-Love-Story-Atmo, ein Instrumental von ungemein narrativer Songhaftigkeit, in der Mitte des Tracks abgewürgt wird, um einem mechanisch insistierenden Electro-Beat zu weichen (beziehungsweise dem „Frankensteinartigen” darin, wie mir Carl Craig, befragt nach dem grundlegenden Unterschied zwischen Techno und Electro, seine Faszination für die spezifische Zerrissenheit der Grooves des Genres in einem Interview mal erklärt hat). Auch im an Highlights nicht gerade armen Werk von Gerald Donald ein singulärer Meilenstein. Harry Schmidt
Roger Gerressen – Monoaware (Sushitech) (Reissue)

So sehr wir den alljährlichen Tsunami an Reissues mittlerweile gewohnt sind, so sehr überrascht es, wenn Platten bereits nach fünf Jahren wiederveröffentlicht werden. Ob man bei Monoaware also jetzt von aufpoliertem Repress oder doch von Reissue sprechen möchte, das sei ganz am Ende jedermensch selbst überlassen. Was man aber nicht groß diskutieren muss: Die Platte hat diesen neuerlichen Anschub durchaus verdient.
Noch immer sind Alben im elektronischen Feld eine eigene Währung, sind eben nicht mit Kleingeld, sondern bloß in Goldbarren aufzuwiegen. So jedenfalls die Meinung vieler Künstler*innen, die sich oftmals schwer tun mit dem Langformat.
Saß der Nimwegener Roger Gerressen 2017 nämlich schon seit einigen Jahren fest im Sattel der niederländischen House-Szene, hatte sowohl mit Dub- als auch mit Minimal-Techno-Singles nachhaltig Eindruck hinterlassen, handelte es sich bei Monoaware eben doch um seine Debüt-LP. Dafür nahm er nochmal einen Ausflug in die eigene musikalische Entwicklung. Die Einflüsse sind rauszuhören: Da ist Kompakt-naher Minimal, Berlin-Sound à la Steve Bug – mit bekannten Dub-Settings, selbst so ein paar DJ-Shadow-Sounds meint man rauszuhören. Dass die Platte auch nach fünf Jahren nicht überholt klingt, ist schon Grund genug, sie nochmal rauszubringen. Lars Fleischmann
Själen – Spirit High (Studio Barnhus)

Ey, 2021, dir weint echt keine Sau nach. Dass es in einer Situation der allgemeinen Beschissenheit ganz gut zu Ende ging, kann man sich während des obligatorischen Entgiftungsmonats zwar einreden, allein: Die Lüge wird auch nicht älter als der Januar. Spätestens in zwei Wochen ertränkt man sich wieder in Longdrinks. Gut, dass die Schwedenbomber von Studio Barnhus in den Wintermonaten beim harten Zeug bleiben.
Im Dezember veröffentlichte das Stockholmer Label, das zuletzt mit Platten von Bella Boo und Jimi Tenor große Töne spuckte, das Debüt von Själen – ein Duo zweier Mid-Life-Crisler, die nicht im tiefergelegten Volvo zum Einrichtungshaus brausen, sondern sich am Synth austoben und ihre Lebensgeschichte ins Mikro brüllen. Zwischen Bach-Oratorium, Falco und Future Islands passen Själen mit ihrem Spirit High. Die Platte pinkelt mit Pathos genderneutrale Menschen in den Schnee. Saublöd, aber so viel Spaß, weil: Huiiii, Melodien! Mit „Dom låg där i en hög”, das man erst nach drei doppelten Haselnussschnäpsen akzentfrei auszusprechen weiß, schmeißt man Nordmanntannen aus dem Fenster, „Tråden” greift sich schamlos in den Schritt, und während „Bakom en buske” mit Ratatatataaa zum Knut-Sale swingt, friert „Marschera” ein Dutzend Kullertränen ein. Na ja, 2021, es war halt auch nicht alles schlecht. Christoph Benkeser
Soft as Snow – Bit Rot (Infinite Machine)

Es gibt Werke, die werden von ihrem eigenen Konzept eingeholt – Bit Rot könnte ein solches sein. Die beiden Wahlberliner Oda Egjar Starheim und Øystein Monsen haben ihre Jackentaschen dafür mit Steinen vollgepackt und sind dann in die Spree gestiegen. Gut schwimmen lässt sich so nicht, man muss kräftig strampeln, um nicht unterzugehen. Die sprichwörtlichen Steine bestehen aus den Konzeptsplittern, die hier den Ton angeben: Es geht um Ambivalenzen und Dialektik. Um Organisches und Technisches, Befriedigung und Pein, einstürzende Neubauten und renovierte Altbauten als Zeichen von Dekadenz.
Das versucht man in opulenten Synthfeuerwerken, die fast schon barock anmuten, einzufangen. Das Ende der Demokratie in Europa genauso wie die überwältigenden Veränderungen im Zuge der Pandemie. Um nicht ganz blank ziehen zu müssen, holte man sich Ville Haimala von Amnesia Scanner an Bord; der Einfluss ist auch eindeutig spürbar, viele Sounds nicht ganz unbekannt.Dass man neben dem angestrebten sublimen und elektronischen Experimental-Sound immer wieder Pop probiert, wirkt zwar gut gemacht, aber eben auch arg volatil. Das passt zur Sibyllenhaftigkeit, die hier eben den Ton angibt. Kampflos gibt man sich dennoch nicht auf, kämpft gegen den Strom an und klingt an den besten Stellen sogar nach The Knife. Was man, das sei dazugesagt, aber eben auch von vornherein versucht hat. Lars Fleischmann
Tom Lönnqvist – Aria (Mille Plateaux)

Bei der Musik von Tom Lönnqvist handelt es sich eventuell um gar keine. Oder zumindest will das, was der finnische Künstler auf dem Album Aria von sich hören lässt, stellenweise gar nicht unbedingt als solche verstanden werden. Das liegt zum einen daran, dass die sieben Stücke wohl als Soundtrack für zeitgenössische Performance-Kunststücke produziert wurden – welche wird allerdings nicht erwähnt. Das lässt sich zum anderen aber auch darauf zurückführen, dass Lönnqvist sich immer wieder musikalischen Formen versperrt. Im zweiten Track „Monterey” beispielsweise hat eine laute, eindringliche Ein-Ton-Bassline einen Auftritt, verschwindet aber nach nur zwei Stippvisiten aus dem Klangbild und hinterlässt nur mehr ein synthetisches Grundrauschen als unauflösbares Rätsel.
Davon allerdings bietet Aria – auch der Titel lässt sich als ironische Spitze verstehen, weiter entfernt als von einer dramatischen, allzu menschlichen Gesangseinlage könnten diese Stücke kaum sein – jede Menge. Mithin erinnern Ansatz und Durchführung deshalb auch an das Schaffen von Kevin Drumm: Von gelegentlich scheinbar aleatorisch in den Mix gestreuten rhythmischen Elementen abgesehen, lenkt Lönnqvist das Interesse vor allem auf statische Soundschichten, auf das große Wabern im ruhenden Klang. Also: Handelt es sich bei derart undynamischer Musik überhaupt noch um welche? Die Antwort auf diese Frage ist zweitrangig. Feststeht indes: Dank seiner reduzierten Sperrigkeit lässt sich Aria ironischerweise sehr gut als Nebenbei-Soundtrack konsumieren, wobei auch genaues Hinhören so gar nicht schadet. Kristoffer Cornils
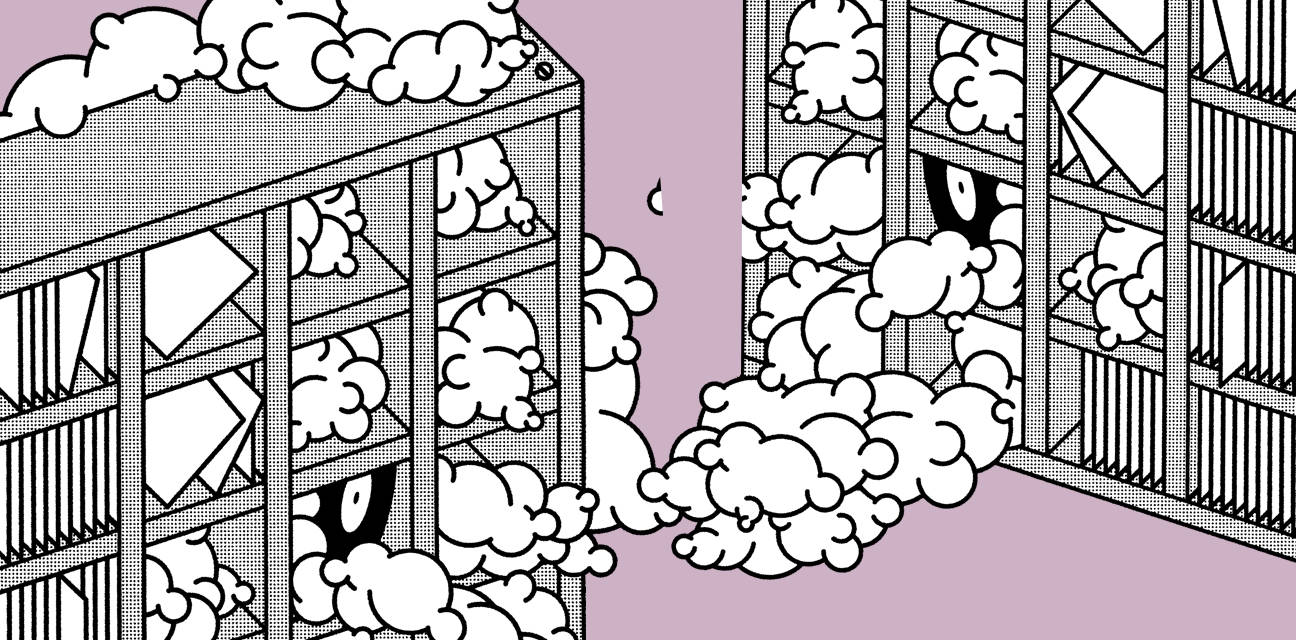

![[REWIND 2024]: Die 10 besten Compilations des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2024/12/0FAE8615-AE70-4400-9B47-A8C7C7BEA0E9-218x150.jpeg)