Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im ersten Teil des Februar-Rückblicks mit Aquarian, Beatrice Dillon, Caribou und fünf weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Hier geht’s außerdem zum zweiten, hier zum dritten Teil der Februar-Alben.
Against All Logic – 2017 – 2019 (Other People)

Unvergessen die Jahre 2010 und 2011, als Nicolas Jaar noch eine Reizfigur war. Es gab damals etwa drei Fraktionen: Jene, die die Musik des New Yorkers untanzbar fand; jene, die ihn unfassbar genial fanden, weil er sich als kultivierter Ivy-League-Student verkaufte und auch mal französische Philosophen wie Bourdieu zitierte; jene, die ihm genau deswegen billigen Distinktionsgewinn vorwarfen und belächelten. The times they are a-changing. Jaar ist längst nicht mehr die Reizfigur vergangener Tanznächte. So war seine Wiedergeburt als A.A.L. (Against All Logic) 2018 vergleichsweise unspektakulär abgelaufen. Kaum mehr als zurückhaltendes Kritikerlob blieb davon übrig, obwohl der soundästhetische Sprung bei 2012-2017 kein kleiner war. Wenig war übrig vom ultra-geschmackssicheren Spiel mit verhuschtem Main-Floor-Sample-House im Schwankbereich. Spröde, ungewohnt spitz produziert, teilweise brachial; Tracks wie „Cityfade” kamen so ungeschliffen daher, dass ihr Hit-Potenzial geschickt unterlaufen wurde. Auf dem Neuling, der nun die Schaffensphase der drei namensgebenden Jahre zusammenfasst, spielt Jaar auf der gleichen Klaviatur. Das überrascht derweil nicht mehr so sehr; immerhin hat man das Prinzip verstanden und auch der Sound gleicht sich langsam aber sicher wieder seinen Anfangstagen an. „If Loving You Is Wrong”, die zweite Nummer, wirkt wie ein Update der Marks / Angles-Phase: 105 BPM-Shaker mit Gourmet-Vocal-Sample, prominenten Bassläufen und dann ein bisschen Sound-Tüftelei. Der Follow-Up „With An Addict” reißt da schon mehr mit seinen 90 BPM, die wie 160 klingen, Footwork-ish daherkommen und anscheinend das Tabla-Synthese-Programm angeschmissen haben. Ob das alles irgendwohin führt, weiß ich zugegebenermaßen gar nicht; oder wie es Jaar in Kooperation mit Post-Punk-Legende Lydia Lunch hier selbst formuliert: „If You Can’t Do It Good, Do It Hard”. Lars Fleischmann
Aquarian – The Snake That Eats Itself (Bedouin Records)

Der kanadische Produzent Aquarian hatte bislang mit einer Reihe von EPs auf sich aufmerksam gemacht, die gleichermaßen Einflüsse aus London, Detroit und Berlin auf sich vereinten und den Dancefloor auf ganz eigene, cineastische Art und Weise in Angriff nahmen. Das gleiche Konzept kommt auch auf dem Debütalbum zum Einsatz. The Snake That Eats Itself glänzt mit einer Art beigefügten Storyline, die sich am besten beim Hören des Intro-Tracks liest und gleich die Lust schürt, sich der eigenen Vorstellungskraft zu ergeben. Im Folgenden lotet Aquarian dann die Überschneidungen von UK-Rave-Vergangenheit und modernem Techno sowie Sound-Design gänzlich aus, ohne dabei jemals ins klischeehafte abzurutschen. Im Gegenteil, dronige Half-Time-Stepper, die nach fast acht Minuten gnädigem Aufbau plötzlich in Kaskaden gechoppter Jungle-Breaks stolpern oder auch der mächtige Quasi-Titeltrack Ouroboros (die mythische, für Unendlichkeit stehende Schlange, die sich selbst frisst); was als Slowmo-Techno mit Pop-Appeal beginnt, mündet aus seinem schweren Synth-Schlingern völlig organisch in eine Aphex-Twin-esque Breakcore-Lawine, ohne dabei seinen Groove einzubüßen, obgleich der rhythmischen Abrasivität. So klingt das Album wie eine zeitgenössische Melange aus UK-Einflüssen und vielschichtigem, komplexem Soundscape-Techno. Dass die LP dabei nie wirklich wie etwas Vorangegangenes klingt, stärkt ihren Gesamteindruck nur noch.Die fünf Jahre Entwicklungszeit gaben Aquarian genügend Zeit, um jeden Track bis ins letzte Details auszufeilen. So ziehen einen die verdichteten, ineinander verzahnten Klanggebilde tief in ihren Bann und bleiben auch in ihren aufreibendsten Momenten stets nachvollziehbar. The Snake That Eats Itself ist eine fesselnde Geschichte von einem Produzenten, der sich selbst ein bemerkenswertes Denkmal gesetzt hat. Leopold Hutter
Aux 88 – Counterparts (Detroit Bass Classics)

Wenn man von einem Projekt sagt, dass es dem klassischen Electro verpflichtet ist, heißt das heute oft, dass da jemand aus nostalgischen Beweggründen heraus sich am frühen Detroit-Techno-Sound abarbeitet. Das trifft selbstverständlich nur dann zu, wenn die Beteiligten zu der in Rede stehenden Zeit noch nicht mit dabei waren. Bei Aux 88 liegt die Sache etwas anders. Die in wechselnder Konstellation um das Duo Tommy Hamilton und Keith Tucker herum organisierte Band veröffentlicht einerseits seit dem Jahr 1993, andererseits kommen sie auch noch aus Detroit. Wenn sie auf ihrem aktuellen Album, dem ersten seit zehn Jahren, jetzt in der vollständigen Besetzung mit allen vier bisher involvierten Musikern etwas hervorbringen, das nach klassischem Electro klingt, dann hat das folglich nichts Manieriertes, sondern ist schlicht konsequent. Irgendwie hat diese Form von elektronischem Funk ja etwas Strukturkonservatives – im Unterschied zum vergleichsweise wandlungsfähigen und offenen Techno –, doch zugleich ist dieser Sound so quadratisch, praktisch, gut, dass es eigentlich gar nicht genug davon geben kann. Und Aux 88 haben bis heute den Funk – ein wenig verfeinert, aber tief drin immer noch schmutzig. Tim Caspar Boehme
Beatrice Dillon – Workaround (PAN)

Die Presse überschlägt sich. Vom Guardian bis DJ Mag sind Schlagzeilen wie „Ein Meisterwerk” zu lesen. Und fürwahr: Workaround, das Solo-Debütalbum der britischen Künstlerin Beatrice Dillon, ist singulär und wirkt mit einer minimalen, fein arrangierten Tiefe, die nicht viele Produzenten zeitgenössischer elektronischer Musik ihr Eigen nennen können. Jeder ihrer 14 Tracks ist fasziniert von der puren Kraft des Rhythmus – egal ob er zwölf Sekunden oder knapp sechs Minuten dauert. Als Gäste hat die in London ansässige Produzentin Musiker wie den Tablaspieler Kuljit Bhamra, Pharoah Sanders’ Bandmitglied Jonny Lam, den senegalesischen Koraspieler Kadialy Kouyaté, die Cellistin Lucy Railton sowie befreundete Produzent*innen wie Laurel Halo, Untold und Batu willkommen geheißen, um Workaround musikalische Perspektiven einzuhauchen, die sich geschmeidig mit den ihrigen vereinen. Die so entstandene Musik ist minimal und scheinbar einfach. Wer ihr aufmerksam zuhört, entdeckt aber zwischen den Grooves und Sounds einen Raum, dessen Zauber nur dann entsteht, wenn seine Schöpferin detailverliebt die richtigen Nadelstiche setzt. Dank ihnen entsteht eine Komplexität mit minimalen Mitteln, die besonders bei großer Lautstärke eine fesselnde Dynamik entwickelt, in der Dub-, Jazz-, Jungle- und Techno-Partikel bei 150 BPM schaukeln und eine hypnotische Atmosphäre gestalten, die selbst in abstrakten Momenten bannt. Zu allem tanzen ebenso minimal gesetzte Tabla-Fragmente, Saxophonspiel und Cello-Klänge, als würden sie fest zum Kanon der Clubmusik gehören. Skelettierter Jungle-Tech mit intellektuellem Tiefgang, der ohne Effekthascherei radikal knallt. Michael Leuffen
Borusiade – Fortunate Isolation (Dark Entries)
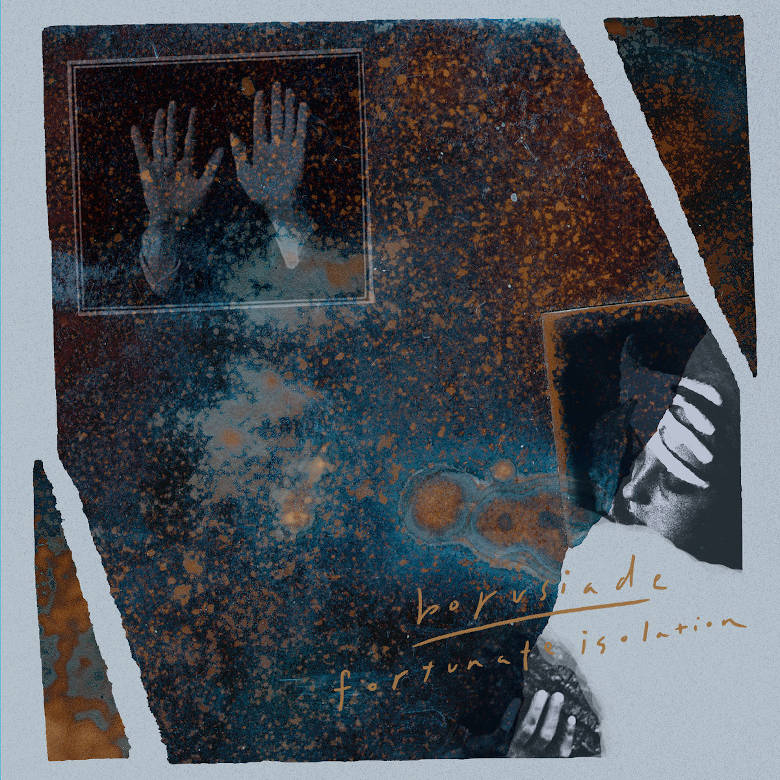
Überaus passend, dass der zweite Longplayer von Miruna Boruzescu, die sich als DJ und Producerin Borusiade nennt, beim auf Reissues spezialisierten Label Dark Entries erscheint, klingt Fortunate Isolation doch wie ein vergessenes Meisterwerk aus den frühen Achtzigern. Dark und Minimal Wave, Synth-Pop, der düstere Teil von Italo Disco, dazu Industrial, früher Electro und EBM bilden die Koordinaten der Musik auf diesem außergewöhnlichen, ja: herausragendem Album – und doch wirkt nichts daran retro oder gar nostalgisch. Boruzescu, die in Bukarest aufgewachsen ist und in Berlin lebt, hat zwölf Jahre lang in einem klassischen Chor gesungen, bevor sie anfing, sich für elektronische Musik zu begeistern, diese zunächst aufzulegen und schließlich auch zu produzieren. Echos dieser Sozialisation finden sich hier nicht nur in ihrem Gesang – Lyrics, die diese Bezeichnung auch wirklich verdienen, stehen im Mittelpunkt ihrer Stücke; ihr geschultes Alt-Timbre hebt Tracks wie das Kernstück, den Choral „Lament (Fortunate Isolation)”, weit über den gewohnten Horizont der Clubmusik hinaus, worin Boruzescus Werk dem von John Maus ähnelt –, sondern auch in den kurzen, an Barockmusik angelehnten Prä- und Interludien „Welcome Them” und „They Pass By”. Weniger auf der Jagd nach Hipness-Credits als Helena Hauff, wirken die acht Tracks auf Fortunate Isolation eher wie ein zeitloses, düsteres Industrial-Update in der Tradition von Chris & Cosey. Exzellentes Release, dessen Relevanz sich mit mehrfachem Hören nicht (wie in vielen Fällen) relativiert, sondern vielmehr noch zunimmt. Harry Schmidt
Caribou – Suddenly (City Slang)

House is a feeling. Niemand hat das zuletzt so verinnerlicht wie Dan Snaith. Vielleicht ist aber auch Snaith selbst ein Feeling und hat in den letzten Jahren lediglich House verinnerlicht. Ja, so herum stimmt es eher. Denn auf eines versteht sich der nette Kerl von nebenan blendend: eine Atmosphäre der Sanftheit und Wärme zu kreieren. Sei es mit der verspulten Electronica seiner 2000er-Werke, mit dem Rhythmus-lastigen Swim, das ihn 2010 zum Indie-Popstar machte oder mit dem Kulminationspunkt der Gefühligkeit, dem letzten Caribou-Album Our Love. Schon da floss viel von Snaiths House-Liebäugelei mit ein, die mit seinem Dance-Projekt Daphni Anfang der 2010er ihren Anfang nahm. Über fünf Jahre und ein Daphni-Album nach Our Love findet House auch wieder Eingang auf Suddenly, und zwar, wie im Falle von „Ravi”, bis an die Grenzen der Übertreibung. Ein Track wie „Lime” hingegen wäre auch als Daphni-Stück durchgegangen, „Never Come Back” ist in seiner hell erleuchteten Tanzbarkeit ein Future Classic. Doch bei House allein bleibt es nicht, Suddenly ist eine extrem vielschichtige Platte. Immer wieder greifen sanft verschrobene Electro-Psychedelia-Stücke die Stimmung des frühen Manitoba- und Caribou-Materials auf. Dann frischt Snaith seinen Kosmos der Freundlichkeit mit hochgepitchten Stimmsamples und Rap-Parts auf, nur um im nächsten Moment mit „Home” ein astreines Soul-Stück zu präsentieren. Suddenly ist eine behutsame Weiterentwicklung des Caribou-Sounds, bei der auch der Blick zurück nicht vergessen wurde. Snaith macht erwartungsgemäß auch auf Album Nummer sieben alles richtig. Und er macht es mit Gefühl. Steffen Kolberg
Claude VonStroke – Freaks & Beaks (DIRTYBIRD)

Barclay Crenshaw alias Claude VonStroke muss man im Tech-House-Kontext nicht vorstellen. Sein Karriere-Höhepunkt kam mit „Deep Throat” vor 15 Jahren. In Folge dessen integrierte er sich im Pull-Up-Your-Socks-Mainstream-Festival/Club-Bereich. Das passt perfekt in Clubs wie das Münchner Blitz, die Fabric in London und neuerdings – auch verwunderlich – ins Kater Blau. Es ist auch völlig klar, wo VonStroke hin will; leider kommt er in Green Velvets „Bathroom” nicht rein. Die reflektierteren Hörer*innen beschweren sich auf der Toilette sofort über die Funktionalität der Tanzfläche. Beschwören drei Jahrzehnte alte, neoliberale Tendenzen und deren Marketing-Gebärden. Und die pumpt der Sound tatsächlich in dicken, heteronormierten Schwällen in die gleichgeschalteten Hörer*innen-Ohren hinein und verklebt deren Zellpampe-Gehirn mit toxischer Gelassenheit. Das könnte lustig gemeint sein? Logischerweise klingt das Album wie humoresquer EDM. Schön einfach 16 oder 32 Takte hohl-klickendes Kick-Klopfen unter 150 Hz eingefiltert. Dann geht der Filter auf und die Kick bumst ab 35/40 Hz – als Anfang von fast allen Tracks? Bravo! Im Toilettenspiegel erscheint mit „Flubblebuddy” das Höhlengleichnis einer DAW (Digital Audio Workstation), deren popelige Hüllkurven und dieses mausig-spießige Striche hin- und herziehen an diesen kleinlichen Punkten in der Automation. „Pedantisch kalkulierte Frequenzgang-Bereinigung!”, scherzt eine Stimme aus dem Nebenklo. Das Internet ertrinkt in dieser quasi-algorithmischen Vorhersehbarkeit. Kein Wunder, dass findige, jüngere Marketingspezialisten das Ende der menschlich produzierten, elektronischen Tanzmusik ausrufen. „This is what will happen to all human entertainment products, so we might as well get started on electronic music, because it’s honestly the most trivial.” (Olle Holmberg, 2019). So stimmt das aber auch nicht ganz. Mirko Hecktor
CP/BW – Untitled LP (BW)
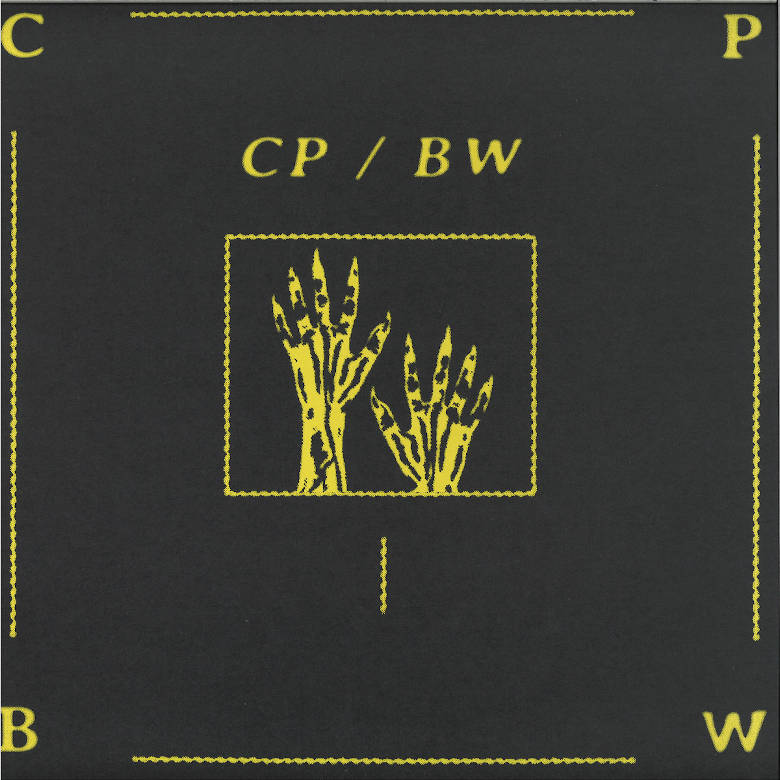
Die Kollaboration zwischen dem Duo Corporate Park und dem King of Leftfield Beau Wanzer blüht erneut zum Leben auf. Das erste Mal vereinten die Drei 2015 ihre Kräfte und auch damals gipfelte das gemeinsame Schreiben und Jammen in einem Album voller obskur betitelter e-Industrial-Sequenzen. Das Resultat hörte sich damals schon stimmig an – und das tut es auch nun wieder. Auf neun Tracks schleppen sich stählern-modifizierte Strings über scheppernde Beats. Dies geschieht mal stachelig-verzahnt wie in der reizüberflutenden Matrix von „Stammer Time” – und mal breitflächig-melodisch à la „Sewer Sex”. „Vertical Probation” beginnt mit einem inhaltlich verwirrenden Film-Sample, das dann nach und nach wieder auf einem düsteren, Treibsand-artigen Gummibeine-Beat aufploppt. In der Roboterhymne „A Thing That Thinks” flammt und blitzt es immer wieder rostend auf und ab, auf und ab. Der letzte Track, „Rodzina Manekinow”, zieht einen durch kaum erträgliche und unregelmäßig auftretende Key-Schwankungen in seinen Bann. Alles in allem kommt in dieser Konstellation sicher jeder Beau Wanzer’sche Leftfield-Fan auf seine Kosten – und das nicht zum ersten und bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Benjamin Kaufman




