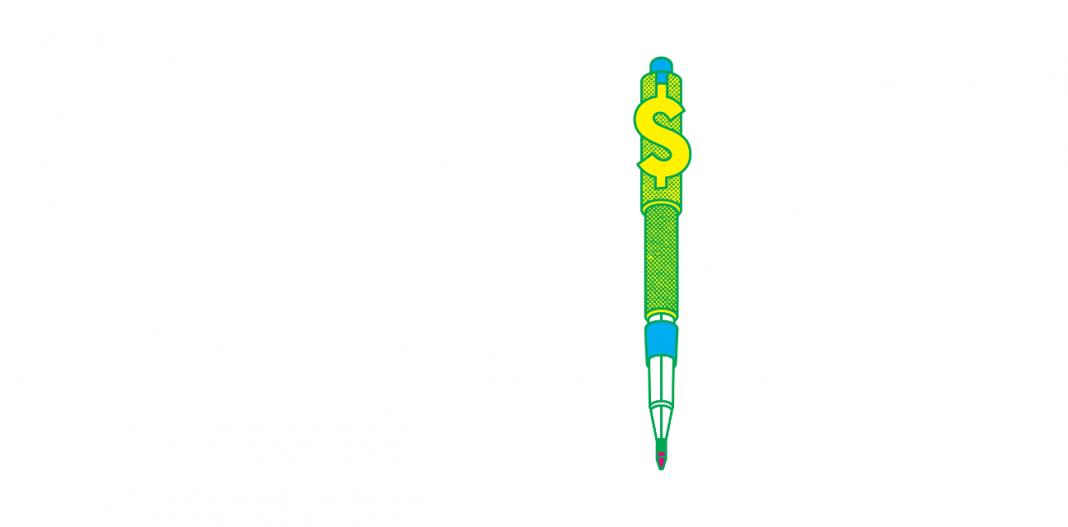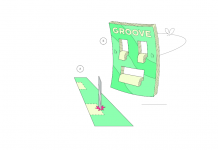Illustration: Super Quiet. Mehr Rückblicke findet ihr hier.
Wann hat dich das letzte Mal ein Musikmagazin gefragt, welche Musik du gerade hörst? Immer häufiger tauchten im Jahr 2017 solche Fragen in unseren Newsfeeds auf: Was hörst du gerade, welcher DJ begeistert dich aktuell – und so weiter, und so fort. Das ist nett, sorgt für ein bisschen Austausch und letztlich ist so eine Frage ja schnell beantwortet. Deine Antwort interessiert aber niemanden, zumindest nicht jene Musikmagazine. Worum es denen geht, ist ihre organische Reichweite. Wenn du einen Kommentar hinterlässt, sehen deine Freunde und Freundesfreunde das vielleicht und der Facebook-Algorithmus merkt sich deine Interaktion mit dem Magazin und zeigt dir in Zukunft mehr von seinen Posts an. Das ist weniger ein fieser Trick denn vielmehr eine Verzweiflungstat. Die Alternative zur organischen ist die bezahlte Reichweite. Das Prinzip ist selbsterklärend: Schmeiß Facebook Geld in den Rachen und deine Posts werden gesehen. Seit geraumer Zeit stecken Medienunternehmen in der finanziellen Geiselhaft jener Plattformen, die anfangs noch belächelt oder als Gratis-Tools hingenommen wurden und die das nunmehr schamlos ausnutzen.
Darunter leidet die journalistische Qualität. Es wird weniger kritisch berichtet als vorher, sondern reißerischer und manchmal so betont nett, dass es stutzig macht. Warum? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet, dass Musikjournalismus nicht allein von Facebook abhängig ist. Schon seit Langem sind Anzeigen das finanzielle Fundament von Journalismus. Oder was meinst du, wie es sich ein Magazin wie die Groove jahrelang leisten konnte, seine Hefte gratis unters Volk zu bringen? Möglich war das nur, weil die Kosten dafür von der Anzeigenabteilung hereingeholt wurden. Das hat sich nicht geändert, sondern findet nun überwiegend online statt. Es hat sich jedoch auf die grundlegenden Strukturen ausgeweitet. Wenn sich ein DJ buchstäblich die Coverstory eines Magazins kaufen oder durch einen Deal ertauschen kann läuft einiges gehörig falsch.
Es geht also ums Geld. Und das gilt insbesondere für Einzelpersonen. Denn es sind die JournalistInnen selbst, die sich in einer prekären Lage befinden. In Interviews sitzen sie DJs gegenüber, die in zwei Stunden mehr verdienen als manche von ihnen im Quartal. Labels sind potenzielle Geldgeber, vielleicht muss bald ein Pressetext geschrieben werden. Wer will da schon die Hand beißen, die das Futter bereithält? Oder sich für ein verschwindend geringes Honorar wirklich kritisch mit einer Platte auseinandersetzen, wenn es Nettigkeitsfloskeln ebenso tun? Die Branche hat ein Interesse daran, diese Konflikte und Kompromisse im Keim zu ersticken, und vor allem trägt sie Verantwortung für das Wohl ihrer Arbeitnehmer. Nur unabhängiger Journalismus ist guter Journalismus. Sie hat es aber versäumt, sich mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Siegeszug sozialer Netzwerke zu arrangieren und wurde zum Teil verschluckt. Nicht wenige der großen Musikmagazine gehören mittlerweile zu Unternehmen, die ihre journalistischen Outlets in erster Linie als Teil des konzerneigenen Marketings betrachten. Was macht das mit einer Szene, wenn Brausehersteller oder Telekommunikationsfirmen die Diskussion darum bestimmen?
Um wieder unabhängig zu werden, muss Musikjournalismus neue Bezahlmodelle finden. Sonst heißt es weiterhin: Keine Kohle – keine Meinung. Die Frage lautet nicht: Was hörst du gerade? Sondern: Was müssen wir tun, um unseren Abhängigkeiten zu entkommen? Denn nur dann können wir dir Antworten liefern, statt dich mit belanglosen Fragen zu umsäuseln.