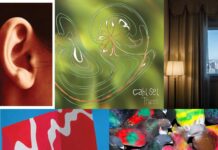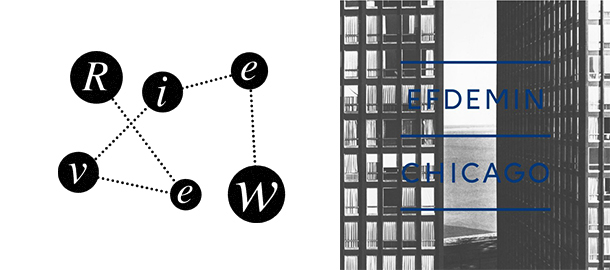
Es kann passieren, dass man Phillip Sollmann irgendwo auf dieser Welt mit einer Plattentasche im Wartebereich eines Flughafens trifft. Gerade auf dem Weg nach Hause von einem Gig würde er vielleicht erzählen, wie heftig es im Club wieder zur Sache gegangen, und wie wenig Platz der Musik dabei zum Atmen geblieben sei. Das müsste gar nicht groß desillusioniert klingen. Sollmann liebt den Club und damit dessen Konventionen. Trotzdem schwebt ihm in solchen Momenten vielleicht ein anderer Raum vor. Ein Raum, wie er ihn selbst in seiner Musik aufmachen könnte und in dem es genau andersrum zugeht. Im Zweifelsfall würde dort stets das Unwahrscheinliche das Voraussehbare an den Rand drängen. Das könnte so aussehen wie im Eröffnungsstück des zweiten Efdemin-Albums: mit einem aus der Rolle gefallenen Glasperlen-Spiel, einem nervös zitterndem Vibraphon, bis zum Verschleiß gefilterten Kuhglocken und fast abwesender Bassdrum.
Efdemins selbstbetitletes Debüt konnte 2007 durchaus als Genrealbum durchgehen. Es war getragen von der Idee, satten Deephouse mitten auf die Tanzfläche zu bringen. Die Tracks beeindruckten nicht unbedingt durch kühne Architektur, sondern vielmehr durch ihr Augenmerk auf kleinste atmosphärische und klangtechnische Details, mit denen eine bekannte Baustruktur gefüllt wurde. Der plakative, leicht als programmatisch zu missverstehende Titel Chicago steht nun für das Gegenteil einer solchen Einordnung. Es geht um keine Referenzadresse, sondern um eine Aneignung dessen, was man mit der Geschichte der Housemusic so anfangen könnte – wenn man wollte. Sollmann will. Sein Verweis auf den Sehnsuchtsort steht nicht für eine Ankunft im Kanon, er markiert einen Ausgangspunkt.
Unterwegs im „Night Train“ auf dieser „Grand Voyage“ (so zwei Stücktitel, die auf das Prozesshafte hindeuten) beeindruckt zunächst, wie die Sounds gesetzt sind: kleinteilig, intuitiv, manchmal wie zufällig aus dem Handgelenk geschüttelt und doch ungemein präzise. „Round Here“ etwa, ein zentrales Stück des Albums, erdrückt einen erst fast mit seiner Bassgewalt, die von ausschwärmenden Flächen zusehends aufgeweicht wird. Die tiefen Frequenzen gehen noch für ein paar Runden auf Achterbahn-Fahrt, dann hebt der Track langsam ab ins Nichts: von irgendwoher Straßengeräusche, rundum dröhnender Stillstand, dazwischen immer wieder ein aus der Spur geratenes Scheppern. Das wirkt irritierend, rätselhaft, aber irgendwie peitscht es doch genau zur rechten Zeit in die Idylle. Die Coda führt mit simplem Kick- und Clap-Klopfen schließlich zurück auf den Boden der Tatsachen: in den Club, in dem alles atmet und wirr vor Spannung und Neugier den nächsten Mix erwartet. Es ist, als hätte jemand plötzlich ein unbekanntes Fenster aufgerissen, alles durchgelüftet, das Fenster geschlossen. Chicago ist gebaut wie andere Housemusic auch: im Raster. Und aus den endlosen Ausblicken dazwischen.
![[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2025/12/Alben2025_klein-218x150.jpg)