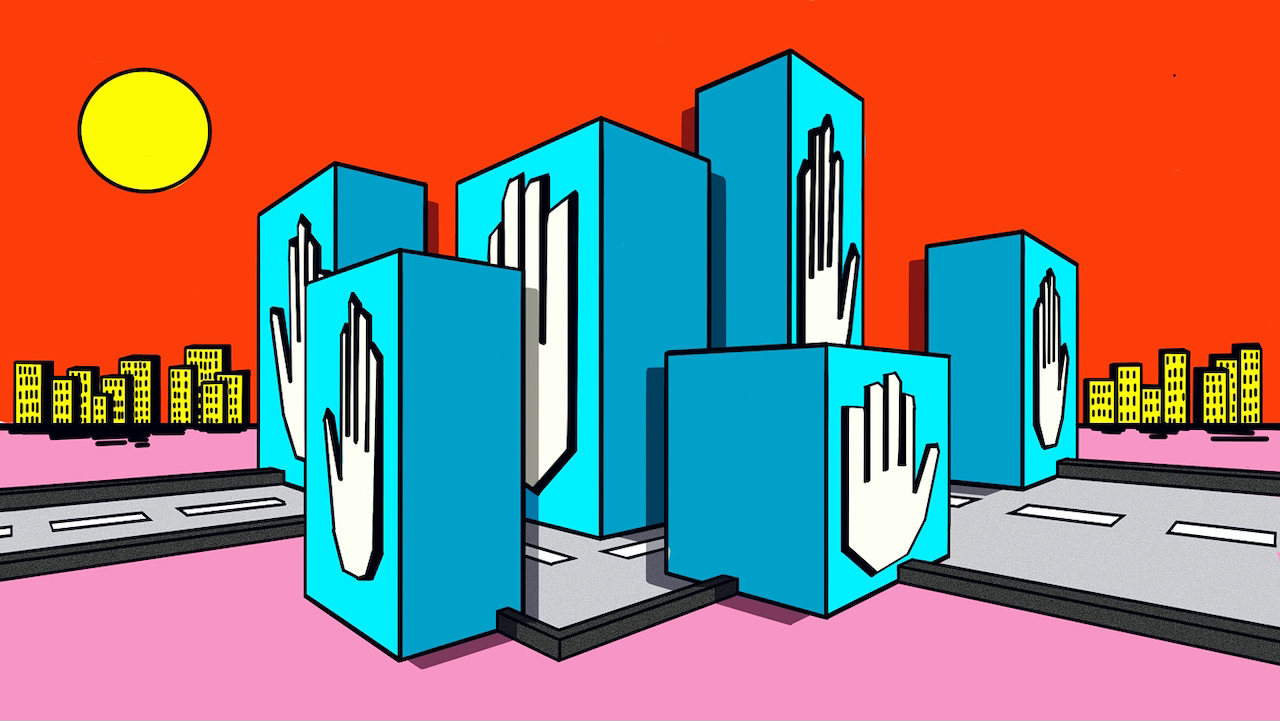Diese Wahrnehmung basiert auf einer Reihe unzähliger Erfahrungen, die Judith im Lauf ihrer DJ-Karriere gemacht hat. Ein paar Beispiele:
„Ich werde nicht ernstgenommen”
Vor ihrem Gig auf einem großen Festival kommt Judith in Begleitung eines Freundes, dem sie ihren Gästelistenplatz gegeben hat, auf dem Gelände an. Beim Vorstellen sagt Judith dem Artist-Care-Mitarbeiter am Einlass, dass sie der Act und ihr Kumpel ihr Plus Eins ist. Doch der Mitarbeiter verhält sich so, als würde Judiths Begleiter statt ihr auflegen: „Er hat nur ihn richtig begrüßt und eingewiesen, wo die Bühne ist, wo ich spiele. Er bekam auch meinen Umschlag mit meinem Künstlerinnennamen drauf, mit der Gage und allen Getränkemarken. Ich stand dumm daneben. Das war sicher alles nicht böse gemeint, aber das ist ja dieser versteckte Sexismus. In dem Moment, wo ein Typ neben mir steht, haben sie mich einfach nicht ernstgenommen.”
„Ich werde dumm gemacht”
Wenn Judith vor einem Gig gefragt wird, welche Technik sie für ihr Set benötigt, trägt sie auch mal drei CDJs in den Techrider ein. „Ich mixe ab und zu gerne einen Popsong rein und lege meine Beatschleifen drunter. Deshalb spiele ich so gern mit drei Playern.” Trotzdem kommt es vor, dass sie stattdessen nur zwei CDJs auf dem Pult erwarten. Nicht, weil nicht genug Player vorhanden wären: „Wie oft hat mir ein Techniker nur zwei hingestellt und gemeint: ‚Ach komm, als ob du alle drei wirklich brauchst.’ Aber der Kollege, der nach mir kommt, bekommt den Dritten hingestellt, während ich spiele.“ Judith ist bewusst, dass sie nur aus ihrer Perspektive sprechen kann. Aber: „Ich erlebe einfach nicht, dass mit meinen männlichen Kollegen so umgegangen wird, wenn ich daneben stehe.”
„Ich werde schlechter bezahlt”
Nach einem Gig in einer anderen Stadt erkundigt Judith sich nach den Gagen der anderen Artists, die an dem Abend aufgelegt haben. „Sowas zu fragen, kostet natürlich auch Überwindung.” Die Antwort macht sie wütend: „Ich hab’ am wenigsten Gage bekommen. Und hab’ davon auch noch als einzige Fahrkosten bezahlen müssen.” Besonders dreist: Judith steht ganz oben auf dem Veranstaltungsplakat. Und ist die einzige im Line-up, die kein Mann ist. „Ich war sozusagen Headlinerin auf der Veranstaltung, ansonsten haben da eben die Typen aus der Stadt gespielt.”
Wenn die Existenz von geschlechtsspezifisch ungleichen Gagen unter DJs geleugnet wird, fallen im selben Satz gern Namen wie Charlotte de Witte, Amelie Lens und Nina Kraviz, stellt Judith fest. „Kann ja sein, dass drei Frauen viel verdienen in diesem Business, wo aber 5000 andere riesige DJs auch viel verdienen. Und Newcomerinnen kriegen kaum was. Sogar ich als Headlinerin bekomme weniger als die Kumpels vom Booker.”
Diese Erfahrung mit offensichtlich unfairen Gagen ist nicht Judiths einzige: „Bei meiner eigenen persönlichen ‚Feldstudie’ ist das schon öfter der Fall gewesen. Und es ließ sich rational nicht erklären.”
In jeder Branche gibt es eine Gender Pay Gap – da ist auch die Club- und Veranstaltungswirtschaft keine Ausnahme. Neben Judiths individueller Beobachtung existieren repräsentative Untersuchungen, die ihre Erfahrungen statistisch untermauern. Diese verwenden binäre Geschlechtskategorien, weshalb keine Daten für nicht-binäre Menschen vorliegen.
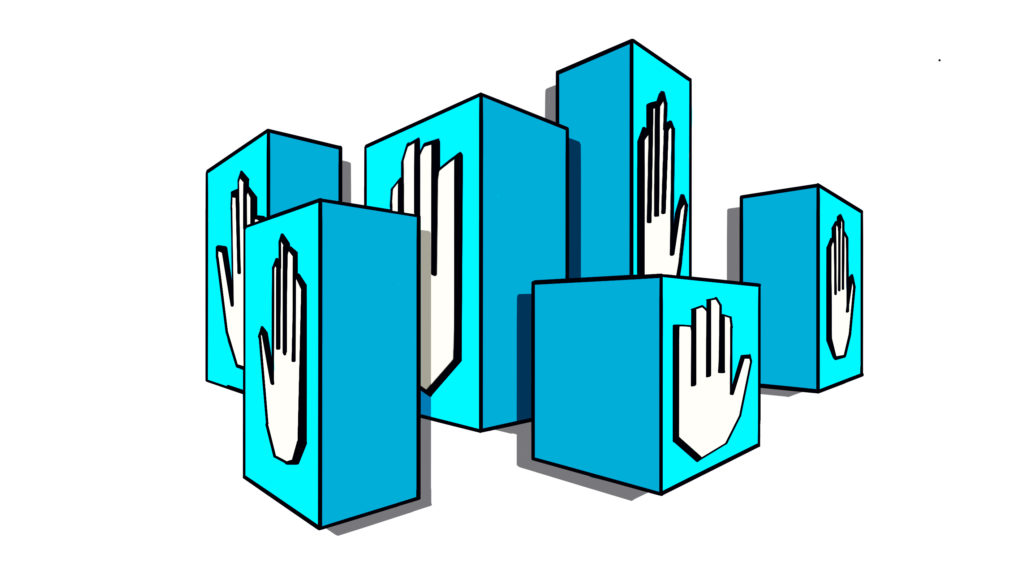
Ein Beispiel für die Lage in Deutschland: In einer Studie des Deutschen Kulturrats wird die Entwicklung der Durchschnittseinkommen unterschiedlicher Berufe im Bereich Musik von 2013 bis 2019 verglichen und nach Geschlecht unterteilt. Für den Beruf DJ wurden nur Daten der Jahre 2015 und 2016 erhoben. Das durchschnittliche Jahreseinkommen eines männlichen DJs betrug in beiden Jahren ungefähr 11.000 Euro, bei weiblichen DJs stieg das Einkommen leicht von knapp 8.000 zu knapp 8.400 Euro. Weibliche DJs haben demnach fast ein Viertel weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Da die Daten durch die Künstlersozialkasse erhoben wurden, liegt es nah, dass nur hauptberufliche DJs berücksichtigt wurden.
Die Untersuchung des Software-Herstellers HoneyBook ist mit Daten von 2019 aktueller und zeigt die Gender Pay Gap am Beispiel der US-amerikanischen Kreativwirtschaft. Im Vergleich zu 2017, als das Unternehmen die erste Untersuchung beauftragt hatte, sei der jährliche Einkommensunterschied zwischen männlichen und weiblichen Kreativen 2019 von 32 auf 11 Prozent gesunken. Allerdings kein Grund zur Freude: Statt gerechter bezahlt zu werden, arbeiten Frauen schlicht mehr. Pro einzelnem Projekt verdienen Frauen durchschnittlich 26 Prozent weniger Geld als Männer – trotz durchschnittlich höherer Bildungsabschlüsse. Dafür setzen Frauen 22 Prozent mehr Projekte pro Jahr um als Männer. Das Fazit der Autor:innen: „Das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern schrumpft, aber nur, weil Frauen jedes Jahr mehr Projekte übernehmen, um die ungleiche Bezahlung auszugleichen.”
Die Autor*innen haben die Ergebnisse anhand der einzelnen Berufsfelder gesplittet. Bei DJs ist die Gender Pay Gap am größten: Wo ein männlicher DJ statistisch einen Dollar verdient, verdient eine DJ 38 Cent. Weibliche DJs müssen demnach mehr als doppelt so oft gebucht werden und mehr als doppelt so viel arbeiten, um immer noch bedeutend weniger Gage erwirtschaftet zu haben als ihre männlichen Kollegen.
„Du hast es nicht verdient, dort zu stehen”
An einem Abend arbeitet Judith gerade hinter der Bar, als sie ein Crew-Kollege anspricht. Ohne Zusammenhang beginnt er auf sie einzureden. „Er hat mich total vollgelabert, dass es unverdient ist, dass ich hier spiele, da spiele, international spiele. Andere hätten es mehr verdient. Und ich ahne, wen er meint – sich selbst oder einen Kumpel. Obwohl die komplett andere Mucke spielen. Ich frage mich, wie man messbar macht, wer was verdient hat.”
Anderer Abend, gleicher Vorwurf: Im Backstage wird Judith von einem Crewmitglied des Clubs angesprochen, in dem sie an diesem Abend auflegt. Er behauptet, Judith hätte mit ihrem Gig anderen DJs, die härter als sie gearbeitet hätten, den Platz weggenommen. Wen genau er damit meint und wieso er annimmt, dass sie weniger hart gearbeitet habe, sagt er nicht. Mal wieder ist Judith die einzige Frau im Line-up.
Ein anderer Bekannter sagt zu Judith: „Was deine Karriere und deinen Erfolg angeht – du bist ja auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen.” Oder der Spruch eines Gastes nach einem Gig: „Du darfst hier nur spielen, weil du Brüste hast.” Sie berichtet von weiteren Erlebnissen dieser Art. Wenn Judith sich gegen solche offensichtlich sexistischen Abwertungen und Beleidigungen wehrt, ist die typische Reaktion: „Auf einmal war alles ganz schnell ein Witz.” Sie nehme Dinge zu ernst und sei einfach humorlos.
„Ich kriege Hate-Kommentare”
Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen hat Judith außerdem den Eindruck, dass an weibliche und weiblich gelesene DJs teilweise deutlich höhere technische Ansprüche gestellt werden als an männliche DJs: „Du darfst da vorne keine Fehler machen. Außer du bist ein Typ.” Demnach wird die Einhaltung dieser Ansprüche beim Auftritt der DJ mit skeptischen Argusaugen und -ohren kontrolliert, um potenzielle (vermeintliche) Fehler unverzüglich gehässig kommentieren zu können. Schließlich zeige der Stolperer beim Übergang gerade, dass die Frau am Pult da eigentlich gar nicht auflegen könne, und eigentlich könnten Frauen ja überhaupt gar nicht so gut auflegen, weil ‚Frauen und Technik, ne?!’
„Alle Männer haben gesynct – da kam kein Kommentar. Aber mir wird das vorgeworfen. Muss ich diesen Player denn erst selber gebaut haben, damit man mich ernstnimmt?”
Was in nichtpandemischen Zeiten in das Ohr der Person neben sich auf dem Floor gebrüllt wird, verlagert sich während der Corona-Pandemie auch in die Kommentarspalten und Livechats unter Livestreams. Ein Beispiel: Der hämische Kommentar ‚Was würde sie nur ohne dieses LAN-Kabel machen?’ unter einem Livestream, in dem Judith aufgelegt hatte. Das Kabel verbindet die CDJs und ermöglicht so die automatische Synchronisierung der Geschwindigkeiten der Tracks auf den jeweiligen Playern. Für Judith ist der Sync-Button und das dafür benötigte Kabel in bestimmten Situationen tatsächlich notwendig. Doch nicht – worauf der Kommentator allem Anschein nach anspielt – weil Judith nicht beatmatchen könnte: „Ich spiele ja Downbeat und muss die Tracks wirklich doll pitchen. Da kannst du die Tracks manchmal nur schnell angleichen, indem du kurz syncst. Die Range reicht gar nicht, um in diesen BPM-Bereich runterzukommen. Anders geht’s nicht, das ist das Stilmittel des Downbeats. Und dieser Knopf ist auch dafür da, jemand hat den da eingebaut.”
Sicher sehen sich auch männliche DJs kritischen Publika gegenüber und werden je nach Situation und Kritiker*in vielleicht ebenfalls unfair bewertet. Trotzdem, so glaubt Judith, steckt hinter mancher Kritik an den Skills weiblich gelesener DJs auch eine große Portion Sexismus. „Ich finde spannend, dass Männern nicht vorgeworfen wird, die Technik zu benutzen. Ich hab letztens in einem Stream gespielt, in dem alle Männer gesynct haben und ich nicht – da kam kein Kommentar. Aber mir wird das vorgeworfen. Muss ich diesen Player denn erst selber gebaut haben, damit man mich ernstnimmt und ich auch alle eingebauten Knöpfe drücken darf?”
„30 Slots, eine Frau – Quote erfüllt”
Der DJ, der vor Judith auflegt, überzieht seine Playtime und schickt sie hartnäckig immer wieder weg. Als sie eine Dreiviertelstunde nach ihrem eigentlichen Slot endlich anfangen kann, kommt wenige Tracks später der Veranstalter zu ihr und besteht darauf, früher mit seinem Set zu beginnen. „Ich hab‘ mich echt gefragt, warum die mich eingeladen haben. Ich befürchte, weil eine Frau aufm Line-up stehen musste.”
„Es ist nicht cool, scheiße behandelt zu werden, blöde Erfahrungen zu machen, nicht ernstgenommen zu werden, nicht ins Line-up zu passen. Ganz ehrlich – ich habe meine Gage auch schon als Schmerzensgeld angesehen.”
Nur einer von vielen Gigs, bei denen Judith sich sicher ist, als sogenannte ‚Quotenfrau’ gebucht worden zu sein. Unter ‚Quotenfrau-Bookings’ versteht sie, eine einzige als Frau gelesene Person für ein Line-up zu buchen – egal, wie viele Slots auf der Veranstaltung bespielt werden und egal, ob der Sound der jeweiligen DJ zur Veranstaltung passt, oder nicht. Als Alibi für ein vermeintlich diverses Lineup – mit dem sich die Veranstalter*innen eventuell schmücken wollen – herhalten zu müssen, erleben auch queere DJs und DJs of Colour. Der Begriff für dieses strukturelle Phänomen heißt Tokenismus.
„Mir ist aufgefallen: Ich stehe in einem Line-up mit fünf Slots und bin die einzige Frau, ich stehe in einem Line-up mit dreißig Slots und bin die einzige Frau. Quote erfüllt.” Judith lacht trocken. Bei allem Sarkasmus – wie fühlt es sich an, als Künstlerin offenbar nur gebucht zu werden, damit zwischen lauter Männern irgendein weiblich gelesener Name im Lineup steht? „Es ist nicht cool, da scheiße behandelt zu werden, blöde Erfahrungen zu machen, nicht ernstgenommen zu werden, nicht ins Line-up zu passen. Ganz ehrlich – ich habe meine Gage auch schon als Schmerzensgeld angesehen. Und dafür mache ich das nicht!”
Booking-Anfragen für Veranstaltungen, auf denen Judith offensichtlich als ‚Quotenfrau’ herhalten soll, stellen sie vor ein Dilemma. Einerseits hat sie natürlich wenig Lust, für Leute zu spielen, die sie offenbar eher als Aushängeschild für ein vermeintlich diverses Line-up statt als Künstlerin sehen. Andererseits: „Erstens will ich spielen, zweitens hoffe ich, es wird besser, und drittens sehe ich meine Rolle als Vorbild, damit auf der Party wenigstens eine Frau zu sehen ist. Vielleicht kommt dann auch eine andere Frau aus dem Publikum auf die Idee, dass sie das ja auch machen könnte.” Außerdem versucht Judith an solchen Abenden, die Veranstalter*innen darauf aufmerksam zu machen, dass beim nächsten Mal mindestens eine zweite Frau im Line-up stehen sollte. Das System von innen verändern, nennt sie das.
Studien, die sich mit der Geschlechterausgewogenheit von Line-ups befassen, quantifizieren Judiths Beobachtungen. Auf lokaler Ebene zeigt eine Statistik des Onlinemagazins frohfroh und des FLINTA*-Netzwerks Feat.Fem die ungleiche Verteilung von Bookings am Beispiel von drei Leipziger Clubs. Während sich das Institut fuer Zukunft im Herbst 2019 mit 39 % weiblichen DJs allmählich hin zu einem ausgewogenen Line-up bewegte, hatte die Distillery im gleichen Zeitraum gerade mal ein Fünftel ihrer Slots mit Frauen besetzt. Im Elipamanoke war nicht mal jede*r zehnte gebuchte DJ weiblich.
Ähnliche Daten hat eine umfangreiche Statistik des FLINTA*-Netzwerks female:pressure ermittelt. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass auf europäischen wie nordamerikanischen Festival-Line-ups im elektronischen Bereich zwischen 2017 und 2019 durchschnittlich nur circa 20 Prozent der gebuchten Solo-Künstler*innen weiblich waren. Nicht-binäre Künstler*innen waren in Nordamerika gar nicht, in Europa mit einem Prozent in den Line-ups vertreten. Der Anteil von Künstlerinnen auf Festivalbühnen in Deutschland wächst immerhin ein wenig: Auf 71 Festivals zwischen 2012 und 2019 war nicht mal jede*r fünfte Solokünstler*in eine Frau, bei den Line-ups von 34 Festivals zwischen 2017 und 2019 war immerhin gut jede*r vierte Solokünstler*in weiblich. Der Anteil nicht-binärer Künstler*innen bleibt mit weniger als zwei Prozent unverändert.
Auf Basis beider Untersuchungen lässt sich vermuten, dass für eine (Club-)Veranstaltung mit vier bis fünf Slots durchschnittlich entweder keine oder eine weibliche DJ gebucht wird.