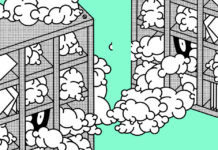Vor sechs Jahren hast du dich dazu entschlossen, keine DJ-Gigs mehr anzunehmen. Wie kam es zu der Entscheidung?
Ich stellte fest, dass da etwas mit meinem rechten Ohr ist. Um Musik zu machen, brauche ich mein Gehör, also musste ich diese Entscheidung treffen, es gab keine andere Möglichkeit.
Wie geht es deinem Ohr heute?
Es ist alles okay. Das Problem ist: Ich war über Jahrzehnte hinweg viel Lautstärke ausgesetzt, das begann bereits zu meiner Zeit als Schlagzeuger in lauten Prog Rock-Bands. Ohrstöpsel hatte ich nie verwendet. Mein Gehör beschloss also irgendwann, dass es Zeit ist für einen Streik. Glücklicherweise hatte ich das bemerkt, bevor ein echter Hörschaden entstand.
Damit ging dir aber eine gute Verdienstmöglichkeit verloren, oder?
Ja, schon. Aber die Shows fangen inzwischen das meiste auf. Es dauerte eine Weile, bis ich ein Vehikel gefunden hatte, mit dem ich die DJ-Gigs kompensieren konnte. Ich wollte mich ja nicht aus der Szene zurückziehen, aber ich war an den Punkt geraten, ab dem es gefährlich wurde. Heute bin ich dankbar, dass mein Gehör noch in Ordnung ist. Sonst wäre es mir so gegangen wie dem DJ in dem Film It’s All Gone Pete Tong, der sein Gehör weitgehend verloren hatte.
In erster Linie bist du ja ohnehin immer ein Musiker gewesen. In welchem Maße hast du dich selbst als DJ betrachtet?
Bestimmte Dinge werden einem in die Wiege gelegt. Ich kann Schlagzeug, Bass und Keyboards spielen, ich kann auch singen. Mir fiel auch das Auflegen leicht. In den frühen Achtzigerjahren unternahm ich meine ersten Versuche, Hip Hop war schuld. Wegen Hip Hop wollte damals jeder zwei Plattenspieler haben. Bei uns zuhause gab es ja jede Menge Stereo-Komponenten, natürlich auch einen Plattenspieler. Als wir im Fernsehen sahen, was die mit zwei Plattenspieler anstellen, rannten wir sofort in die Elektronikläden. Wir standen vor den Schaufenstern und träumten. Irgendwann hatte ich zwei riemengetriebene Plattenspieler und fing an zu üben. Und diese Faszination blieb. Doch mein erster offizieller DJ-Gig fand erst 1999 statt. Es war niemals ein Ziel von mir, DJ zu werden. Ich hatte einfach zuhause Spaß daran. Dann gründete ich mein Label und produzierte eigene Musik. Mir blieb schlicht keine Zeit fürs Auflegen.
Warst du ein enthusiastischer Plattenkäufer?
Früher war ich das. Doch seitdem ich in Memphis wohne, hat das stark nachgelassen. Hier gab und gibt es nicht die Plattenläden dafür. Gerade für Musik auf Vinyl sieht es seit einigen Jahren düster aus, da gibt es nichts mehr jenseits der Classics- und Reissues-Schiene. In Chicago war das natürlich noch ganz anders, da hatten wir eine richtig gute Auswahl von Läden, in die wir gehen konnten. In Amerika sieht es in dieser Hinsicht heute mies aus, mir ist der Weg nach Kalifornien zu weit, wenn ich zum nächsten guten Plattenladen will. Das ist eine ganz andere Situation als in Deutschland. Ich kaufe trotzdem noch Platten, zumindest ab und zu. Von meiner Sammlung habe ich inzwischen einen Großteil weggegeben, mir fehlte der Platz. Als ich bei meiner Mutter auszog, hatte ich schon eine Wagenladung Platten, und mit den Jahren wurden es immer mehr. Heute habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht mehr genug Zeit habe, um mit all den neuen Platten, die ständig herauskommen, Schritt zu halten. Andere Dinge sind in den Fokus gerückt, ich will vor allen Dingen für meine eigene Musik Zeit haben.
In den mittleren neunziger Jahren hast du mit den beiden Sceneries Not Songs-Alben zwei Platten veröffentlicht, die in ihrer Zeit leider nie so richtig im Fokus waren, vermutlich weil beide recht schwer zu bekommen waren. Wieso war das so?
Wir hatten einfach nicht so viele Kopien hergestellt, wir waren nicht sicher, ob es für diese Musik ein Publikum gibt. Die Stücke habe ich jeweils ohne einen echten Plan begonnen, ich improvisierte einfach und nahm das auf, so wie in meinen Anfängen. Ich war mir nicht sicher, ob das den Leuten da draußen gefallen würde. Rückblickend bin ich froh, dass es funktioniert hat.
Diese beiden Platten waren, so wie auch dein kurze Zeit später erschienenes Album Alien, von Soundscapes geprägt. Sceneries Not Songs – Volume Tu enthielt sogar viele Hip Hop-Elemente. Hattest du damals von Clubmusik so ein bisschen die Nase voll?
Na ja, ich mache seit mehr als 30 Jahren Musik, da will man sich entfalten. Egal, was für einen Job man macht, man muss sich weiterentwickeln, damit es interessant bleibt. Ich werde bald 60 und verbringe meine Zeit nicht ständig in Clubs. Wenn ich nur straighte Clubmusik machen würde, wäre das doch nicht ehrlich. Ich bin ja auch früher kein ausgesprochener Clubgänger gewesen, ich bin ein Musiktyp. Um Musik zu haben, muss ich nicht in einen Club gehen. Das mit der Musik fing für mich bei meinen Eltern zuhause an. Mich prägten die Platten, die mein Vater gekauft hatte. Mit der Zeit lernte ich sie zu lieben. Als wir Kinder waren, machten wir uns über die Musik, die bei meinen Eltern lief, lustig – so zum Beispiel über die alte Doo-Wop-Gruppe Sha Na Na oder über Harry Belafonte. Für mich und meine Geschwister war das lächerlicher Kram. Doch mein Vater brachte auch die erste Funkadelic-LP mit nach Hause, oder „Love to Love You Baby“ von Donna Summer. Unsere Eltern führten uns an so viel Musik heran, ohne dass wir uns darüber bewusst waren.