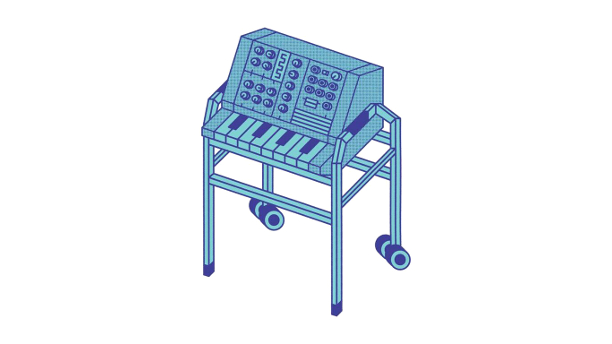Illustration: Super Quiet
Erstmals erschienen in Groove 158 (Januar/Februar 2016)
2015 haben gleich drei wichtige und namhafte Pioniere elektronischer Musik nach langen Pausen neue Alben vorgelegt, alle unter Rahmenbedingungen, die neu in ihrem Werk waren. Fangen wir mit Giorgio Moroder an, dem von vielen verehrten Disco-Überproduzenten, der Donna Summer entdeckt, den Sound of Munich kreiert und später viele erfolgreiche Künstleralben und Soundtracks produziert hat – der aber auch gerade im Backlash seines Albums Déjà Vu von vielen als schon immer überbewertet vom Podest geholt und zum genialen Strippenzieher reduziert wird. Über das Album müssen wir nicht groß reden, es ist in der Tat ein absolut unnötiges Sammelsurium von hochkarätigen Kollaborationen (von Britney Spears bis zu Kylie Minogue) – ganz nach dem Schema: Starproduzent trifft auf Star.
Schuld daran haben Daft Punk, die Moroder für „Giorgio by Moroder“ auf ihrem Album Random Access Memories aus dem Dornröschenschlaf auf den Golfplatz geholt haben und in ihm eine neue Begierde weckten. Eine, die auch nicht von albernen DJ-Sets im Name irgendeiner Marke haltmacht, die Moroder zuletzt öfters dargeboten hat. Hier wird ein Produzent durch die Nachfrage (jeder will ihn einmal gesehen haben, egal mit was) an einen Ort geschoben, an den er nicht hingehört. Und Zitate wie jenes aus dem Gespräch, das Arno Raffeiner mit ihm 2013 für Groove führte, machen die Sache nicht besser: „Natürlich, 20, 30, 40.000 Euro für einen Abend zu kriegen ist ganz schön. Aber das will überlegt werden, zum Beispiel habe ich ein Angebot aus Tokio: Da muss man rüberfliegen, dann hat man den Jetlag, dann muss man arbeiten, um zwei oder drei Uhr nachts, dann wieder zurück, wieder Jetlag…“
Das sieht bei Jean-Michel Jarre, dem französischen Elektronikgroßmeister ganz anders aus. Der eloquente und sich seiner Performanz sehr bewusste Jarre hat seine Musik schon immer auf der größtmöglichen Bühne zu inszenieren gewusst: Lauter, größer, weiter, nicht mal der Himmel ist das Limit – dafür gibt es ja schließlich Laser. Seine Karriere ist eine Jagd nach Superlative gewesen – und zugleich eine künstlerische Suche nach neuen Horizonten. Insofern ist es vielleicht stimmig, dass auch er für sein neues Album Electronica 1: The Time Machine mit 15 Künstlern zusammenarbeitete. Im Gespräch betont er, dass dies allesamt Leute seien, von deren Arbeit er Fan sei, was man kam glauben kann angesichts eines Spektrums, das von Armin Van Buuren und Pete Townshend über Massive Attack und Moby hin zu M83, Fuck Buttons und John Carpenter reicht. So was kann doch niemand, schon gar nicht jemand mit so einen distinguierten Geschmack wie Jean-Michel Jarre hören. Wie auch immer, das Ergebnis kann sich natürlich nicht mit seinen Künstleralben messen lassen. Zu heterogen wirkt das Material. Wobei man Jarre anrechnen sollte, dass er die Reise zu jedem seiner Partner auf sich genommen hat. Es ist ihm dabei aber offensichtlich nicht gelungen, diese immer auf Augenhöhe abzuholen. Oft klingt es nach Jarre minus den Kooperationspartner, nur selten, wie in der Zusammenarbeit mit Tangerine Dream, Laurie Anderson oder auch in dem mit John Carpenter aufgenommenen Stück, werden sinnstiftende Symbiosen erschaffen. Nichtsdestrotrotz: Scheitern im Angesicht der künstlerischen Suche!
Von John Carpenter, dem Regisseur von Kinoklassikern wie Die Klapperschlange, Halloween und Das Ding war gerade schon die Rede. Der Amerikaner ist dafür bekannt, die Soundtracks zu seinen Filmen selbst zu komponieren und einzuspielen. Es handelt sich um einnehmende Synthesizer-Oden, die kongenial den Suspense seiner Filme zu tragen wissen. Auf Einladung des amerikanischen Labels Sacred Bones hat Car-
penter 2015 erstmals ein Album im eigenen Recht (also ohne zugehörigen Film) veröffentlicht. Lost Themes mag nicht die stärksten seiner Kompositionen enthalten, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man seine bisherige Musik immer gestützt von den sich automatisch einstellenden Bildern gehört hat. Lost Themes hingegen ist im Jam mit seinem Sohn über einen längeren Zeitraum und ohne Auftrag im Hinterkopf entstanden. Wenn man einen Killer anschleichen sieht oder wenn das unergründliche Böse sich langsam nähert, kommen einem eben andere Ideen, als wenn man einfach ein bisschen in einem kalifornischen Keller in den Computerspielpausen auf den Synthesizern rumspielt. Carpenters Vorteil: Das Genre und die Herangehensweise bergen nicht die Gefahren, wie sie bei Moroder und Jarre existieren. Er agiert auf seinem ureigenen Terrain.