Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Isolation zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im ersten Teil des März-Rückblicks mit Bell Towers, Daniel Avery & Alessandro Cortini, Electric Indigo und vier weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.
Bell Towers – Junior Mix (Public Possession / Cascine)

Rund ein Dutzend EPs für Labels wie Internasjonal, Hole In The Sky, Unknown To The Unkonwn und CockTail d’Amore umfasst die Diskografie des seit 2011 aktiven, in Melbourne sozialisierten Producers und DJs Rohan Bruce Bell-Towers. Die meisten seiner discoid gefärbten House-Releases erschienen indes auf Public Possession, nun veröffentlichen die Münchner in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Indie-Pop-Label Cascine auch sein Debütalbum. Das ist ein Glücksfall, wie man ihn als Rezensent höchstens alle Schaltjahre die Gelegenheit hat zu besprechen. Der Grund für die Regel, Superlative im Journalismus nur äußerst sparsam zu verwenden, ist ja derjenige, dass man sie für Fälle wie diesen reservieren sollte. Wohlan: Die zehn Songs auf Junior Mix fügen sich zum besten Pet-Shop-Boys-Album, das die Pet Shop Boys nie gemacht haben. Tatsächlich erinnert Bell-Towers’ Timbre nahezu konstant an Neil Tennant, aber auch als Songwriter ist der Wahlberliner dem Team Tennant/Lowe mindestens ebenbürtig. Zwar referenziert Bell Towers’ Popentwurf unverhohlen deren Synthie-Sound Mitte der Achtziger, dabei gelingt ihm aber das Kunststück, absolut gegenwärtig zu wirken. Die Produktion – Compass-Point-Basslines, Bobby-O-Boogie-Grooves, warme Acid-Lines – sagt Dancefloor, die smoothen Vocals und catchy Hooks flüstern Bedroom. Viel befriedigender kann Popmusik nicht sein. Bereits jetzt eines der Alben des Jahres. Harry Schmidt
Camea – Dystopian Love (Neverwhere)

Liebe ist das Thema, das sich als künstlerische Inspiration wohl niemals erschöpft. Mit ihrem Debütalbum Dystopian Love auf ihrem eigenen Label Neverwhere zeichnet die aus Seattle stammende Wahl-Berlinerin Camea den Verlauf einer offenbar nicht gerade glücklichen Liaison musikalisch nach. Das psychedelische Intro aus verhallten Arpeggiator-Spiralen und bedrohlich marschierenden Synth-Chord-Progressions setzt den Ton des Albums, der sich zwischen bedrohlichem Sci-Fi-Techno und melodischem House einpendelt. Der Deep-House-Nummer „Missing You” folgt das traumwandlerische „Together”, in dessen scheinbar verspielter Synth-Melodie sich die nahende Zerstörung des Idylls bereits abzeichnet. „Everyone that I love is gone” singt Camea dann auch im Titeltrack „Dystopian Love”, der als seltsam bouncender Popsong im Zerrspiegel daherkommt. Bei allem konzeptuellen Rahmen bleibt Camea mit treibenden Tracks wie dem sehnsüchtigen „We Danced All Night” oder dem melancholischen „Come Down” schlussendlich aber doch dort am stärksten, wo sie selbst auch zu Hause ist: auf dem Dancefloor, wo die Nacht ein Versprechen ist und sich die Liebenden über das Morgen noch keine Gedanken machen. Laura Aha
Container – Scramblers (Alter)

Seit einer Dekade macht Ren Schofield als Container nun diesen dreckigen Techno. Der Club wird bei seiner Musik wieder zu einem Ort mit verstopften Toiletten, es darf geraucht werden, Ekstase ist willkommen, aber nicht geplant, Whiskey wird geschwenkt, alles ist gut abgehangen. Container gesellt sich damit musikalisch zu Künstlern wie Prostitutes, Shit And Shine, seiner Freundin Unicorn Hard-On, Powell oder auch Helena Hauff. Seine Version von Techno läuft extrem unrund, von einem Viervierteltakt ist mitunter nichts übrig. Ren Schofield ist das Latte (und zwar ohne Macchiato). Beheimatet in Providence, Rhode Island ist der Amerikaner weit weg von Europa und gängigen Club-Konventionen. Sein neues Album heißt überraschenderweise nicht LP wie die vier Alben zuvor. Stattdessen Scrambler, wie die in den 1950er und 1960er Jahren beliebten Motorräder mit breiten Lenkern, geländefähiger Bereifung, sattem Sound. Maschinen, die nur unrasiert und in zerschlissenen Jeans gefahren werden dürfen. Und das passt dann wieder zur Musik. Veröffentlicht wurde das Album bei Alter, wo Luke Younger (Helm) die kompromisslose Schneise zwischen Noise-Rock und avancierter Electronic schlägt. Mit Container hat er jetzt einen Künstler, der beide Lager gleichzeitig bedient. Sebastian Hinz
Daniel Avery & Alessandro Cortini – Illusion Of Time (Phantasy Sound)

Wenn sich Daniel Avery und Alessandro Cortini zusammentun, um Musik zu machen, darf man schon einiges erwarten. Illusion of Time heißt das gemeinsame Projekt, das seit 2018 zusammengetragen wurde, ohne durch eine Deadline übermäßigem Stress ausgesetzt gewesen zu sein – und die Sounds beider Produzenten harmonieren hervorragend! Der, spätestens seit Volume Massimo bekannte, fein inszenierte Pathos Cortinis trifft auf die kriselnde Drone-Melancholie Averys. So schimmert wärmender Ambient in einer absolut schwerelosen Atmosphäre dahin und wird durch vereinzelte Modulation behutsam verzerrt. Leichtes Flirren und Zischen entsteht dadurch zwar, der Fokus wird aber nie darauf gelegt. Deshalb ist keine ernsthafte Konzentration vonnöten, um sich auf die Tracks einzulassen und in eine helle, zum Teil aber auch mystische Stimmung einzutauchen. Der Titeltrack verzaubert. Eine fast schon kitschige, cineastische Synthesizer-Komposition wird von einer Art rauschenden, wuseligen Klangsequenz überlagert. Durch grandioses Mixing erhält das Stück den entscheidenden Drive, der ausreicht, um ihm sofort zu verfallen. Mit dem anmutigen „Inside the Ruins” findet sich außerdem noch einer der Tunes, die scheinbar ernster und verwegener daherkommen. Aber auch hier ist alles so zur sanften Unschärfe hin gemischt, dass man als Hörer*in den vermeintlich aufkommenden Paranoia-Gefühlen immer galant von der Schippe springen kann. Lucas Hösel
Demuja – Atlantic Avenue (Muja)

Bei der Oma den alten Benz ausgeliehen, Klimper-House mit Breakbeat-Attitude ins Nostalgiefach geschoben – und auf stabilem Stoizismus die Atlantic Avenue ins österreichische Hinterland gecruist. Demuja schraubt seit zehn Jahren an den Verbindungen zwischen Disco, House und Drum’n’Bass. Aus seinem Salzburger Studio streamt er seine Jams in die Welt, um auf der Gedankenautobahn zwischen Salzburg, Chicago und dem Motor City Drum Ensemble die wirklich deepen Schlaglöcher mit dicken Bässen zu stopfen. Wer den YouTube-Algorithmus noch nicht mit Guilty Pleasures zerschossen hat, weiß, von was hier die Rede ist. Demujas drittes Album schnippelt die Discokugel von der Decke, schmückt den Laden mit Palmen aus Plastik und kippt drei Mojitos auf ex. Aus den Nebelmaschinen spritzt Desinfektionsmittel, „Power To The People” wird zum Instant Classic. Die Party schaltet drei Gänge rauf, zwei zurück und schmiert California-Beach-Samples mit Spielereien auf Synthesizern, die zwischen Dorian Concept und Richard Dorfmeister auf Retro-Rollschuhen dem Sonnenuntergang entgegenwedeln. Strand, Sommer, Capri-Sonne – und zwar now! Christoph Benkeser
The Eden Expansion – Techno Machine (Self-released)
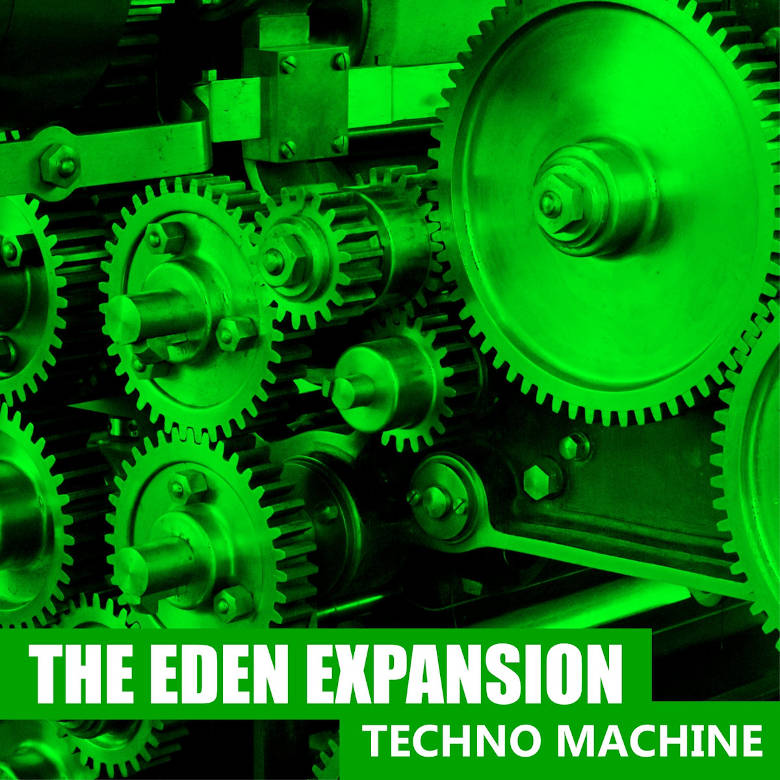
In einem halben Jahr vier EPs und neun Alben veröffentlichen und dabei auch noch mit bestechender Unbedarftheit langsam aber sicher einen eigenen Style zurechtklöppeln? Nein, die Rede ist nicht von Danny Wolfers, obwohl The Eden Expansion vielleicht bald schon als eine Art österreichische Legowelt-Version gehandelt werden könnte. Silas Fiausch ist nämlich nicht nur Sänger, Gitarrist, Bassist und Drummer einer christlichen Black-Metal-Band in Personalunion, der sich musikalisch mittlerweile scheinbar lieber 24/7 in Ableton und FL Studio austobt. Er ist offenbar auch ein Produzent mit jeder Menge Ideen, die er sich nicht scheut ungefiltert in Tracks zu packen und unter Titeln wie „Flashmaster”, „Extremely Deep” oder „Vitamin Bass” auf seinem Bandcamp-Account hochzuladen. Techno Machine ist bereits der fünfte Release, den er sich bislang 2020 geleistet hat (während des Schreibens dieser Rezension sind zwei weitere hinzugekommen). In zehn knackigen Tracks rattert das Album durch klassische Trance- und Techno-Tropen, klingt geradezu kindlich energiegeladen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas übermütig sequenziert, macht aber gerade deshalb verdammt viel Bock. Bremsen gibt es keine, während die Produktion versucht mit Vollgas sämtliche Register gleichzeitig zu ziehen: Bässe, Kicks, Höhen, FXs lasern durch wilde Cuts mit Titeln wie „Bright Bubbles”, „Psychotic Robotic” oder „Bass Lifeforms”, deren Stimmung zwischen einer Überdosis Pep und der Tanzwut früher 2000er-Warehouse-Raves changiert. In mancher Hinsicht ähnelt der Ansatz von The Eden Expansion daher den aktuellen Entwicklungen in der russischen Clubszene, wo diese Form der Retromanie ja auch immer wieder in vollen Zügen zelebriert wird, bevor sie dann durch Europa schwappt – oft genug zu Recht. So klingt das also, wenn jemand ohne großartige subkulturelle Einbettung einfach mal drauf los moduliert und Techno macht, zu dem er selbst gepflegt abzappeln will. Den Typen sollte man im Auge behalten. Nils Schlechtriemen
Electric Indigo – Ferrum (Editions Mego)

Ferrum, Susanne Kirchmayrs zweite LP unter dem Namen Electric Indigo, kann mehreres: Zum einen schaffen die Klänge, für die verschiedenste Dinge aus Eisen Pate standen, ein überraschenderweise durchaus warmes Timbre. Man kann sich Ferrum aber auch gut vorstellen als Industrial-Ambient-OST von so Düsterem wie dem Ego-Shooter Half-Life. Zudem zeigt sie ihre DJ-Seite, lässt teils verhaltene, teils treibende Beats einfließen, die auch für den Dancefloor geeignet sind – wenn auch nur für einen im Kopf. Im ersten, über zwölf Minuten langen Stück „ferrum 1_2” ist das alles enthalten, gegen Ende der Nummer lösen feine Melodien dann etwas die eher bedrückende Stimmung. Bei Ferrum fällt besonders der Farbenreichtum auf. Metall ist hier nicht nur silber (oder rostig-braun), sondern tritt auf in all seinen möglichen Farben. Vor allem aber warm, eher rötlich oder glühend-gelb. „Ferrum 3” ist eine sehr experimentelle Nummer der eher perkussiven Richtung. Es gesellen sich hier Soundbites und Ideen hinzu, die konkrete Bilder entstehen lassen wie z.B. den Klang einer alten Standuhr, die die volle Stunde anzeigt. „Ferrum 4” haut einem direkt einen Satz Industrial-Techno um die Ohren, „Ferrum 5“ erzählt diesen Teil der Geschichte noch weiter: treibende Beats im niedrigen Frequenzbereich. „Ferrum 7” hat auch etwas Drill und geht am leichtesten ins Ohr. Äußerst spitzfindig, diese Klangkunst Electric Indigos. Lutz Vössing
