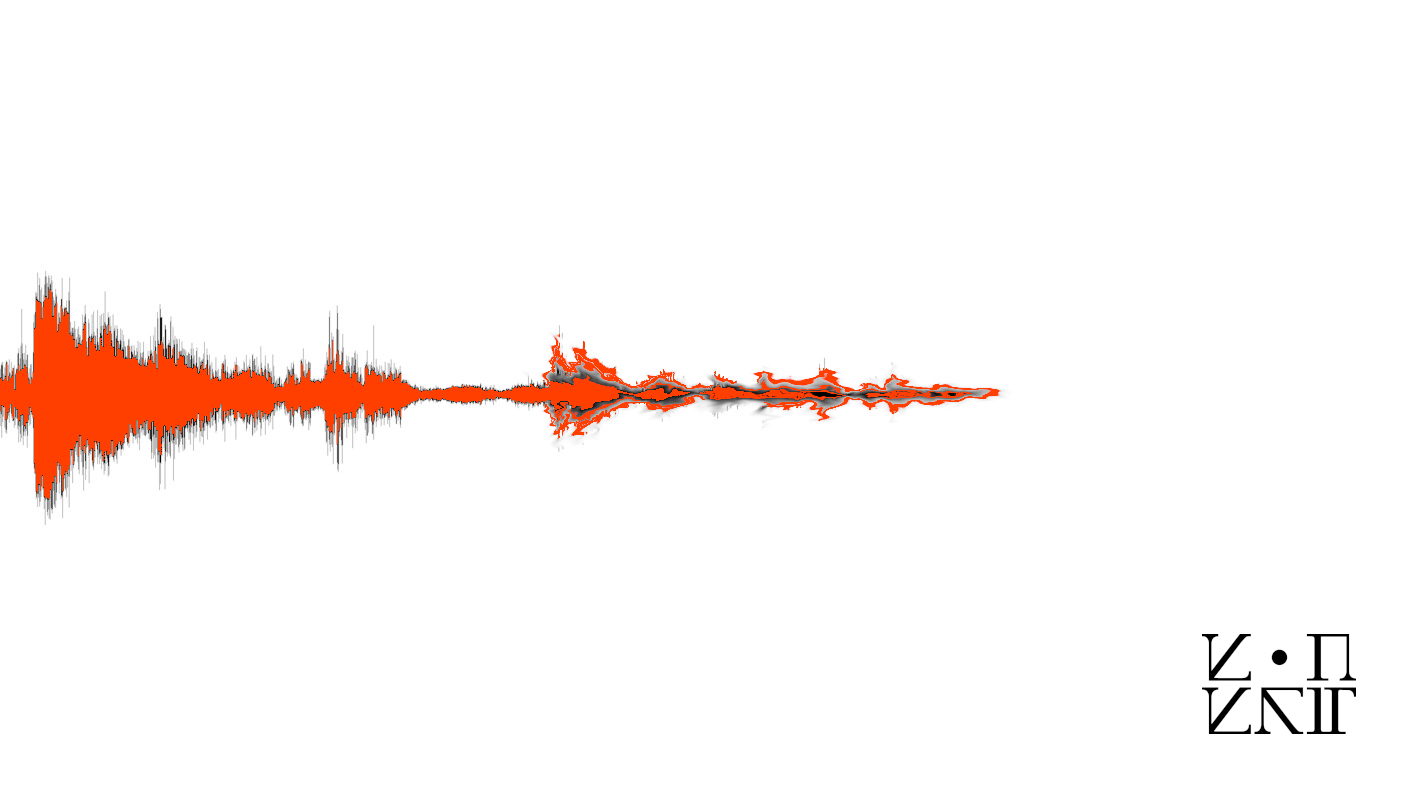Illustration: Kristoffer Cornils. konkrit-Logo: Nicoletta Dalfino.
Seit genau vier Jahren veröffentlicht konkrit-Kolumnist Kristoffer Cornils jede Woche eine neue Folge des Groove-Podcasts. Doch ist der Online-Mix doch eine ziemlich fragwürdige Praxis, die auf jeder Menge (Selbst-)Ausbeutung basiert. Mehr noch: Wie die Mix-CD scheint sich das Format überlebt zu haben. Statt des perfekten Mixings wird mittlerweile zunehmend auf die richtige Mischung aus Gästen und Verwertungsmöglichkeiten für multinationale Großkonzerne gesetzt. Heißt: Gesprächs-Podcast gewinnen langsam aber sicher die Oberhand. Und obwohl mediale Paradigmenwechsel per se nichts Schlimmes sind, tragen am Ende doch nur wieder immer mehr Firmen dazu bei, dass unabhängige journalistische Positionen von der Bildfläche verschwinden. Eine kritische Geschichte des Podcasts.
Vier Jahre sind in unserer schnelldrehenden Szene eine halbe Ewigkeit. Mikrotrends und Revivals kommen und gehen, Clubs öffnen und schließen ihre Tore und Produzent*innen steigen erst in höchste Höhen auf und verglühen dann binnen weniger Monate. Innerhalb von vier Jahren kann ebenso der technologische oder gesellschaftliche Fortschritt das Hörverhalten des Publikums zuhause oder der Crowd auf dem Dancefloor neu sortieren, können ökonomische Veränderungen in unserer fragilen Infrastruktur riesige Löcher schlagen, die umso länger brauchen, bis sie sich wieder geschlossen haben.
Auch das Konsumverhalten wurde dank technologischer und (aufmerksamkeits-)ökonomischer Entwicklungen umgepolt. Die Konsequenzen davon sind nicht immer ganz so erfreulich.
In den letzten vier Jahren habe ich erst als Online-Redakteur und später als freier Autor jede Woche für eine neue Folge des Groove-Podcasts gesorgt, (fast) immer am Freitagmorgen um (mehr oder minder) exakt neun Uhr. In der Zeit hat sich in technologischer Hinsicht einiges geändert. Beispielsweise wurde es zwischenzeitlich endlich möglich, über Soundcloud die Veröffentlichung eines Files vorzuplanen. Das war ein Segen, musste ich doch manchmal nachts um halb vier noch einen Mix hochladen, bevor es zum Flughafen und ab in den Urlaub ging oder mich gar mit fahrigen Fingern um alles kümmern, nachdem ich gerade von einer Party nach Hause gekommen war. Doch auch das Konsumverhalten wurde dank technologischer und (aufmerksamkeits-)ökonomischer Entwicklungen umgepolt. Die Konsequenzen davon sind nicht immer ganz so erfreulich.
Bye, bye, Mix-CD!
Zuerst machte sich auf dem Markt für Mix-CDs der schleichende Paradigmenwechsel bemerkbar. Ostgut Ton wechselte bereits im Jahr 2014 vom CD-Format zu Soundcloud, das zwei Jahre später ankündigte, mit der Einführung eines Abo-Modells an der Gewinnausschüttung über Verwertungsgesellschaften wie der GEMA teilzunehmen. Die Reaktion auf einen Trend, der sich langsam abzeichnete: CDs, vor allem solche mit Mixen darauf, verkauften sich schlicht nicht mehr so gut wie früher, weshalb der Wechsel in die Cloud nur logisch schien. Die Rechnung lautete: weniger Produktionskosten und immerhin ein paar Kleckereinnahmen für die beteiligten Produzent*innen, wenngleich nicht die DJs.
Auch der Club Fabric stellte im Jahr 2018 seine legendäre Serie nach 100 Ausgaben komplett ein. Andere wie etwa DJ-Kicks oder Late Night Tales setzten zunehmend auf größere Namen, veredelte Endprodukte auf dem nun wirklich am wenigsten geeigneten Medium für Mixe – Vinyl – sowie mehr Exklusivität in der Zusammenstellung. Soll heißen, es wurde im Gesamten immer mehr darauf wert gelegt, dass über die eigentliche Selektion und das Mixing hinaus ein Mehrwert erzeugt wurde, der die Leute zur Kasse bat. Keine physischen Mixe mehr ohne Alleinstellungsmerkmal, im Wirtschaftssprech also ein „USP”, das einen Mehrwert verspricht.
Verkaufte sich die klassische Mix-CD früher noch der Mixe an sich wegen, tun ihre physischen Nachfolger es nur dank exklusiver Inhalte und opulenter Aufmachung.
Produzent*innen selbst nutzten das Format in ihrer Doppelrolle als DJs und Musiker*innen zunehmend als Werbeplattform für Musik, die sie selbst geschrieben haben oder zumindest im Anschluss über ihr eigenes Label veröffentlichten: Dan Snaith alias Daphni brachte 2017 sein Album Joli Mai vorab als Fabric-Mix heraus, DJs und Produzent*innen wie Steffi oder Efdemin nutzten das Format eher wie eine Compilation voller exklusiver Tracks, die entkoppelt als alleinstehende Singles verkauft wurden. Eine bunte Tüte Mehrwert also.
Daran ist nicht unbedingt etwas Verwerfliches. Doch zeigt es auf, wie massiv die Digitalisierung im Gesamten und Streaming im Speziellen eine hohe, wenngleich immer auch zweckmäßige Kunst aus den Anfangstagen der Dance Music abgelöst hatten: das vormals noch als Kassette kursierende und zumeist kostenfreie Mixtape, das DJs damals noch als musikalisches Bewerbungsschreiben bei Clubs anboten oder über das die neuesten Tracks mit einer Schar Eingeweihter geteilt wurden.
Mit der Mix-CD fand eine Tradition ihr leises Ende. Weltbewegende Mix-CDs wie die von Kruder & Dorfmeister, Global Communication und Richie Hawtin wären heutzutage kaum denkbar, weil sie schlicht nicht mehr rentabel sind. Denn die Produktion ist für Labels, DJs und Künstler*innen kaum mehr den (Mehr-)Aufwand wert, solange das Publikum auf einem übersaturierten Markt nicht mit etwas ganz Besonderem geködert werden kann. Verkaufte sich die klassische Mix-CD früher noch der Mixe an sich wegen, tun ihre physischen Nachfolger es nur dank exklusiver Inhalte und opulenter Aufmachung – das jeweilige Gesicht hinter der Zusammenstellung sorgt nur für optimale Aufmerksamkeitsmaximierung.
Paradigmenwechsel im Podcast-Game
Dazu trugen zuerst natürlich die zahlreichen Online-Mixe bei, die später über das Podcast-Format organisiert und serialisiert wurden. Diese Serialisierung griff die von physisch erhältlichen Reihen wie der DJ-Kicks-Reihe auf und machte den Konsum von Mixen in einer Online-Umgebung gleichermaßen bequemer wie ritualistischer, nahm den eigentlichen Mixen jedoch ihre Einzigartigkeit. Ist heute noch vorstellbar, dass ein Mix wie DJ ruptures gold teeth thief, hochgeladen im Jahr 2001 über eine private Website, einmal um die Welt geht und quasi über Nacht den verantwortlichen DJ sowie die darauf enthaltenen Tracks, den Sound und das Konzept eines Sets weltweit und nachhaltig bekannt macht? Wohl kaum.
Stattdessen etablierten sich Ende der Nuller- und Anfang der Zehnerjahre Podcasts als das tonangebende, übergeordnete Format. Vielleicht eine Ironie des Schicksals: Besteht das eigentliche Handwerk von DJs seit jeher vor allem in der Kuration, wurden sie durch kuratorisches Handwerk in die zweite Reihe gedrängt. Podcasts wie der von Steve Mizeks Online-Zine Little White Earbuds oder natürlich Resident Advisor und FACT dominierten plötzlich das Game. Weniger wichtig schien auf einmal, was DJ XY über eine Stunde lang an den Decks erledigte, sondern vielmehr, welche*r DJ mit welchem Sound wohl nächste Woche dran sein würde, um die Wartezeit aufs Wochenende zu versüßen.
Die größenwahnsinnige Idee, die mich bei der Planung des Groove-Podcasts antreibt: Ein Podcast bietet langfristig die Chance, für mehr stilistische Abwechslung auf den Dancefloors zu sorgen.
Das geschah seitens der Podcast-Betreiber*innen natürlich nicht aus purem Eigennutz. Magazine wie FACT, Resident Advisor und natürlich auch Groove zogen über die wöchentlich angebotenen Mixe mehr Publikum auf die Seite – und mehr Besucher*innen heißt auch mehr Einnahmen, ob nun aus Werbeeinnahmen auf der Homepage oder etwa, wie bei Resident Advisor, potenziell mehr Verkäufe über den hauseigenen Ticket-Shop. Noch deutlicher sind die Absichten von Labels oder Partyreihen mit eigenem Podcast: Hier präsentieren sich überwiegend DJs, deren Platten verkauft werden sollen oder die demnächst bei einem der kommenden Clubabende spielen, und die qua Mix ihrem Publikum schmackhaft gemacht werden sollen.
Zudem sich natürlich auch bei Magazinen aus redaktioneller Hinsicht eine Chance bot, zwischen größeren Namen die eine oder andere kleine Nummer unterzuschummeln, die dank eines Mixes vielleicht mehr Bookings an Land ziehen kann. Die größenwahnsinnige Idee dahinter, die mich ebenso bei der Planung des Groove-Podcasts antreibt: Ein Podcast bietet langfristig die Chance, für mehr stilistische Abwechslung auf den Dancefloors zu sorgen. Und wer weiß: Vielleicht kommt sogar etwas Geld für Produzent*innen heraus, deren Tracks dank beigegebener Tracklists leicht identifizierbar sind. In der Theorie zumindest.
Der übersaturierte Online-Markt
Doch wie die Mix-CD durch mediale Entwicklungen überflüssig geworden war, stellte sich bald eine Übersaturierung des Online-Markts ein. Das zeigte sich nachhaltig an den Zahlen: War es vor vier Jahren noch geradezu undenkbar, dass an einem Freitagabend zu Feierabend ein Groove-Mix nicht auf 2000 Plays gekommen war, dümpeln manche mittlerweile noch ein paar Tage nach Veröffentlichung bei der Hälfte herum. Selbst bekannte Gesichter, große Namen sind heutzutage trotz handwerklicher Qualitäten und toller Selektion nicht immer ein Garant für hohe Einschaltquoten.
Warum dem so ist, scheint mehr als offensichtlich. Einerseits ist die Konkurrenz schlicht zu groß. Etablierte Podcasts überschatten häufig das Gesamtgeschehen, Nischen-Podcasts mit einem thematischen oder regionalen Schwerpunkt binden ein festes Publikum an sich und der Rest des Publikums zappt noch durch ganz andere Kanäle. Es gibt eben auch zum Musikhören nur 24 Stunden am Tag, und die Zeit will dementsprechend gut aufgeteilt werden. Andererseits aber laden auch viele DJs mittlerweile in Monatsabständen neue Mixe ins Netz. Das Alleinstellungsmerkmal, der USP, entfällt so langsam aber sicher, und das breitenwirksam.
Um es deutlich zu sagen: Die riesige Podcast-Maschinerie, die sich über die letzten zehn bis 15 Jahre im Internet ausgeprägt hat, baut bis in den letzten Handgriff auf (Selbst-)Ausbeutung auf.
Es ist ein merkwürdiges Gefühl, daran mitgewirkt zu haben. Zum einen, weil von diesen Mixen – so erfolgreich sie manchmal auch sein können – nur wenig bis überhaupt kein Geld an die eigentlichen Produzent*innen geht. Oder hat hier schonmal jemand einen GEMA-Scheck dank Soundcloud-Ausschüttung erhalten? Zum anderen ist es perfide, weil die DJs selbst Kosten, Mühen und unbezahlte Arbeitszeit auf sich nehmen, damit jeden Freitagmorgen um 9 Uhr eine neue Ausgabe des Groove-Podcasts online geht.
Um es deutlich zu sagen: Die riesige Podcast-Maschinerie, die sich über die letzten zehn bis 15 Jahre im Internet ausgeprägt hat, baut bis in den letzten Handgriff auf (Selbst-)Ausbeutung auf. Selbst wenn damit sowohl den Podcast-Betreiber*innen wie auch den DJs immer wieder Möglichkeiten werden, sich wirtschaftlich innerhalb der Szene Vorteile zu verschaffen: Kaum jemand außer den Podcast-Betreiber*innen hat einen instantan messbaren Gewinn für sich zu verbuchen.
Das alles macht das (Nicht-)Geschäft mit den Podcasts jedoch noch lange nicht zur zynischsten Ausprägung von Prozessen, die unsere Szene fest im Griff haben. Allerhöchstens ist es ein Spiegelbild dessen, wie die Dinge im Lalaland Nacht für Nacht eben so ablaufen. Doch bedarf es gerade deswegen einer kritischen Reflexion dieser Abläufe, und das obwohl sie sich im Niedergang befinden. Denn wenn etwas feststehen sollte, dann dies: Sobald sich strukturell – technologisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich – etwas verändert, gibt es immer Opfer zu beklagen. Die Übersaturierung des Online-Mix-Markts und die latente (Selbst-)Ausbeutung – selbst das alles gerät in Bedrängnis. Denn der Begriff Podcast steht heutzutage nicht mehr synonym für DJ-Mix. Sondern für etwas anderes, das immer nur in zweiter Linie mit Musik zu tun hat.
Der Einschlafstoff
Ende des Jahres 2018 machte mir ein einzelner Kommentar auf der Facebook-Seite der Groove klar, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hatte. Unter einem Posting mit der neuesten Ausgabe des Groove-Podcasts echauffierte sich ein User: Das sei doch kein Podcast, sondern ein DJ-Mix! Podcasts seien etwas ganz anderes, hieß es sinngemäß. Als Journalist lege ich ja selbst Wert auf korrekten Sprachgebrauch und habe meinen Kolleg*innen immer wieder eingehämmert, dass ein Podcast kein DJ-Mix sei. Meine Eselsbrücke: Ein Podcast verhält sich zu einem DJ-Mix wie eine Pille Ecstasy zu MDMA: Wenn du Glück hast, ist im Ersteren Letzteres enthalten, muss es aber nicht. Der Begriff „Podcast” bezeichnet nur das Format („eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien (Audio oder Video)”, sagt Wikipedia), der DJ-Mix den Inhalt (also Audiodateien). Das Format Podcast kann sich selbstverständlich auch auf andere Inhalte zusammensetzen, beispielsweise mitgeschnittenen Gesprächsrunden. Das genau meinte der erboste Facebook-Nutzer: Da legt doch jemand auf, aber niemand labert! Kann doch kein Podcast sein.
So banal diese Anekdote sein mag, belegt sie doch exemplarisch eine semantische Verschiebung in unserem Verständnis des Begriffs „Podcast”, welche sich wiederum auf mediale und gesellschaftliche Entwicklungen zurückführen lässt. Gesprächs-Podcasts dominieren mittlerweile zunehmend den Audio-Markt. Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music oder Deezer liefern sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen darum, den aktuell noch im Aufschwung befindlichen Markt für Gesprächs-Podcasts unter sich aufzuteilen, bevor auch dort vermutlich in wenigen Jahren die Übersaturierung eintritt.
Wer kennt nicht mindestens eine Person aus dem engeren Freundeskreis, die „echt nur noch einpennen kann, wenn ein Podcast nebenbei läuft”?
Das ist lohnenswert: Je mehr Gesprächs-Podcasts etwa auf Spotify gehört werden, desto weniger muss das schwedische Unternehmen an Tantiemen für Künstler*innen abdrücken, als es das sowieso schon tut. Mehr noch kümmert es sich mittlerweile sogar darum, bald in einzelnen Folgen Werbung einblenden zu können, um an der – abseits der großen Promi-Podcasts und Originalproduktionen überwiegend auf Selbstausbeutung hinauslaufenden – Arbeit der Podcast-Betreiber*innen mitzuverdienen und dabei großzügig mit den Daten seiner User*innen hausieren zu gehen. Im großstädtischen Alltag zeigt sich derweil an den glasigen Augen und dem Gekicher der Sitznachbar*innen in der Bahn, wie oft und zu jeder Gelegenheit Gesprächs-Podcasts konsumiert werden. Und wer kennt nicht mindestens eine Person aus dem engeren Freundeskreis, die „echt nur noch einpennen kann, wenn ein Podcast nebenbei läuft”?
Auch im Bereich der Dance Music wird sich der Einschlafstoff zunehmend verabreicht. Beispiele gibt es genug, das Prinzip ist immer dasselbe. Rund eine Stunde lang plaudern DJs, Produzent*innen oder andere Szenemitglieder mit den Moderator*innen über dieses oder jenes Phänomen, über die Studioarbeit und übers Auflegen. Hier geht es um 30 Jahre Techno, dort um den Job des Türstehers, dann wiederum darum, wie am heimischen Gerätepark eine kreative Krise überkommen werden kann. In vielerlei Hinsicht scheint das für alle Parteien eine Win-Win-Situation zu sein: Das Publikum kann sich während des abendlichen Abwaschs über die Geschichte und zeitgenössischen Entwicklungen der Szene oder aber schlicht über die Marotten seiner Lieblings-DJs informieren, die sich wiederum selbst unmittelbar und deshalb (weitgehend) ungefiltert zum Ausdruck bringen können.
Hier Underground-Techno, dort Produktwerbung
Der Erfolg des Formats scheint dem Recht zu geben. Doch spaltet sich das Feld von Anfang an in nur zwei verschiedene Kohorten auf: Auf der einen Seite stehen stehen weniger professionelle Journalist*innen und vielmehr Amateur-Podcaster*innen, die nicht selten über Spendenportale wie Patreon versuchen, ihre Kosten reinzubekommen. Von ihnen gibt es – erst recht auf dem deutschen Markt – herzlich wenige. Auf der anderen aber stehen Unternehmen, für die das Podcast-Geschäft vor allem Mittel zum Zweck ist, ihr Angebot zu bewerben. Sie sind professionell, erfolgreich und machen ihre Sachen gut. Nur eben mit zum Teil gruseligen Resultaten.
Von der einen auf die anderen Sekunde wird aus der Journalistin eine Marketerin, die Konzerninteressen vertreten muss, statt im Interesse ihres Publikums die richtigen Fragen zu stellen.
Das ist das Problem an den Gesprächs-Podcasts: Wenn sie nicht von Amateur*innen betrieben werden, sind sie vor allem Träger für die wirtschaftlichen Interessen der dahinterstehenden Unternehmen – und das noch viel mehr als der klassische Online-Mix, den sie langsam aus der allgemeinen Aufmerksamkeit verdrängen. Das gilt für die Formate von Resident Advisor und anderen, die das Podcast-Format eben auch unter wirtschaftlichen Aspekten ausbauen. Deutlicher noch aber sind die Angebote von Firmen aus fremden Branchen an Profitinteressen gekoppelt: Hier sollen sich im selben Zug Integrität und Coolness in einer vitalen Subkultur er-(und im besten Fall gleichzeitig noch ein Produkt ver-)kauft werden. Das geschieht aber nicht in klarer Trennung von redaktionellen und werbenden Inhalten, sondern on the fly im Gespräch – die Grenzen zerfließen und im selben Zug wird die Rolle der*des Moderatoren aufgeweicht: Von der einen auf die anderen Sekunde wird aus der Journalistin eine Marketerin, die Konzerninteressen vertreten muss, statt im Interesse ihres Publikums die richtigen Fragen zu stellen.
Das ist nicht unbedingt deswegen besorgniserregend, weil es als Format die Online-Mix-Podcasts von links überholt. Sondern vielmehr, weil es die kritische Reflexion über unsere Szene zunehmend unterbindet. Wo etwa der vor Kurzem noch Wellen schlagende True–Crime-Podcast zu den Vorgängen im Berliner Greenhouse eine investigative Glanzleistung war, handelt es sich bei den Gesprächs-Podcasts der Dance-Music-Szene weitgehend um Personality-zentrierte Formate. Vorgemacht, wenngleich auf hohem Niveau, hatte es die Red Bull Music Academy mit ihren sogenannten Masterclasses im Bewegtbildformat. Gestreamt werden diese personenzentrierten Podcasts weniger den Themen, sondern vielmehr der Prominenz wegen – bekannte DJs und Produzent*innen, die in solcherlei Situationen nur selten Kritik an den Umständen üben wollen. Zumal das schätzungsweise von Unternehmensseite gar nicht erst gewünscht wird.
Die Friede-Freude-Eierkuchen-Ideologie
Im direkten Live-Gespräch, das nachträglich immer noch editiert und geglättet werden kann, wird somit selten konfrontativ diskutiert und das Gros der Gesprächs-Podcasts scheint sich einer Friede-Freude-Eierkuchen-Ideologie verschrieben zu haben, die nur eine vorgebliche ist: Es wird eben ein bisschen über dieses und jenes geschnackt, alle verstehen sich blendend und gehen dann zufrieden nach Hause. Der Mehrwert dieses Formats liegt für die Hörer*innen also sicherlich in der Unterhaltung, nicht unbedingt aber im Anstoß zum Nachdenken über die größeren Zusammenhänge in der Szene. Ähnliches gilt auch sicherlich für den klassischen Print- und den Online-Musikjournalismus, allerdings wird dort – zumindest im Idealfall – Werbung von journalistischen Inhalten strikter getrennt. Wer hielte es schon für eine sinnige Idee, zwischen kurzen Werbeeinblendungen für ein Multimedia-Streaming-Abo oder unter dem Logo eines roten Rinds über die kapitalistische Überdehnung der Szene oder sonstige Übel innerhalb der Community zu debattieren, wenn die Geldgeber_innen das Format hosten? Eben.
Doch genauso, wie es wichtig gewesen wäre, die Mechanismen des Podcast-Angebots für Online-Mixe rechtzeitig zu hinterfragen, sollten wir uns nun kritisch dem Angebot nähern, von dem wir uns zunehmend in den Schlaf labern lassen.
Vier Jahre sind in unserer schnelldrehenden Szene eine halbe Ewigkeit, und in den vier Jahren, seitdem der Groove-Podcast zu einer wöchentlichen Institution in meinem und – hoffentlich – auch eurem Leben wurde, hat sich einiges getan. Die Mix-CD fand ihr (folgerichtiges) Ende, der Markt für Online-Mixe ist übersaturiert und das nächste, noch einigermaßen frische Angebot steht in den Startlöchern, um das Ruder zu übernehmen. Daran ist per se nichts Verwerfliches, so sieht Fortschritt eben aus. Doch genauso, wie es wichtig gewesen wäre, die Mechanismen des Podcast-Angebots für Online-Mixe rechtzeitig zu hinterfragen, sollten wir uns nun kritisch dem Angebot nähern, von dem wir uns zunehmend in den Schlaf labern lassen. Denn dass Online-Mixe ihren Zenit überschritten haben mögen? Geschenkt. Dass multinationale Konzerne jedoch daran verdienen wollen und damit die Diskussion um unsere Kultur erodieren lassen? Au backe.