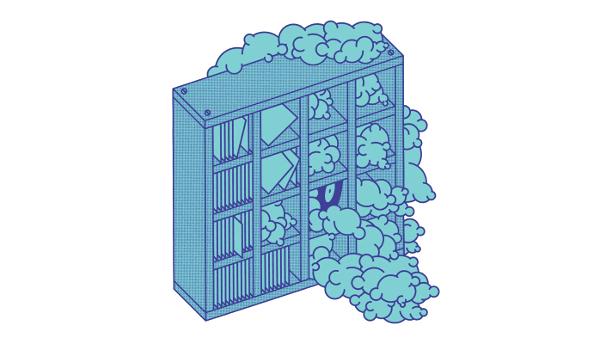Illustration: Super Quiet
Erstmals erschienen in Groove 158 (Januar/Februar 2016)
Tränen wurden kaum vergossen, als sich 2015 MP3 als vorherrschendes Medium für elektronische Musik verabschiedete. Sei es über Youtube, SoundCloud oder Spotify: Die meiste Musik wird heute als Stream gehört. Die MP3-Verkäufe bei Beatport brachen im Lauf des Jahres um 30 bis 35 Prozent ein. In der Streaming-Szene tat sich viel, amerikanische Medien sprechen von den „Streaming Wars“: Mit Getöse ging Apple Music an den Start, wurde von Taylor Swift zurechtgewiesen und irritierte die User mit einem komplizierten Interface. Tidal richtet sich als Musikerinitiative an audiophile Hörer. SoundCloud geriet zwischen die Fronten der Interessen von Usern und Major Labels bzw. Verwertungsgesellschaften. Spotify baute seine Marktführerschaft aus. In seiner Attraktivität für die Hörer ist Spotify nicht zu überbieten, neuerdings auch im Bereich der elektronischen Musik: Die größere Zahl der zehn erfolgreichsten Tracks aus den aktuellen Groove-Charts sind bei Spotify zu finden. Und wenn nicht der entsprechende Release dabei ist, dann doch eine Auswahl von Tracks des jeweiligen Künstlers. Der Hörer ist da zweifellos der Gewinner: Seit Musik aufgezeichnet wird, waren nicht so viele Songs für so wenig Geld zu haben. Aber was bedeutet der Schwenk zum Streaming für die Labels und die Künstler? Profitieren sie von der Präsenz auf den (mehr oder weniger) global verfügbaren Plattformen? Oder werden sie um den Verdienst für ihre Arbeit gebracht?
Die ganz großen (Adele, Thom Yorke, The Beatles) und die ganz kleinen (die auf Bandcamp ein paar Hundert Alben verkaufen oder eine Vinyl-Only-Strategie fahren) können auf Streaming verzichten, weil sie durch den exklusiven Vertriebsweg ihre Marke stärken. Alle anderen sind mehr oder weniger unmittelbar gezwungen, sich mit ihren Tracks unter die viel zitierten 30 Millionen Songs der Streaming-Plattformen zu mischen. Dabei scheint es zurzeit dem unteren Mittelstand an den Kragen zu gehen, während sich die obere Mittelklasse halten kann. Besonders hart sind Club-orientierte Labels betroffen, die von den vergleichsweise hohen Trackpreisen auf Beatport profitierten. Um den Erlös aus dem Verkauf eines einzigen Tracks über Beatport durch Spotify-Streams zu kompensieren, müsste der betreffende Track circa 100 bis 200 mal geklickt werden. Der elektronische Producer, der seine Aufnahmen nicht durch Konzerte querfinanziert, ist einer der großen Verlierer des Umbruchs. So liegt der Kardinalfehler der Streaming-Anbieter darin, dass sie die Musik für viel zu wenig Geld anzubieten. Die sogenannten High Spender, die früher jede Woche mehrere Tonträger kauften, können überhaupt nicht mehr als zehn Euro im Monat für Musik ausgeben – es sei denn, sie kaufen Vinyl oder sie spenden. „Das Subscription-Modell funktioniert für die Masse, aber wir erzeugen keine Masse“, erklärt Ronny Krieger vom Vorstand des Verbands unabhängiger Musikunternehmen. So liegt für ihn die Herausforderung der (großen und kleinen) Labels darin, die Streaming-Services dazu zu bewegen, für das Freemium-Modell nur einen Teil der Songs anzubieten und so mehr Menschen dazu zu bringen für die Musik zu zahlen. Dagegen argumentiert SoundCloud-Gründer Eric Wahlforss, dass ohne Freemium-Angebot kein Hörer dazu zu bringen sei, eine neue Plattform auszuprobieren.
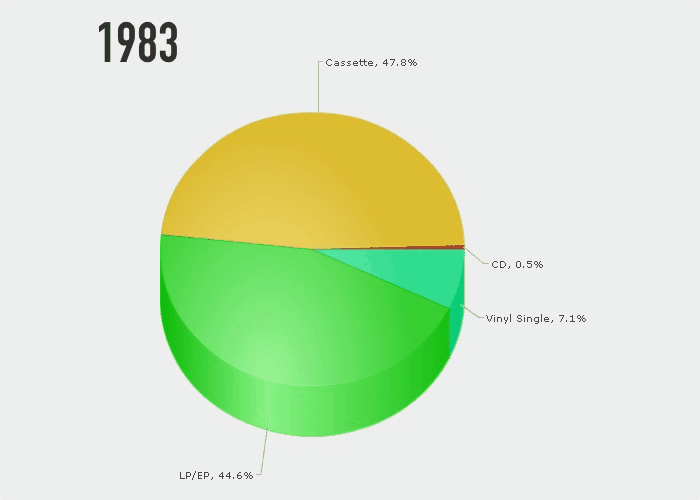
Animation der Aufteilung von Musikkäufen der letzten drei Jahrzehnte (via Digital Music News)
Für die elektronischen Labels mit einem breiteren Publikum sieht die Situation positiver aus. Sie bewerben mit den Streams ihre Plattenverkäufe und über angeschlossene Booking-Agenturen oft auch Konzerte und Events. Der High-Spender zahlt zwar wenig für den Stream, wird durch ihn aber gelockt: Vinyl, CDs – ja, auch die spielen noch eine Rolle, besonders hierzulande –, T-Shirts und Konzertkarten zu kaufen. Bei vielen Labels hat in den vergangenen Jahren ein Umdenken in Bezug auf das Streaming stattgefunden. Früher wurden auf Youtube und SoundCloud vorwiegend Snippets neuer Releases hochgeladen und Spotify, Deezer etc. belieferte man erst ein paar Wochen nach Release. Marit Posch, Labelmanagerin von Monkeytown und 50Weapons, bringt es auf den Punkt: „Natürlich könnten wir das neue Moderat-Album nach Release für zwei Wochen nur als Tonträger und als MP3 anbieten. Aber mittlerweile sind so viele Fans bei Spotify, dass die uns die Türen einrennen würden.“ Dabei hat Spotify im Streaming ein Quasi-Monopol: Wenn Spotify in einem Monat an Monkeytown und 50Weapons 5000 Euro ausschüttet, sind es bei Deezer oder Wimp Beträge zwischen 100 und 150 Euro.
Was ist die Moral der Geschichte? Ein pauschales Urteil ist kaum zu fällen. Bei Clublabels flackern die Lichter. Es gibt aber auch Künstler, die von der unbeschränkten Verfügbarkeit ihrer Musik profitieren. Statt darüber zu jammern, dass auch Musiker ihre Miete zu zahlen haben, ist es sinnvoller, darüber nachzudenken, mit welcher Strategie die gegenwärtige Situation am besten zu bewältigen ist. So wie Taylor Swift nur bei Apple Music und Prince nur bei Tidal vertreten ist, muss jeder elektronische Künstler, jedes elektronische Label seinen eigenen Weg finden. Das Potenzial liegt darin, eine ganz persönliche Nische zu definieren, die mit der Live- und Social-Media-Strategie harmoniert. Denn der publikumsscheue Nerd, der sich allein durch seine Plattenverkäufe über Wasser hält, scheint der Vergangenheit anzugehören.