Au Suisse – Au Suisse (City Slang)

Ob „Caught Up”, „The Art of Hot” oder „Miura”: Einige der größten Metro-Area-Hits der Nullerjahre verdanken ihren Status als wegweisende Clubmusik-Ikone nicht zuletzt auch den Stringarrangements von Kelley Polar. Umgekehrt war es Morgan Geist, der den an klassischen Streichinstrumenten ausgebildeten Michael Kelley darin bestärkte, eigene Musik zu schreiben und dessen Output schließlich auch produzierte und auf seinem Label Environ veröffentlichte. Trotz aller Nähe und Verbundenheit – Kelley und Geist sind sich vor Jahrzehnten auf dem Oberlin College in Ohio zum ersten Mal begegnet – ist Au Suisse die erste Zusammenarbeit der beiden Musiker, bei der die Rollen nicht bereits vorab klar verteilt und gewichtet waren: als Duo auf Augenhöhe, das gemeinsam Songs schreibt. Ihr Debütalbum ist dazu angetan, konservative Fans des einen wie des anderen zu enttäuschen. Auf ihre jeweiligen Trademark-Signale haben sie bewusst verzichtet.
Dancefloor-Resonanz und optimierte Post-Disco-Grooves sucht man auf Au Suisse ebenso vergebens wie an Minimal Music geschulte Streicherfiguren. Stattdessen entwerfen die neun Stücke eine imaginäre Topografie in graublauen Klangfarben, die Reminiszenzen an den weißen Funk im Synth-Pop der ersten Hälfte der Achtziger evoziert. Acts wie The System, Double oder auch Scritti Politti standen hier Pate, aber auch ein Quäntchen Art-Poprock à la Roxy Music und Spurenelemente exzentrischer Songwriter wie Scott Walker („AG”!) sind auszumachen. Bereits bei Metro Area war ein spezifisches Verhältnis zum Kantablen, Vokalen angelegt. Was zunächst noch im Modus der Abwesenheit präsent war, hat Geist in späteren Produktionen integriert: Am durchschlagenden Erfolg der Strom-Queen-Produktionen der frühen Zehnerjahre hatten auch die Vocals von Denis C. Scott entscheidenden Anteil. Hier sind nun alle Tracks tatsächlich auch Songs.
Manche, wie „Pain & Regret“ – insbesondere hier drängt sich der Eindruck eines bewussten Rekurses auf die Arif-Mardin-Produktionen für Green Gartsides Scritti Politti von 1984 auf –, das dann doch recht hittige „Thing” oder das von einer isolierten Funkwave-Bassline getragene „Plans”, durchaus mit Blick auf den Dancefloor, andere, wie der sich erst gegen Ende auftürmende Opener „Control” oder das grandios melancholische, ein wenig an die Pet Shop Boys erinnernde „Savage”, als epische Elektronik-Ballade. „Getting the emotional balance right – that was the greatest challenge, and the most fun”, meint Geist. Vergnügliche Herausforderung, herausforderndes Vergnügen in der Tat – mit seinem Einstand ist dem Duo Au Suisse ein zwischen den Polen Einsamkeit und Verlangen oszillierendes und großartig austariertes Synth-Popalbum gelungen. Harry Schmidt
Broken English Club – The Artificial Animal (Death & Leisure)
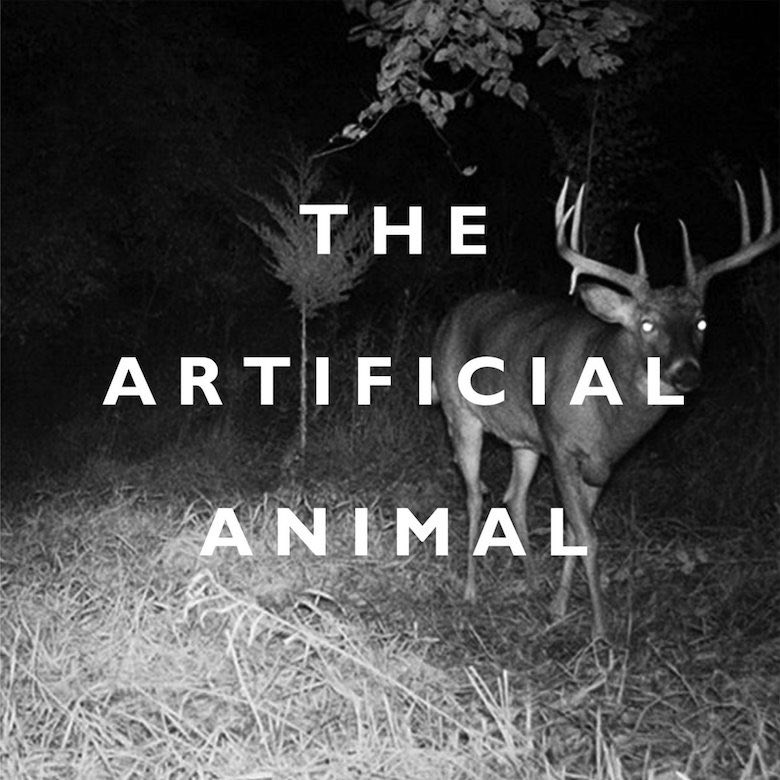
Oliver Ho mag das Abgeschranzte und Angefräste. So auch auf The Artificial Animal, dem Album, das er unter seinem Pseudonym Broken English Club veröffentlicht. Es beginnt bei 125 BPM mit einem stehenden Beat, in den sich das Industrielle mehr und mehr einschleicht, bis die Drum-Bass-Lokomotive ins Rollen kommt und mechanisch anzieht. Suspense baut der Londoner Produzent mit harmonischer Monochromie auf, melodisch passiert nichts. Nach drei Minuten ein Akkordwechsel, der noch mehr Spannung aufbaut und dann rollt es wieder auf den alten Schienen aus.
The Artificial Animal ist schrecklich düster, wie eine filmische Dystopie, und nur für die finstersten Peaks im Mix zu haben. Dann aber wirklich, wie in „Snub”, das so richtig nach schlechtem Koks klingt, oder in „Blood And Wire”, dessen Titel fetzt wie ein Horror-Crime-Mashup und dies in die Tat umsetzt: Maschinengewehrrattern, die Stimme des Bösen, hui, hui, hui. „The World Is On Fire”, so lautet hier das Credo, und das kann über die Länge von zwölf Stücken auch ermüden, da Dystopien meist wenige Auswege oder gute Enden aufschimmern lassen, im besten Fall noch für die Held:innen, doch die gibt es ja auf einem Pop-Album nicht.
Wobei sich darüber reden lässt, ob The Artficial Animal ein Konzeptalbum ist, ähnlich wie The Whos Tommy oder Drexciyas Neptune’s Lair. Held:in wäre dann vielleicht das benannte Tier oder eben eine menschliche Figur, die jenem Tier auf der Fährte ist. Da auch der Titeltrack als Stimm-Nervenkostüm-Geräusch-Collage erklingt, bleibt dies offen. Ein gutes Archiv meisterhaft verarbeiteten Materials ist das Album eh. Christoph Braun
Danvers – Gently Ascending (Fantastic Voyage)

Der Titel von Joe Danvers‘ erstem Soloalbum suggeriert eine sanfte Steigerung, einen sanften Anstieg. Aber schon nach wenigen Tracks steht unmissverständlich fest: Danvers ist ein Raver! Es stimmt zwar, weder seine Stücke ballern, noch malt er in großen plakativen Lettern – aber sanft geht anders. Zum Glück, denn diese Party macht extrem viel Spaß.
Joe Danvers, der zusammen mit Warren Cummings auch das Duo Kassian bildet, knöpft sich verschiedene Spielarten des Dance-Music-Kosmos‘ vor – von Electro und Acid über Dub bis Deep-House –, fügt den klassischen, stilprägenden Elementen aber immer einen so starken Eigenanteil hinzu, dass das Album eine ganz persönliche Prägung bekommt. Sicher, nicht das allerneueste Prinzip. Aber das Besondere dabei ist, dass der Brite in der Mehrzahl der Tracks auf Gently Ascending um einiges über das übliche Aneignen und Verarbeiten klassischer Genredefinitionen hinausgeht. Es liegt ihm weitaus weniger an stilgetreuer Rekonstruktion als an seinem persönlichen Ausdruck, seinem Klangbild, seinen spezifischen Strukturvorstellungen. Die Klammer bildet dabei seine Sicht auf Electro, die weniger detroit-dirty daherkommt, sondern polierter, in gutem Sinne tech-housiger.
Etwas aus der Reihe tanzen nur der sechste Track namens „Burnt”, eine schnelle Four-to-the-Floor-Nummer mit im Vergleich zum Rest der Tracks recht mainstreamigen Techno-Pop-Genen, die aber durchaus ihren Reiz haben, und der Titeltrack am Ende, der ebenfalls mit durchgehender Bassdrum und noch schnellerem Puls geschmackssicher zwischen trancigen und minimalistischen Elementen changiert.
Nebenbei: Kein Wunder, wenn sich beim Hören von Gently Ascending der Wunsch nach einem DJ-Set, bestehend aus den breakbeatigen Tracks des Albums, einstellt – alle Stücke wurden aus Jams entwickelt, die für Danvers‘ neues Live-Set produziert wurden. Mathias Schaffhäuser
Jeigo – Cerulean (Air Miles)

Einige Stücke dieses Albums hätten Anfang der Nullerjahre auf City Centre Offices, die meisten aber Anfang der Zehnerjahre auf Four Tets Label Text erscheinen können. Beides ist als Kompliment und Zweites sogar als Bestätigung zu verstehen: Jack Carr Miles, der mit Cerulean sein Albumdebüt als Jeigo vorlegt, orientierte sich explizit an Kieran Hebdens Piratenradio-Nostalgie-LP Beautiful Rewind für diese zehn Stücke, die den Dancefloor auf links krempeln und dabei nicht selten mit sphärischem Verve ins IDM-Wohnzimmer umkippen lassen.
Der Titel Cerulean beschreibt schließlich einen der freundlichsten und wärmsten Blautöne, eine Form von gut gelaunter Melancholie – passend dazu, dass sich Mills damit während des Lockdown-Hoppings der Jahre 2020 und 2021 erfolgreich etwas von der Seele geschrieben hat. Selbst bouncender Techno klingt da so freundlich wie dereinst bei Jon Hopkins und Drum’n’Bass nach New-Age-Trance, rüpelige Basslines in erster Linie verspielt und zwischendurch mal ein Stück sehr nach Burial.
Nein, Innovationsgeist bietet Cerulean nicht, dafür aber einen persönlichen Rundumschlag eines versierten Produzenten und tüchtigen Arrangeurs. Sobald der den persönlichen Statements künstlerische folgen lässt, wird das zweifelsohne interessant. Kristoffer Cornils
Jennifer Vanilla – Castle In The Sky (Sinderlyn)

Jennifer Vanilla blinzelte als Aufmacher aus der Vogue, sie verkauft T-Shirts mit der Aufschrift „I’D Rather Be Jennifering” und existiert doch nur als Idee von Becca Kauffman. Mit Castle In The Sky hat sich die Künstlerin ein Album auf den Fake geschrieben. Statt als Jennifer in die Kamera zu grinsen, haucht Kauffman selbst ins Mikro und bastelt Beats, für die Jenny mit Klopfer ins Wunderland plumpst.
Dabei fängt der Trip schon beim Cover an. Wer über die Fruchtzwerge-Selbstmach-Platte linst, sucht mit Lucy in the Sky nach Glitzer, Glanz und einer Dosis DMT. Dabei könnte alles ganz groovy sein: Mit Nummern wie „Take Me For A Ride” oder „Body Music” biegt Vanilla zuerst in den Houseclub ab, Planningtorock spitzt beide Lauscher – Quatschtracks wie „Humility’s Disease” reißen große Löcher in die Rekordbox. „Cool Loneliness” geht als vergessene R’n’B-Ballade der 2000er durch. Und immer wieder scheißen uns die Spatzen auf den Schädel! Übrigens: Wer Castle In The Sky zur richtigen Zeit ins Tapedeck schiebt, sorgt für Lendenwirbelverrenkungen mit offenem Ausgang. Christoph Benkeser
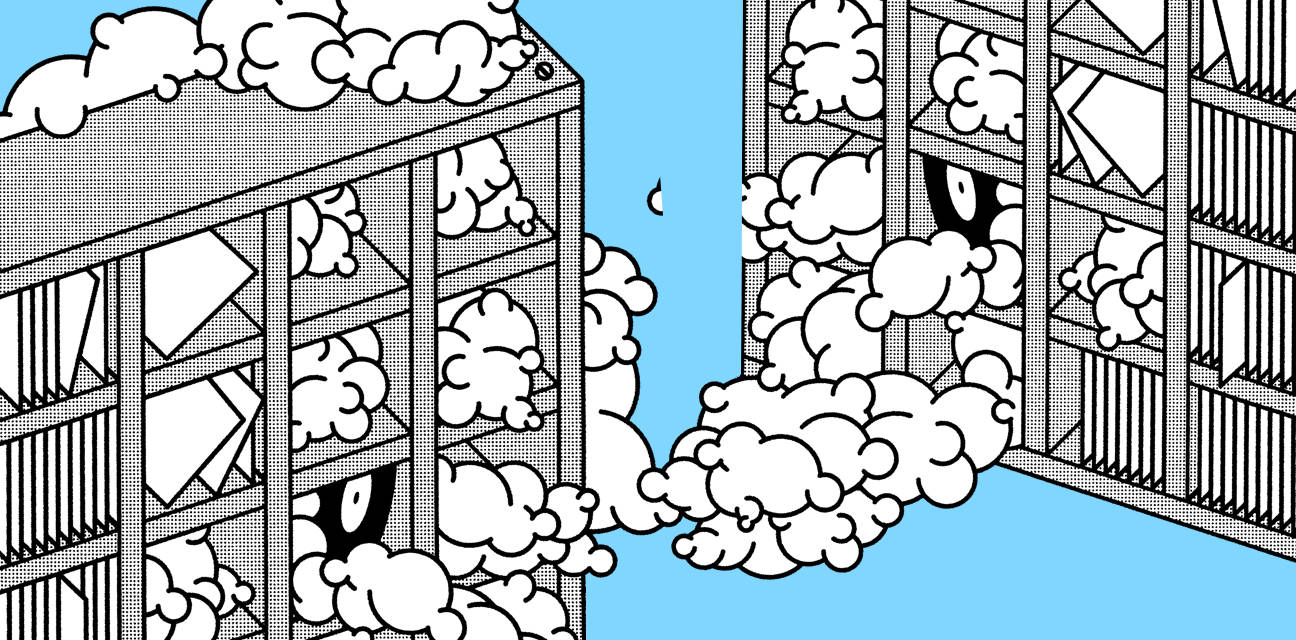


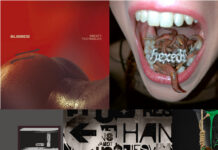
![[REWIND2023] Platten der Woche: Fünf für den Klassik-Floor](https://groove.de/wp-content/uploads/2023/12/PdW_2023_KW51-218x150.jpg)
