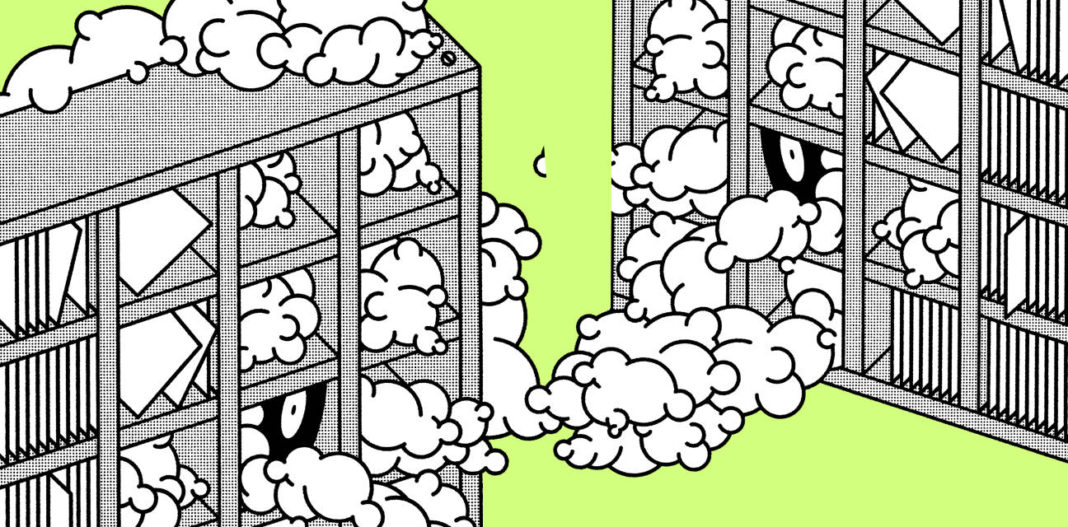
Alessandro Cortini – Scuro Chiaro (Mute)

Seit 2005 spielt der Italiener Alessandro Cortini Keyboard, Gitarre und Bass beim berühmten US-Amerikanischen Musikprojekt Nine Inch Nails. Seit 2013 veröffentlicht er solo elektronische Frequenzen, die sich, gern abstrakt experimentell, in Stilen wie Ambient, Drone, IDM, Industrial und Techno austoben. Immer irgendwie düster. Immer irgendwie klassisches Songwriting. Immer irgendwie von Pop beseelt. Auch sein neustes Album Scuro Chiaro, dessen Musik sich an dem in der Spätrenaissance und im Barock entwickelten malerischen Licht- und Schatten-Gestaltungsmittel Chiaroscuro orientiert, reiht sich perfekt in sein Œuvre ein. Acht emotionale Tunes, voller romantischer Synthschleifen, dezenter Gitarrenfeedbacks und zeitgenössischem elektronischem Game-of-Thrones-Drama. Ein Stück wie der barocke Track „Chiaroscuro” klingt nach Wolfgang Voigts Projekt GAS im Indie-Rock-Remix. Demgegenüber könnte der Tune „Lo Specchio” zu einem verschollenen John-Carpenter-Sci-Fi-Soundtrack gehören, und ein rhythmisch schleppender Song wie „Corri” überrascht mit dezenter Jazz-Etikette. Für Technofans hat Cortini das stoisch schleifende, dronig rollende „Sempre” im Tracklisting. Allerdings ohne clubtaugliche Knalleffekte. Was alle Stücke eint, ist eine subtile Musikalität, die weit über die oft beliebig fließenden Genregrenzen von Drone und Ambient hinaus schwingt. Detailliert komponiert Musik, die nie kompliziert wirkt. Voll schürfender Melodien und rauer Sound-Strukturen, die im Zusammenspiel irgendwie zu Pop werden, der keiner sein will. Ein überwiegend entspanntes, achtteiliges Puzzle, das sich bis zur letzten Sinuskurve fesselnd zusammensetzt. Vorausgesetzt, das Gemüt ist düster, romantisch und irgendwie positiv verzweifelt. Michael Leuffen
Amal, DJ NativeSun, James Bangura – Black Rave Culture (HAUS of ALTR)

Titel = Message. Drei DJs und Producer aus Washington, D.C. arbeiten auf zehn Tracks in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Sie unterstreichen, dass Rave immer eine afroamerikanische Musik war, immer Fiktion und immer Feier. Mit Amal und dem in Berlin lebenden James Bangura eröffnen zwei dieser drei die Aanifest-artige Compilation: „4Matic” koppelt Breakbeats mit durchgehender Bassdrum und kreiert so den Sound, der so treffend als die „Ursuppe” bezeichnet worden ist. Wie Wasser und Erde und Himmel, so waren auch Breakbeat und House und Techno einst nie geschieden.
Auf „Homies Dub” steigt mit DJ NativeSun der Dritte im Bunde mit ein. Der Track zischt und schmettert in kalten Klangfarben. Nach Halbzeit kommt er auf Temperatur in Form eines perkussiven Klöppelns, das auf dem Floor zu verheerenden Verwüstungen führen wird. Es geht ab. Superschnelle Amen-Breaks im Titelstück, Omar-S-hafte höhere Mathematiken, und in „Trips To London” gehen alle Genres gaga: Es ist nicht Footwork, es ist nicht Jungle, es ist nicht Grime, und doch ist es all dies. Wenn auf „Africa 808” James Bangura, DJ NativeSun und Amal zusammen eine afrofuturistische Pastorale werken, dann unterstreicht das umso mehr den Manifest-Charakter dieser im wahrsten Sinne fantastischen Compilation. Christoph Braun
Bell Curve – Unstable Orbit (Worst Behavior)

Bass! Die New Yorker Produzentin Bell Curve legt mit Unstable Orbit auf ihrem eigenen Label Worst Behavior ein wuchtiges Debütalbum vor. Benannt hat sie sich nach der Glockenkurve, auch als Gaußsche Verteilungskurve bekannt, die in der Stochastik die Normalverteilung darstellt. Die braucht man in einer instabilen Planetenumlaufbahn womöglich. Kräftig drückende Bässe und aufgekratzte Jungle-Breaks gehören zu dem von ihr selbstbewusst beherrschten Repertoire, die aufgerufenen Genres reichen von Dancehall im Ragga-Stil über Footwoork zu Grime. Bell Curve versteht es, ihre Tracks auf kluge Weise zum Knallen zu bringen, ohne den Bassmusik-Diskurs sofort in Begriffsnot zu bringen. Das ist auch nicht erforderlich, sie macht das, was sie tut, einfach so überzeugend, dass man Fragen nach Innovation und dergleichen ganz freiwillig zurückstellt. Überhaupt wenig Fragen nach diesem Einstand, dafür wunschloses Glück. Tim Caspar Boehme
Bruno Pronsato – Do It At Your Funeral (Perlon)

Die Doppel-LP des US-amerikanischen, in Berlin lebenden Musikproduzenten Steven Ford alias Bruno Pronsato shufflet und swingt ordentlich rund zwischen Four-To-The-Floor-Takten und gebrochenen Beat-Strukturen herum. Pronsato veröffentlichte in der Vergangenheit nicht nur auf dem legendären Berliner Label Perlon, sondern auch auf weiteren wichtigen Labels des Minimal-Techno-Genres wie Philpot, Smallville oder Musique Risquée. „Catching Lisbon” glitzert ruhig und flächig deep. Der Titeltrack humpelt lässig-verfunkt mit verzogener Klangsynthese durch den Club, als wäre der ein Spiegelkabinett. „Local Vampires” gongt wirr-verspielt in die Nacht. Beiläufige Stereo-Claps bekommen mit dem metallischen Dreivierteltakt-Geklöppel, den Hi-Hats und einem Horror-Zwitschern paranoide Züge („Version Of You”). „With Daze” ist ein Heavy-Funk-Techno-Groove, und „Best Before Benji” klingt wie Fusion-Jazz-Funk von Herbie Hancock, Nucleus oder Donald Byrd auf LSD. Polyrhythmisch beult dann „Ode To Street Hassle” die musikalische Geschichtsschreibung mit afro-karibischen Steeldrum-Fetzen gehörig aus. und „Simenon Briefly” verpeilt mit free-jazzig eingestreuten Drums. Generell klingt das Sounddesign ausgewogen und im Stereo-Spektrum schön gesetzt. Mirko Hecktor
Hörbeispiele findet ihr in den einschlägigen Shops.
Daniel Avery – Together In Static (Phantasy Sound)

Die Musik auf Together in Static komponierte Daniel Avery eigentlich für eine Serie von intimen Konzerten in der Londoner Hackney Church. „As with many things this past year, Together in Static took on a power and a life of its own right in front of me”, und so wurde schließlich ein ganzes Album daraus. 2013 wurde Avery mit seinem ersten Album Drone Logic einem größeren Publikum bekannt. Seitdem legte er zahlreiche Releases zwischen IDM, vernebeltem Techno und düsterem Downtempo nach, meistens erschienen sie auf Erol Alkans Label Phantasy Sound.
Hier reiht sich auch Together in Static ein. Das neue Album oszilliert zwischen brachialer Schwere und zarter Leichtigkeit, das machen schon die ersten beiden Nummern klar. „Crystal Eyes” eröffnet komplett ohne Beat, der kommt dafür auf „Yesterday Faded” umso heftiger: Wuchtig stampft die Kick, metallische Fragmente setzen sich zu einem verworrenen Rhythmus zusammen und ein Becken legt sich wie ein schwerer Mantel darüber.
Noch intensiver ist „Fountain of Peace”. Der Beat klingt wie ein ganzes Stahlwerk, dessen Schläge sich trotzdem gegen die Noise-Kulisse kaum durchsetzen können. Danach vergeht alles in Übersteuerung, ein schöner Effekt. Offen bleibt die Frage nach dem Namen des Tracks, hört er sich doch eher nach Panzerfabrik an als nach dem Brunnen des Friedens. Es gibt aber auch die ruhigen Nummern, wie „The Pursuit of Joy”. Ein Kleinod, das sich nicht aufdrängt inmitten der viel wuchtigeren Nachbarn, das aber eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Oder „Together in Static”, in dem eine zaghafte Melodie aus den angenehm schweren Flächen hervorbricht wie eine Blume aus dem Stahlbeton. Diese Momente dürfte es öfter geben. Es ist zwar beeindruckend, wie Daniel Avery die verschiedenen Klänge zu einer Kulisse verschmelzen lässt, aber das ein oder andere Detail, das der Komposition etwas mehr Leben einhaucht, würde sicherlich gut tun.
Jedoch ist das Album dadurch auch schön unaufdringlich und damit Ambient Music im eigentlichen Sinne: Es lädt dazu ein, die Gedanken schweifen zu lassen. Wunderbar geht das zum Beispiel bei „Endless Hours” oder „Hazel and Gold”, dem glückseligsten Moment des Albums. Und da die Musik eigentlich für die Bühne geschrieben wurde, sollte sie vielleicht auch so gehört werden. Das geht zum Beispiel am 23. Juni bei einem Live Stream des Konzerts aus der Hackney Church. Philipp Gschwendtner
DJ Marcelle/ Another Nice Mess – Explain The Food, Bitte (play loud! Productions)
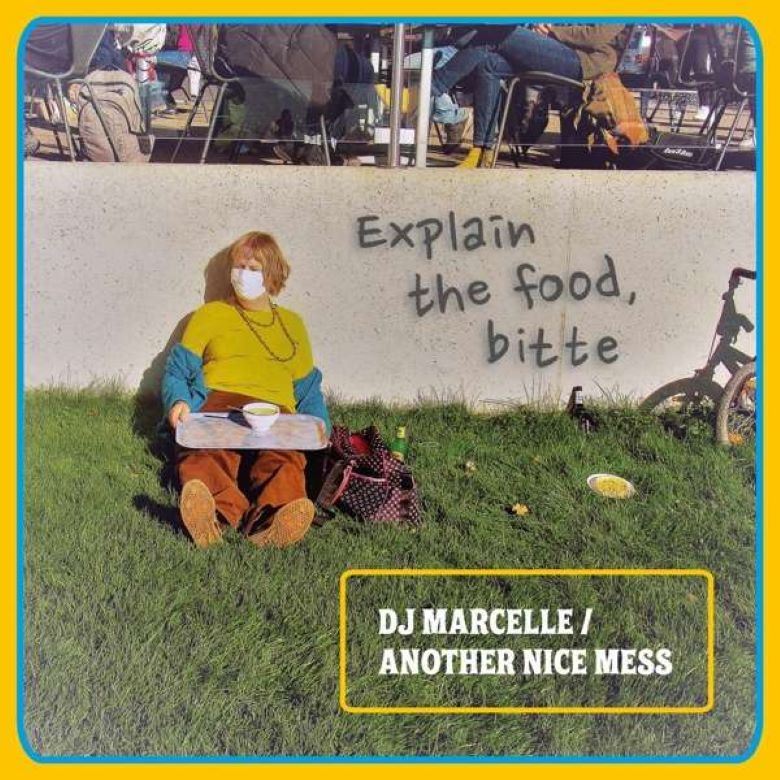
Sie ist weird, gut drauf und die Personifikation einer genialen Dilettantin – DJ Marcelle klescht seit fast zwei Jahrzehnten auf ihren Maschinen rum, ohne auch nur einmal die Anleitung in die Hand genommen zu haben. Raus kommt, was raus muss. Und sich zwischen Roedelius-Gedächtnis-Geklimper und einem Valium-induzierten Ausflug aufs Nyege-Nyege-Festival in eine Steel Drum packen lässt. Explain the Food, bitte ist, man kann es gar nicht anders sagen, der zur Musik gewordene Versuch eines Dreijährigen, auf Windows Paint eine Katze zu zeichnen. Das Ergebnis hat keine Ähnlichkeit mit gar nichts, ist aber immer noch geiler als die aufgeblasene Kunstkacke von Meese. Wer also plant, die Platte beim nächsten Besuch der Schwiegereltern aufzulegen, sollte sich vorsorglich ein psychologisches Gutachten zulegen, damit man in einfacher Sprache belegen kann, noch alle Tassen im Ikea-Schrank zu haben. DJ Marcelle schenkt nämlich Koffein an die Selbsthilfegruppe für nervöse Persönlichkeiten aus. Bevor jemand fragt: „The Vegans Are Backstage”. Und: Auf Explain The Food, Bitte gibt es gar nichts zu erklären – außer der Tatsache, dass man sich den doppelten Espresso am besten intravenös verabreichen sollte. Christoph Benkeser
Eli Keszler – Icons (LuckyMe)

Während es politisch zumindest vorrangig noch um die Eindämmung des Corona-Virus geht, schneien nun die ersten Alben rein, die den andauernden Ausnahmezustand musikalisch aufarbeiten. Eines davon ist Eli Keszlers Icons. Der US-Amerikaner verbrachte den Lockdown im letzten Jahr in seiner Wahlheimat New York. Während nächtlicher Spaziergänge nahm er viele Field Recordings auch von kleinsten Geräuschen auf, die er auf seinem neunten Studioalbum in feinfühlige und gleichzeitig brachiale Klangskulpturen formte, die weniger von menschlicher Wärme als von Introspektionen der kollektiven Isolation im Lockdown geprägt sind. Keszler beobachtete, wie die Stadt sich zwischen hektischer Schnelle und lähmendem Stillstand befand. In einem Moment sausten unzählige Ambulanzen vorbei und die Stadt quoll vor Protesten über, im anderen waren die Straßen wieder so still, dass man jede noch so kleine Veränderung hörte.In Keszlers elf Tracks nehmen kleine Geräusche, wie ein metallenes Rascheln oder hohles Klappern, ganz viel Platz ein, und es bleiben Zwischenräume, die zum einen das entzerrte Zeitgefühl und zum anderen die Leere New Yorks im letzten Jahr widerspiegeln. Aufnahmen von Stimmen sind nur vereinzelt zu hören, zum Beispiel in „Daily Life”, in dem vom langgezogenen Alltag erzählt wird. Stattdessen reihen sich Field Recordings neben elektroakustischen Perkussionen ein. Die befremdliche Atmosphäre, die zu dieser Zeit in den Straßen der Metropole hing, kann man schon im Opener „All The Morning” in dem unheilvollen Wabern und dystopischen Zischen der Synths hören. Weichere Klänge stößt hingegen „Civil Sunset” an, das durch das seicht scheppernde Schlagzeug und die auf- und abebbenden Perkussionen an Free Jazz erinnert. Auf Icons verwandelt sich New York in einen wundersamen Ort, in dem Keszler in der apokalyptischen Stimmung nach Melodie und Zugänglichkeit sucht, inmitten der Surrealität der pandemischen Situation und der Realität ihrer politischen Konsequenzen. Louisa Neitz




