Freddy K (Alle Fotos: Maximilian Fritz)
Unser Interview mit Freddy K hatte eigentlich einen speziellen Anlass: Am 9. Mai hätte im Berghain eine KEY-Vinyl-Nacht stattfinden sollen. Ein illustres Line-Up war bereits gebucht, Mitte März verkündete der Club am Ostbahnhof aber seine temporäre Schließung wegen des Coronavirus, die bis heute andauert. Dass die Nacht platzen würde, war bereits zum Zeitpunkt des Interviews vorhersehbar.
Fürs Gespräch war das aber keineswegs hinderlich, hat der Italiener doch auch abseits einzelner Clubnächte viel zu erzählen. Im Berliner Schillerkiez zeichnete er seine Karriere nach, die ihn von Rom in die deutsche Hauptstadt führte, erläuterte seine besondere Beziehung zum Medium Radio und zeigte sich aktuellen Entwicklungen in der Szene gegenüber nicht unbedingt wohlgesonnen.
„Urteile nicht über meine Frisur!”, warnt Alessio Armeni vor, ehe wir uns im Berliner Schillerkiez treffen. Hier, mitten in Neukölln, direkt am Tempelhofer Feld, wohnt der Italiener, der als Freddy K einer der gefragtesten Techno-DJs überhaupt ist. Das liegt nicht nur an seinen oft Marathon-artigen, Vinyl-getriebenen Sets, sondern auch an seiner Einstellung zur und Passion für die Szene. Kolleg*innen und Raver gleichermaßen begreifen Armeni als authentisch, als musikpolitischen Aktivisten, der zu seinen Aussagen steht – oft auch mit überbordender Emotionalität.
Bei der Begrüßung tut er sich schwer. Es ist der 24. April, Berlin steckt mitten im Lockdown, für den herzlichen Italiener scheint es nochmal schmerzhafter, sich mit der sich langsam etablierenden Ellenbogen-Begrüßung zu begnügen. Die Kurzhaarfrisur sitzt trotz geschlossener Friseursalons, ebenso wie das Poloshirt und die schlichte Jeans. Zwischen spielenden Kindern und lautstarken Familien zeichnet er nach kurzem Fußmarsch auf dem erstaunlich gut besuchten Tempelhofer Feld zu Beginn des Gesprächs etwas sprunghaft seine Laufbahn nach, gibt gütigerweise Orientierungshilfen in Form von Jahreszahlen.
Der Zeitstrahl, auf dem Armenis Karriere verläuft, hat diese Bezeichnung nämlich nicht verdient. Zu viele Abzweigungen gab es, zu viele Fügungen und unverhoffte Wendungen scheuchten ihn ab dem Ende der Achtziger von Hip Hop zu House zu Acid House zu Techno. Anfangs faszinierten ihn DMC-Competitions (DJ-Wettbewerbe mit Fokus auf Skills, d.Red.), dann verschob Acid House den Fokus Richtung Rave. „Das hat alles verändert. Dieser grinsende Acid-Smiley und die Klänge aus der TB-303 haben mich extrem angezogen.” Der Sprung war dann nicht mehr weit zu Luca Cucchettis Mad Show, einem passend titulierten Radioformat, das die ersten Techno-Tracks in den Römer Äther blies.
Am Anfang stand das Radio
Das machte Eindruck auf den passionierten wie talentierten Schwimmer, der, damals noch in der Schulmannschaft aktiv und deshalb bei diversen Wettbewerben am Start, wegen des Sports viele Raves auslassen musste. Die Mad Show schuf Abhilfe, versorgte Armeni zumindest nachmittags für 90 Minuten mit dem Sound, der ihn schlagartig begeisterte. Generell zieht sich das Medium Radio stringent durch seine Biographie, wies ihm schlussendlich auch den Weg zur Erleuchtung: „Auf meinem ersten Rave bin ich wegen einer Radiosendung gelandet. Da liefen von Mitternacht bis Sonntagmorgen im Voraus aufgenommene Sets. Zwischen denen haben sie Veranstaltungstipps untergebracht. Haben dir gesagt, dass diese Nacht in irgendeiner Fabrikhalle Joey Beltram spielt. Oder Aphex Twin, große Namen halt.”
Mit dem Auto ging es dann schnurstracks in die Römer Einöde, wo tausende Leute bereits warteten. Lory D und Frank de Wulf spielten, die Schlange war quälend lang. Als der Floor endlich näher rückte, trennte Armeni nur noch eine Glastür von der Tanzfläche, die er dankbar aufstieß: „Die Musik war extrem laut, 3000 Menschen bewegten sich, hatten Trillerpfeifen dabei. Das war der Moment, der mein Leben wirklich veränderte.” Auch diese Veränderung trieb das Radio voran. Mit 21 Jahren startete Armeni 1993 seine wohl berühmteste Radioshow, Virus, die ihm den Weg in die Clubs Italiens ebnete.
Zuvor nur als Konsument mit dem Radio verbunden, der anrief und die Moderator*innen mit Fragen nach Track-IDs löcherte oder vor dem Studio wartete, um Underground Resistance um Unterschriften auf seinen Platten zu bitten, fand sich Armeni plötzlich selbst als Tastemaker wieder. Er vermengte jeden Tag stundenlang, am Wochenende noch etwas länger, aktuelle Techno-Tracks gemeinsam mit hastigen Moderationen, holte sich Gäste wie Leo Anibaldi oder Max Durante an seine Seite und mache sich so einen Namen. „Die Show wuchs so schnell, dass mir der beste Plattenladen der Stadt, Remix, einen Mofa-Kurier mit Testpressungen vorbeischickte. So brachten wir unsere Bewegung ins Rollen.”
In der Tat schuf sich Armeni eine regelrechte Infrastruktur, nachdem er Kontakte zum Radio geknüpft hatte: Die Sendung, der Plattenladen, die Virus-Partyreihe, die bald folgte – „das hat zwei, drei Jahre echt super funktioniert.” Auf den Partys versammelten sich bis zu 3000 Leute in einer Art Zirkuszelt in Ostia, Roms Hafenstadt. Und das wohlgemerkt, ohne dass es Flyer gegeben hätte, „obwohl es damals nur über Flyer ging”, wie Armeni betont. Damals bereits als Freddy K aktiv, erste Gigs spielte er in einem Club namens Macumba, glich er sein Arbeitspensum als DJ kurzerhand dem des Radiomoderators an und spielte ausufernde Sets, die aus heutiger Sicht wie Vorboten seiner sagenumwobenen Berghain-Closings wirken. „Nach Totti (berühmter römischer Fußballspieler, d.Red.) kam Freddy K!”, scherzt er, wenn er an diese erfolgreiche Periode zwischen 1993 und 1995 zurückdenkt.
Niedergang in Rom, Neugeburt in Berlin
Mit ACV wurde folgerichtig Italiens wichtigstes Techno-Label auf den unermüdlichen Arbeiter Anfang 20 aufmerksam. „Robert Armani war eine Ikone in Rom”, stellt Armeni in einem Ton klar, der am Status des amerikanischen Producers („Circus Bells”) keine Zweifel aufkommen lässt. „ACV war ein wirklich seriöses Label. Die hatten fünf Studios mit allem, was man sich wünschen konnte und stellten dir das eine Woche lang zur Verfügung, wenn dabei eine EP herauskam.” Diese Studioaufenthalte zeitigten Freddy Ks erste Resultate als Produzent, die in zwei EPs und seinem bislang einzigem Album mündeten. Rage Of Age erschien 1995, strotzt vor kraftvollen Drum-Machine-Workouts und klingt definitiv schriller, unkonzentrierter als ein Freddy-K-Set heutzutage. Auch als Kurator betätigte sich Armeni, Armani zog ihn etwa bei der Selektion des Albums Right To Silence ins Vertrauen: „Da steht ‚Special Thanks To Freddy K drauf‘”, sagt Armeni nicht ohne Stolz.
Offenbarten sich bis zu diesem Punkt vor allem die Sonnenseiten des Techno, einer bis dato von offiziellen wie inoffiziellen wirtschaftlichen Interessen eher unberührten, jungfräulichen Bewegung, kam Armeni spätestens ab Mitte der Neunziger ins Grübeln. „Schon in der ersten Generation des Sound Of Rome wurden die Partys am Schluss von echt beschissenen Leuten gemacht. Da war die Mafia ein wenig mit drin, die bestimmten teilweise die Namen auf dem Line-Up. Auch die Leute wurden anders. Am Anfang, wenn etwas noch neu ist, hast du immer die besten Leute. Auf einmal gab’s dann Schlägereien im Club und sowas.” Auch einen steigenden Rom-Skeptizismus verspürte er, attestiert der Stadt noch heute eine große Abhängigkeit von Hypes. Die Leute dort interpretierten vieles als Modeerscheinung, „auch wenn sie dir Jahrzehnte später noch immer erzählen, wie gut sie alles damals fanden.”

Auch die Begeisterung um Virus ebbte nach und nach ab, statt in Zirkuszelten in pittoresken Landschaften suchte Armeni sein Heil nun in der immer populäreren Hardcore- und Gabber-Szene, die aus den Niederlanden ihren Weg nach Italien fand. „Ich mochte die Bewegung, es ähnelte Rock und Pogo. Gespielt habe ich das Zeug aber nicht, wenn dann ein Oldschool-Set.” Oldschool-Sets kurz vor der Jahrtausendwende drücken gleich zwei Wesenszüge Freddy Ks aus: Ein kaum zu leugnender Hang zur Nostalgie sowie ein unstillbarer Durst nach Authentizität, einem ständigen Berufen auf die Kernwerte der Musik und der Szene, die er so wertschätzt. Diese verwässerten in seinen Augen in den Folgejahren noch mehr.
Anfang der 2000er begann er, im Remix zu arbeiten. Dem Plattenladen, dessen Kurierfrachten er als Radio-DJ noch mit offenen Armen empfing. Dieser startete das Label Elettronica Romana, bei dem Donato Dozzy und Giorgio Gigli 2004 ihre Chiki Disco EP veröffentlichten. Während vor allem Dozzys Karriere ab diesem Zeitpunkt Fahrt aufnahm, verlor Armeni seinen Enthusiasmus. Das hing nicht zuletzt damit zusammen, dass die Musik selbst ihm immer weniger zusagte. „Alles wurde viel minimaler, Richie Hawtins MINUS wurde extrem populär. Das war dann nicht mehr so meins, ich konnte mich dafür nicht begeistern. Auch die Mentalität der DJs fand ich seltsam, irgendwie schien es mehr um Fashion zu gehen und darum, sich zu inszenieren.”
Letztlich gipfelte dieser Verlust an Input darin, dass Armeni für zwei Jahre aufhörte zu spielen. Er konzentrierte sich auf seine Agentur K1971, die er aus dem Remix heraus betrieb, um Künstler*innen bei der Vermarktung zu helfen. Dann endete die Beziehung mit seiner damaligen Freundin und es gab plötzlich nicht mehr viel, was ihn in Rom hielt. „Ich kannte in Berlin sehr viele Leute und stand wegen meiner Agentur auf halbwegs sicheren Beinen. Also wollte ich’s versuchen”, sagt Armeni und zog 2009 in die deutsche Hauptstadt. Am ersten Samstag ging es dann in den Tresor, von wo aus er zu späterer Stunde mit Adam X ins Berghain aufbrach. „Da war mir klar, dass es die beste Entscheidung war, hierher zu kommen.”
„Du musst Aufwand betreiben, schwitzen. Nicht weil du Koks gezogen hast und besoffen bist – das kann auch mal passieren –, sondern weil du aufs Mixen fokussiert bist.”
Die Begeisterung entflammte wieder, entzündete sich am lebendigen Nachtleben Berlins. Armeni wurde Resident der legendären Partyreihe Homopatik, wo er seine Marathon-Sets endgültig als Stilmittel kultivierte. „16 Stunden waren schon mal drin. Ich habe mich hier neu gefunden. Du kannst versuchen, Künstler zu sein. Das ist das Wichtigste. Heute hat sich das durch den Hype natürlich etwas verändert, aber es ist immer noch das beste Netzwerk für Techno.” Das queere Element übt dabei bis heute eine Faszination auf ihn aus: „In Rom war Techno nicht wirklich queer, nicht wirklich offen dafür, das war immer House. Für diese Entwicklung ist das Berghain mitverantwortlich. Der Club hat die Tür dafür geöffnet. Die meisten erfolgreichen queeren Partyreihen entstanden doch erst deshalb!”
Technologiekritik und Arbeitermentalität
Das Gefühl, die Stimmung, die bei solchen Partys entsteht, ist Armeni heilig. Dem DJing misst er dabei eine Bedeutung bei, die weit über Funktionalität hinausgeht. Für ihn treffen sich beim Auflegen Arbeitermentalität, Haptik, Können und Geschmack. Diese Säulen sieht der Techno-Aktivist, wie Armeni immer wieder bezeichnet wird, gegenwärtig erodieren. Auch die Technologie spielt dabei eine gewichtige Rolle, der passionierte Vinyl-Liebhaber stört sich etwa an der Bequemlichkeit vieler Kolleg*innen: „Nimm zum Beispiel CDJs und ihren Sync Button, da brauchst du kein wirkliches Können mehr. Außer du nutzt die Dinger wie etwa DVS1 – ich verstehe nicht, was er mit den drei Dingern und seinen ganzen Loops macht, aber es klingt super. Das ist die Nutzung der Technologie am Limit, das macht Sinn. Aber mit zwei CDJs zu spielen und dann teilweise nicht mal für die Musik zu bezahlen, die du auflegst, finde ich etwas komisch.”
Wie während des gesamten Gesprächs durchscheint, ist Freddy K ein hemmungsloser Oldschooler, für den Aufwand und Ertrag in einem gesunden Verhältnis stehen müssen. Ein Set funktioniert für ihn dann, wenn der*die DJ das Publikum belohnt, für die Raver arbeitet, sich aufreibt. „Leute geben dir als DJ doch Geld, damit du was leistest. Das ist meine Mentalität. Du musst Aufwand betreiben, schwitzen. Nicht weil du Koks gezogen hast und besoffen bist – das kann auch mal passieren –, sondern weil du aufs Mixen fokussiert bist. Leute geben unter anderem für dich am Wochenende ihr Geld aus, das sie sich erarbeitet haben. Das ist dein Moment. Und du kommst dann mit einem USB-Stick an? In meinen Augen ist das respektlos gegenüber den Leuten, auch gegenüber meinen Wurzeln.”
Diese Wurzeln sind es, die Armeni zu jedem Zeitpunkt repräsentiert. Vor allem dann, wenn sich seine Technologiekritik mit betont bodenständiger Arbeitermentalität paart. Egal ob als Radiomacher, DJ oder Booker, der eigene Kraftaufwand hat sich bemerkbar zu machen. Das gilt auch für Streams, die in Zeiten der Corona-Krise allgegenwärtig sind. „Die Leute stehen mit zwei CDJs im Club und es sieht aus, als ob sie nichts täten. Ich meine, das wird ja meist auf Video übertragen. Da gibt es schlicht nichts Interessantes zu sehen, höchstens zu hören. Ich will kein Arschloch sein, aber komm‘ schon!” DJs müssten etwas leisten, wenn sie mit einem Gig mehr Geld machen als Leute mit festem Job in einem Monat.
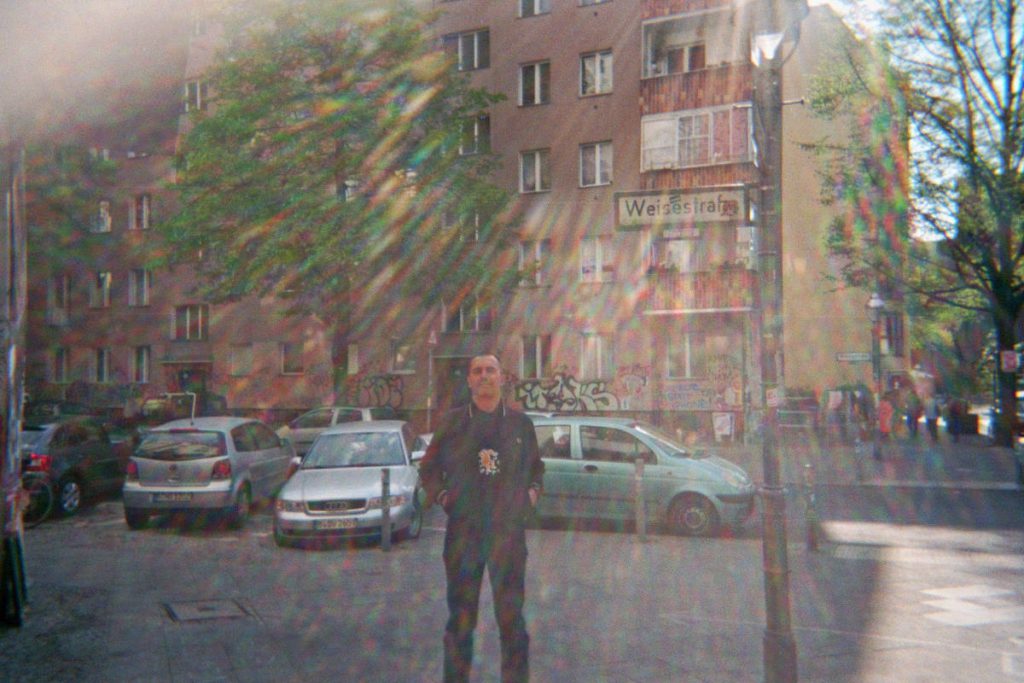
Auch das Internet sei teilweise eher Fluch als Segen. Das Kaufen von Likes, das Aufbauen von Connections, um sich ins Rampenlicht zu drängen sind naturgemäß Erscheinungen, die Armeni stören. Das Auflegen mit Platten wirkt deshalb nicht wie bloße Routine, sondern wie ein Dancefloor-politisches Statement. Natürlich gibt es dafür auch praktische Gründe: „Ich spiele mit Vinyl, weil ich es einfach besser kann. Außerdem kaufe ich das Zeug gern und will vor den Leuten auch wirklich was machen. Ich muss damit vorsichtig sein, mir darf nichts runterfallen, es hält mich während langer Sets am Leben und hilft dabei, konzentriert zu bleiben.”
„Du musst aufhören, wenn noch viele Leute da sind. Der erste und der letzte Track sind am wichtigsten, vor allem bei einer 14- oder 16-stündigen Reise. Das ist oldschool, stimmt aber einfach.”
Diese langen Sets, die Armeni vor allem in Berlin zu einer Koryphäe gemacht haben, sind allerdings nur ein Teil der Künstlerpersönlichkeit Freddy K. „Ich bin ein guter Kommunikator”, sagt er von sich selbst und erklärt damit im selben Atemzug, warum ihm das Radio auch heute noch so liegt. Während des Lockdowns stampfte er kurzerhand die onomatopoetisch betitelte Show Krzrzrz aus dem Boden, die ihren Hörer*innen in 100 Folgen eine Stunde täglich Realitätsflucht bot. Mit einer Mischung aus neuen Tracks und Klassikern, gelegentlichen Interviews und munteren Durchsagen, die stellenweise an eine gewisse Frankfurter Rave-Ikone erinnern, erspielte sich Armeni schnell eine breite Gefolgschaft. Für die Zeit ohne Partys ist Geschlossenheit angesagt, die der Italiener immer wieder beschwört. Sei es mit Sätzen wie „Ich glaube an die Bewegung!” für das fiktive Techno-Parlament oder mit Appellen, an alle Parteien zu denken. Plattenläden und Bookingagenturen blieben etwa auf der Strecke, obwohl sie Künstler*innen massiv förderten. „Wer ermöglicht den Leuten denn, groß zu werden?”, fragt er suggestiv.
Dennoch sieht Armeni auch potenzielle positive Effekte der Krise, so fern ihr Ende auch liegen mag. „Promoter sollten daran denken, dass Leute so oder so tanzen wollen. Vielleicht wollen sie das auch, wenn der DJ keine 50.000 Euro bekommt.” Techno benötigt Basisarbeit, so könnte ein Slogan Freddy Ks lauten. „Ich will kein Star sein. Ich mache, was ich mache, weil es mir Spaß macht. Natürlich bekomme ich dafür Geld”, schiebt er noch nach. Man nimmt es ihm ab, glaubt ihm, dass er seinem Gegenüber grundsätzlich mit Respekt begegnet. Das gilt auch für Residents, die für ihn – ein weiterer Fixpunkt traditioneller Clubkultur – den Sound eines Clubs prägen, seine eigentliche Seele sind. öne „Mir tut es leid, wenn die sich immer wieder hinten anstellen müssen und Headliner vor die Nase gesetzt bekommen. Oft lasse ich sie noch eine Weile weiterspielen, wenn sie schon für mich die Stimmung aufbauen. Sie sollen genießen, was sie geschaffen haben.”
Wenn Armeni schließlich selbst spielt, liegt der Fokus nicht nur auf seinem raumgreifenden, muskelbepackten, klar definierten Techno-Sound, den er auch mit seinem Label KEY Vinyl unter die Leute bringt. Das Publikum erwartet sich etwas Besonderes, etwa die tausendfach bemühte DJ-Heldenreise, das Erzählen einer Geschichte. Das bekommt Freddy K immer wieder hin, sei es während einer Stunde im Boiler Room oder bei 14-facher Dauer beim Berghain-Closing. Die Regeln dafür sind simpel: „Du musst aufhören, wenn noch viele Leute da sind. Wenn im Berghain vor dir 40 Leute tanzen würden, ist es nicht mehr schön. Der erste und der letzte Track sind am wichtigsten, vor allem bei einer 14- oder 16-stündigen Reise. Das ist oldschool, stimmt aber einfach.” Was dazwischen passiert, bleibt nebulös. Hin und wieder lockert Armeni mit poppigeren Tracks auf, Soft Cells „Tainted Love” bleibt beispielsweise eine seiner nicht so geheimen Geheimwaffen. Diese schier endlosen Sets offenbaren wohl am meisten über den Künstler Freddy K, den umtriebigen Alessio Armeni mit der nimmermüden Working-Class-Mentalität. Sie ziehen sich nicht nur so lange, weil er dem Publikum um jeden Preis etwas bieten will. Es ist vielmehr die gemeinsame Erfahrung, das wissende Grinsen nach dem Clubbesuch, das in der Blütezeit des Sound Of Rome und in der biederen Gegenwart noch dasselbe bleibt. Und nicht zuletzt der Kick, etwas Extraordinäres zu erschaffen, ohne es zum Selbstzweck verkommen zu lassen. Die Grenze zwischen Begeisterung und Manie ist dabei eine fließende, beantwortet Armeni doch keine Frage so pointiert und rasch wie die nach dem Grund dieser kathartischen Rituale: „Wenn du etwas machst, das dir gefällt, willst du, dass das aufhört? Wahrscheinlich nicht.”
