Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Isolation zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im zweiten Teil des März-Rückblicks mit The Fear Ratio, Four Tet, Matt Karmil und fünf weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Hier geht’s zu Teil 1.
The Emperor Machine – Music Not Safari (Skint)

Die künstlerische Karriere von Andy Meecham alias The Emperor Machine gehört zu den bemerkenswerteren Geschichten, die man sich in der Leftfield-Disco-Szene erzählt. Was hat er uns nicht alles gezeigt: Disco als funkensprühendes Mechano, angetreten von einem Renegade. Ästhetisch mäanderte das zwischen John-Carpenter-Anleihen und Weltraumdisco. Und wenn Andy Meecham ein Markenzeichen hat, dann ist es diese grabende Bassline, die ewig optimistisch einfordert: Ich will mehr. Auch Music Not Safari führt diese Mission fort. In Tagen, in denen die Welt aus den Fugen gerät und die Clubkultur global in existenzielle Nöte, schwingt da eine anachronistische Note mit. Aber bitteschön: wer mag, kann sich akustisch anschmiegen an eine Zeit, wo alles noch okay war. Man weiss, was man kriegt: Solide Arbeit, ein stimmiges Paket. Am besten klingt das Album bei Tracks wie „C.C” oder „Danse”. Es ist aber auch bar jeder Überraschung. Von Andy Meecham hätte man sich doch etwas mehr Querschlägertum erhofft. Bjørn Schaeffner
The Fear Ratio – They Can’t Be Saved (Skam)

Es gibt Künstler, die in ihren Produktionen gewollt die chaotische Soundlandschaft suchen – Aphex Twin beispielsweise. Anders sind da James Ruskin und Mark Broom alias The Fear Ratio. In beeindruckender Perfektion komponieren die beiden ihre Breakbeat-Nummern bis ins kleinste Detail durch. Niemals wird ein Effekt oder ein Filter einfach sich selbst überlassen, sondern alles ist zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle. Mit dem neuen Projekt gelingt ihnen das beste ihrer drei gemeinsamen Alben, was die hohe Qualität der vorangegangenen keinesfalls in Abrede stellt. Doch They Can’t Be Saved glänzt durch eine Diversität, in der jeder Track eine distinkte Klangerfahrung bereitet. Während in „Small World” ein wahnsinniger Bounce durch bratzigere Bässe entsteht, schimmert bei „The Invisible Girl” ein filmmusikreifes Syntheziser-Riff durch eher fabrikartiges Beat-Gerüst. Die Sounds scheinen immer direkt neben dem eigenen Ohr stattzufinden, am stärksten wahrnehmbar bei den insektoid klingenden Hi-Hat-Ausbrüchen – beispielsweise in „Game Plan”. Es geht meistens in industrielle Tiefen, aber eben immer mit organischem Drive, sodass eine komplett drahtige und kalte Klang-Szenerie wie etwa bei Autechre-Cuts vermieden wird. Ein Release, das mit seiner Hochwertigkeit nicht überrascht, aber über alle Maßen erfreut! Lucas Hösel
Four Tet – Sixteen Oceans (Text Records)

Schwierige Zeiten verlangen nach In-die-Fresse-Beats für alle, die geschlossene Clubs zwar scheiße finden, aber clever genug sind, um auf der Suche nach der verlorenen Zeit über die neue Platte von Schmusebär und Everybody’s Darling Four Tet zu stolpern. Mit Sixteen Oceans geht es raus in die Natur, dort wo Viren keine Chance haben, weil alle zu Hause ihre Breitbandverbindung ans Limit streamen. Mit dem Video zu „Baby” schickt man sich aus der Drohnen-Perspektive auf einen DMT-Trip zwischen Ruin Porn und Wasserfällen. Sieht geil aus, passt zum Cover, das so aussieht, als hätte die Grafikabteilung den Einsteigerkurs für Photoshop mit einem Fortgeschrittenenseminar in New-Age-Esoterik verwechselt. Plitsch, platsch, Pinguin, da rinnt noch viel Wasser den Rhein runter, bis Kieran Hebden das Harpsichord ein- und den Barock-Elektroniker auspackt. In den Mini-Unterbrechungen zwischen Ecstasy-Taumel und noch mehr homöopathischen Pillen geht der Mann auf Safari, um das Richtmikro aus dem Fenster zu hängen. Adlergeflatter hin oder her – das ist zu viel gute Laune für die Krise. Christoph Benkeser
Joey Anderson – Rainbow Doll (Avenue 66)

Joey Andersons House- und Techno-Produktionen sind ein Phänomen – auf der einen Seite klingen sie vertraut und bedienen sich bekannter Parameter, gleichzeitig aber bewegen sich etliche Elemente seiner Tracks ein kleines aber entscheidendes Stück neben der Genre-Definition. Sie klingen verdreht, seltsam, manchmal sogar verstörend. Und wir sprechen hier nicht von den oft zitierten verspulten, Weed-befeuerten Clubtracks, die oft zwar vordergründig abgedreht wirken, de facto aber nur eine überschaubare Palette von im (Rausch-) Kontext beliebten Elementen wiederkäuen. Ein Musterbeispiel für Andersons spezielle Herangehensweise ist „Beside Me”, der dritte Track des Albums, bei dem ein klagender Gesang die Hauptrolle spielt, der gespenstisch an den Stimm-Einsatz David Bowies auf dessen letztem Album Black Star erinnert – aber eben nur erinnert. Natürlich versucht Anderson nicht, wie Bowie zu klingen, das wäre ein zum Scheitern verurteiltes, aber auch künstlerisch uninteressantes Unterfangen. Im Gegenteil, Rainbow Doll ist von Anfang bis Ende ein ausgesprochen kreatives Album, das einen eigenständigen Künstler und eine Persönlichkeit dahinter erahnbar macht, und dadurch eine weitaus komplexere Wirkung erzielt als viele stilistisch verwandte Veröffentlichungen. Mathias Schaffhäuser
Jon Hassell – Vernal Equinox (Ndeya)

Als der heute 83-jährige US-Amerikanische Komponist und Trompeter Jon Hassell 1978 sein erstes Studioalbum Vernal Equinox veröffentlicht, ist seine Erfindung des freimütigen Musikstils Fourth World noch in der Entwicklungsphase. Zwar hatte Hassell bereits bei Karlheinz Stockhausen studiert, war schon mit La Monte Young ins Dream House abgetaucht und ebenso mit der spirituellen Kraft von Pandit Pran Nath vertraut. Dennoch fehlte noch einer: Brian Eno, der Mann, mit dem er zwei Jahre später mittels Fourth World, Vol. 1: Possible Musics ein neues Genre erfinden wird. Inspiriert von der Raga-Musik verarbeitet Hassell auf Vernal Equinox seinen Trompetensound noch nicht ganz so aufsaugend weltumspannend und konzentriert sich auf Noten, die sich in winzigen, rutschigen Schritten verändern. Dazu gleiten und zucken Marimba-Klänge, Glocken-Sounds, Synth-Drones und Talking-Drum-Rhythmen, die gemeinsam eine nicht direkt greifbare Klangwelt erschaffen, von der eine neblige Magie ausgeht. Auch die entspannte Verwandtschaft zu New Age und Jazz als Bezugsgröße ist spürbar. Die nun zum ersten Mal seit 42 Jahren veröffentlichten Aufnahmen sind aber mehr als nur ein weiteres Ambient-Reissue. Sie präsentieren ein forschendes Zeitfenster kurz vor der Erfindung des Fourth-World-Stils, in dem sich musikalische Vergangenheit und Zukunft eines bis heute aktiven Ausnahmekünstlers für kurze Zeit nebeneinander tummeln, nur um etwas später mit Hilfe von Brian Eno in tiefer Meditation unzertrennlich miteinander zu verschmelzen. Michael Leuffen
Marlon Hoffstadt – Planet Love (Midnight Themes)

Seine Savour the Moment-Reihe im Salon zur wilden Renate muss derzeit pausieren, weil die Clubs in Berlin, wie so viele Kultureinrichtungen, bis auf weiteres geschlossen sind. Trotz Pandemie kann sich der Berliner Produzent und DJ Marlon Hoffstadt aber zumindest über sein Debütalbum freuen, das er auf seinem eigenen Label Midnight Themes herausgebracht hat. Wer sich nicht in den Plattenladen traut, bekommt es zur Not digital, um den Planet Love dann erst einmal zu Hause mit rituellen Tänzen zu feiern. Dieser Planet hat bei Hoffstadt, so lassen seine Tracks vermuten, schon alles, was er braucht: ekstatischer Trance hier, quirliger Eurodance da, ein wenig Electro zwischendurch und bei Bedarf wird die immergute 303 zum Blubbern gebracht. Eher Bewährtes also, worauf sich der, nebenbei erwähnt, junge Vater besinnt. Hoffstadt schreitet erst einmal, wenn man so möchte, rückwärts in die Zukunft. Was bei ihm aber mit so viel Stilwillen und aus jedem Beat, Break und Bass hervorpulsierenden Herzblut geschieht, dass es im guten Sinne ansteckend wirkt. Zuversicht spricht aus diesen Melodien, die selbst da, wo sie cheesy ausgefallen sind, für sich einnehmen. Und wie verspricht doch die vorletzte Nummer der Platte: „Don’t Worry, My Son, It Will All Be Good”. Tim Caspar Boehme
Matt Karmil – STS371 (Smalltown Supersound)
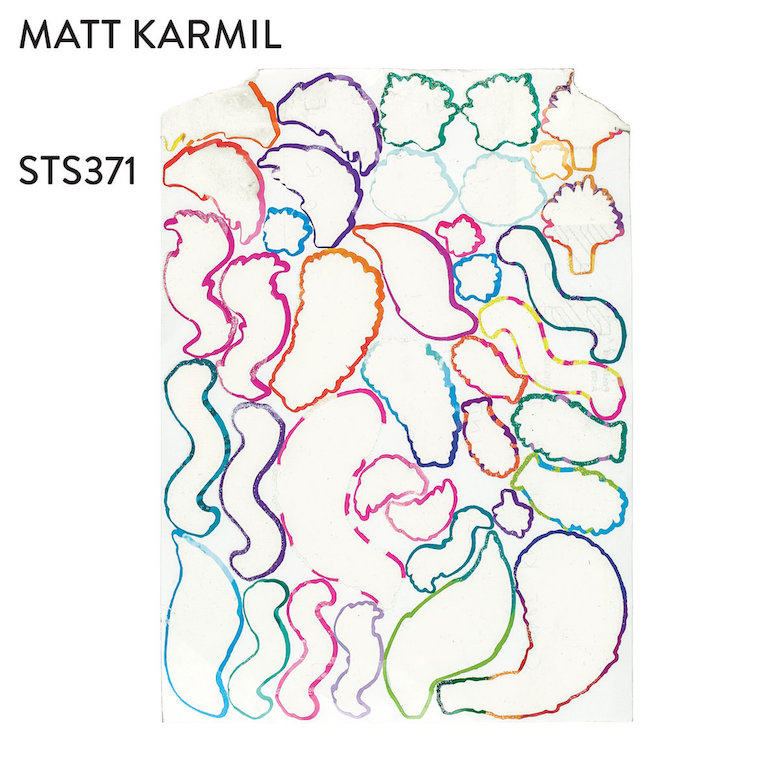
Viele Jahre lebte der britische Producer Matt Karmil in Köln. Auch wenn er sich mittlerweile auf einen Rückzug vom Kontinent vorzubereiten scheint, stellt diese Wahlheimat auch für sein fünftes Album, das zweite für Smalltown Supersound, eine verbindliche Disposition dar. Minimal Techno, wie er Mitte der Neunziger etwa von Wolfgang Voigt mit seinem GAS-Projekt seine definitive Gestalt erhielt, bildet die Linse, durch die Karmil Deep House, Dub, Ambient und am Rande auch Hip Hop fokussiert. Spezifisch an den neun neuen Tracks ist sein kreativer Umgang mit fehlerbehafteten Loops und staubigen Found Sounds, bestechend sein Gespür für den immersiven Sog dieser Musik. Mit „PB” und „Breezy”, den beiden längsten Tunes auf STS371, lotet Karmil die Möglichkeiten von Acid jenseits der gängigen Stereotype aus. Gewitzt auch seine Filter-House-Parodie „Still Not French”. Die wesentlichen Entscheidungen für die Arrangements habe er hauptsächlich auf Reisen getroffen, den endgültigen Mix dann im Kölner Studio The Brewery besorgt. Das Ergebnis ist ein wohltuend unaufgeregtes Album, aber so substanziell, dass es auch auf Dauer so schnell keine Abnutzungserscheinungen erleiden wird. Harry Schmidt
Mutsumi – Mutsumi (Utter)

Manche Platten muss man ja liegen lassen wie gute Weine, damit sie ihre Wirkung so richtig entfalten. Was im Einzelfall, von Hörer zu Hörer, für sehr unterschiedliche Tonträger gelten mag. Bei Mutsumi, dem dritten Album der Sängerin Mutsumi Kanamori, das, wie zuvor schon ihre beiden Platten als MU, von Maurice Fulton produziert wurde, hat das Warten zudem sehr praktische Gründe: Als Mutsumi das erste Mal veröffentlicht wurde, erschien es rein digital. Jetzt hat sich das britische Label Utter der Sache angenommen. Was vom namentlich bestens passt. Schließlich beginnt der erste Track ganz lautmalerisch mit dem „Muh” einer Kuh, wie um an den ursprünglichen Projektnamen Mutsumis zu erinnern. Danach geht es jedoch wenig beschaulich weiter: Mutsumi schreit gleich im Anschluss mit irritierend hochgepitchter Stimme den Songtitel „What’s My Name”. Fulton steuert dieweil wippende Breaks mit schunkeligem Digital-Bass bei, womit er deutlich macht, dass bei dieser Musik Humor definitiv erlaubt ist. Zwischen freiformartiger elektronischer und tribalistisch-akustischer Perkussion wechselt dann „Collage Panty Smelling”, über das Mutsumi einige geschriene Rap-Salven feuert. Von da an bewegen sich die beiden in diverse Richtungen, je nachdem, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Eine Country-Parodie mit „No More Fake Tits”, House im frühen Warp-Stil („Pimp Slap”), auch so etwas wie ein Grindcore-Freakout kommt mal vor („U Look Good & They Don’t”) – immer wieder diverse Stile in einer einzigen Nummer. Das mag einigen zu viel des Guten erscheinen, zu viel für diese Platte ist es nicht. Tim Caspar Boehme
