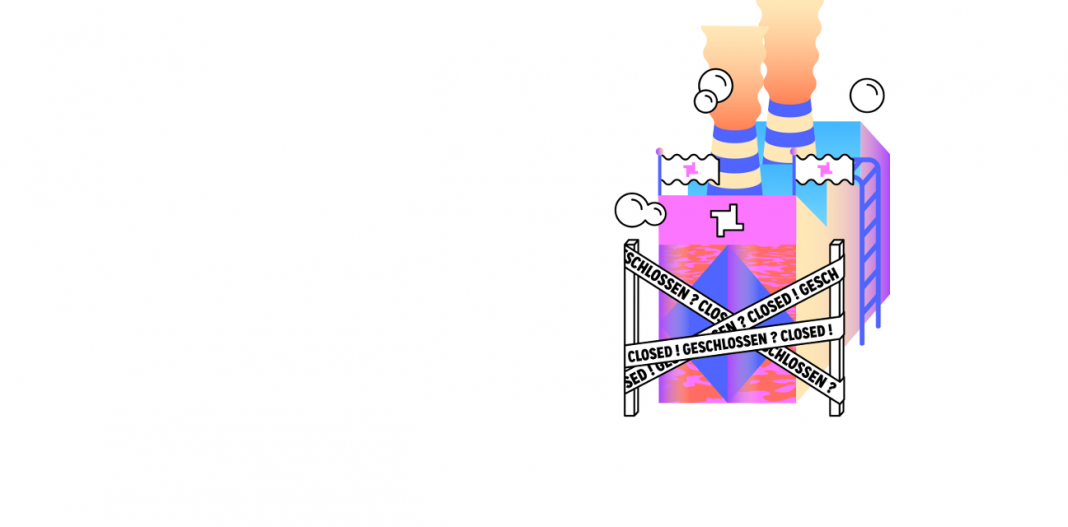Illustration: Vina Ćurčija
Und dann war’s vorbei. Ohne Abschiedsparty, einfach so. Hatten die Betreiber der Fabric am 5. August dieses Jahres noch eine neue Anlage für den zweiten Floor angekündigt, blieb Londons prominentester Undergroundclub am Wochenende darauf geschlossen. Nur temporär, hieß es erst, um mit der Polizei zu klären, wie es dazu kam, dass binnen zwei Wochen zwei 18-jährige Besucher des Clubs an einer MDMA-Überdosis starben. Doch die Lage war schwieriger als angenommen. Die Behörde ordnete eine Lizenzprüfung an und verkündete ihr Urteil am 6. September: Wegen zu lascher Sicherheitsvorkehrungen sei die Gefahr weiterer Drogentodesfälle zu groß, Fabric müsse permanent geschlossen bleiben.
Ein Aufschrei ging durchs Londoner Nachtleben. Via Twitter machten Künstler von Hudson Mohawke bis Disclosure ihrem Ärger Luft. Jon Hopkins brachte die schiere Unsinnigkeit des Urteils auf den Punkt: „Ich wollte am Samstag im Fabric
Drogen konsumieren. Aber jetzt, wo der Club geschlossen ist, werde ich sie im Klo runterspülen und nie wieder welche nehmen.“ Auch Fabric-Gründer Cameron Leslie konnte die Entscheidung kaum fassen: „Wir hatten immer ein fantastisches Verhältnis zur Polizei. Vor nur acht Monaten befand ein Richter, dass Fabric in puncto Sicherheit ein Musterbeispiel für Nachtclubs sei“, reagierte er in einem Statement. „Was hat sich verändert, dass wir nun von der Polizei als Krankheit unseres Viertels bezeichnet werden?“
Verändert hat sich nicht der Club, sondern das Viertel. Als Fabric 1999 in einem verlassenen Kühlhaus in Farringdon eröffnete, war die Gegend im Osten Londons subkulturelles Brachland. „Weil die Taxis nachts nicht in unsere Gegend fuhren, betrieben wir am Anfang unser eigenes Taxiunternehmen“, erinnert sich Leslie. Heute ist Farringdon – ironischerweise auch durch die Pionierarbeit von Fabric – eine Goldgrube für Immobilienhaie. Prominente Unterstützer wie Trainspotting-Autor Irvine Welsh vermuteten deshalb strategische Absichten hinter dem Urteil: „Die Fabric-Schließung markiert den Anfang vom Ende der Stadt als kulturelles Zentrum“, kommentierte er. „Obwohl Clubs einen Stadtteil kulturell aufwerten, sind sie unerwünscht. Weil sie nicht ins sterile Idealbild eines Viertels passen, mit dem Projektentwickler ihre Luxuswohnungen an Investoren aus Übersee verkaufen.“
Von dieser Entwicklung sind dieser Tage viele Londoner Gegenden betroffen. In den vergangenen Jahren verlor die Stadt 50 Prozent ihrer Nachtclubs, darunter 2016 so renommierte Läden wie Dance Tunnel und Plastic People. An jenem Ort, wo einst Dubstep geboren wurde, befindet sich heute ein schickes Burger-Restaurant. Einen Hoffnungsschimmer stellt der im Sommer neu gewählte Labour-Bürgermeister Sadiq Khan dar. In einem Statement zur Fabric-Schließung meinte der 46-Jährige, der früher angeblich selbst dort getanzt hat: Wenn London eine 24-Stunden-Stadt bleiben wolle, müsse das Clubsterben aufhören.
Anfang November ernannte Khan als Maßnahme die ehemalige BBC-Moderatorin Amy Lamé zu Londons erster „Nachtzarin“, sprich, zur politischen Vertreterin der Clubszene. In der Zwischenzeit hatte Leslie mit Benefizpartys in befreundeten Clubs 300.000 Pfund an Spenden gesammelt, um Fabric für einen langen Rechtsstreit zu wappnen. Dieser wurde aber am 21. November vorzeitig abgeblasen. In Gesprächen konnte man sich außergerichtlich einigen, das Fabric wird bald wiedereröffnen. Der Wermutstropfen: Wer zukünftig im Fabric feiern will, muss flughafenreife Kontrollen über sich ergehen lassen: Pass-Scanning am Eingang, noch genauere Sicherheitskontrollen als bisher, Videoüberwachung im Club. Ein Sieg fürs Nachtleben also? Mitnichten. Denn der Kompromiss spielt auch denen in die Hände, die London als Ausgehstadt noch steriler machen wollen. Oder wie es Irvine Welsh einmal formulierte: „Der Kampf gegen Drogen ist in Wahrheit ein Kampf gegen uns alle. Gegen alternative Lebensentwürfe. Es ist ein Kampf – der Staat gegen seine Bürger.“
Alle Jahresrückblicksthemen findet ihr hier in der Übersicht.