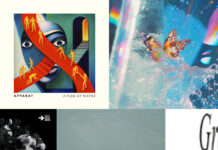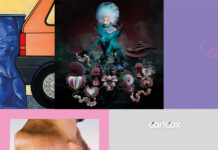Text: Florian Obkircher, Fotos: Mads Perch
Erstmals erschienen in Groove 138 (September/Oktober 2012)
Dan Snaith hat Blut geleckt. Viele Jahre war der in London lebende Kanadier der Liebling der avancierten Indie-Rock-Gemeinde. Als Manitoba oder später Caribou veröffentlichte er über die vergangenen zehn Jahre Platten zwischen verspielter Electronica und psychedelischem Pop. 2011 hat er schließlich eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Er reist – gerne auch an der Seite von Four Tet – als DJ durch die Welt. Mit Konsequenzen: Als Daphni veröffentlicht er nun ein großartiges House-Album. Raue wie deepe Tracks, aufgeladen mit analogen Acid-Lines, Flöten-Arpeggien und afrikanischen Drum-Loops. Der 34-Jährige im Interview über das neue Jetset-Leben, seine Prog-Rock-Jugend und Tiestos Ferrari.
Dein frischer Appetit auf Clubmusik, woher kommt der?
Gewissermaßen ist es eine Rückkehr zu meinen Wurzeln. Als Teenager hörte ich Sachen wie The Orb und Plastikman. In den frühen Nullerjahren kam dann aber eine Wende: Wir hatten mit Caribou gerade angefangen, live zu spielen, und es gab viele spannende Gitarren-Bands. Was mein Interesse an Dance Music dann neu entfacht hat, war James Holdens Album The Idiots Are Winning. Das klang so fantastisch anders, ich war von der Energie seiner Tracks fasziniert.
Gab es auch im Club für dich ein Initialerlebnis?
Das gab es in der Tat: ein DJ-Set von Theo Parrish im Plastic People-Club in London. Er spielte an diesem Abend viele seiner eigenen Produktionen wie „Going Downstairs“ und „Love Triumph“. Ich realisierte: Clubmusik kann so unkonventionell klingen und trotzdem funktionieren. Sie kann überraschen. Viele Tracks spielte er eine halbe Stunde lang im Loop. Bis die Leute anfingen zu tanzen. Das fand ich fantastisch.
Hast du dich daraufhin ins Studio gesetzt, um dezidiert andere Musik zu machen?
Ich wollte schon länger in Richtung Clubmusik gehen. Ich fing an, einfache Tracks für meine DJ-Sets zu basteln. Kleine Skizzen und Loops. Denn ich fand einfach nicht genug gute Platten zum Auflegen. Aber es stimmt, ich wollte Musik machen, die an einem bestimmten Ort funktioniert. Und dieser Ort – der Club – ist der beste Klangraum, den es gibt. Gerade ein Laden wie Plastic People mit seiner Mörder-Anlage. Ich weiß, die Leute konsumieren Musik heute auf ihren Laptop-Lautsprechern. Aber geh einmal auf die Hard Wax-Webseite und höre dir ein paar Snippets von den Platten an, die gerade gefeiert werden. Du wirst den Hype nicht verstehen – bis du genau diesen Track dann im Club hörst. Das war ein Anreiz für mich.
Schon auf dem aktuellen Caribou-Album Swim gab es tanzbare Stücke wie „Sun“. Wo ziehst du da die Grenze?
Die Daphni-Tracks sind instrumental. Caribou-Stücke sind komplexer, meistens klassische Songs. Daphni-Tracks entstehen zudem aus dem Bauch heraus. Ich bastle einen Groove und werfe meinen Modular-Synthesizer an. Dann suche ich noch ein gutes Sample und klatsche es drauf.
Entstehen Daphni-Tracks schneller?
Viel schneller. Ich hoffe, das schlägt sich nicht in der Qualität nieder. An einem Caribou-Song feile ich zum Teil sechs Monate. Von der Ausgangsidee bis zu qualvollen Entscheidungen wie: Soll’s eine Bridge geben? Sollen sich die Harmonien zwischen Strophe und Refrain ändern? Bei Daphni ist die Ausgangssituation anders: Ich lege heute Nacht auf. Es ist jetzt 14 Uhr, in drei Stunden muss ich zum Flughafen. Also setzte ich mich noch ins Studio und mache einen Track, den ich am gleichen Abend auflegen kann.
„Bei Daphni will ich mich nicht quälen. Ich mache einen Track und lege ihn auf. Entweder er landet im Müll oder er funktioniert.“
Fühlt sich die Arbeit an Daphni befreiend an?
Definitiv. Es ist so unkompliziert, alles geht so schnell. Als Caribou muss ich die Veröffentlichung planen, auf Tour gehen, viele Interviews geben. Verstehe mich nicht falsch, ich mag das. Aber mit Daphni geht alles schneller: Kieran (Hebden alias Four Tet, Anm. d. A.) spielte eines Nachts im Plastic People. Ich kam mit einem Track vorbei, den ich am Vorabend gemacht hatte. Er spielte ihn – und gleich darauf ein neues Stück von sich selbst. Wir fanden, dass die Tracks gut zusammenpassen. Und schon am nächsten Tag schickte er beide Stücke ins Presswerk. Ganz unkompliziert. Das Resultat war unsere Split-Maxi „Pinnacles / Ye Ye“ auf Kierans Label. Bei Daphni will ich mich nicht quälen. Ich mache einen Track und lege ihn auf. Entweder er landet im Müll oder er funktioniert – dann behalte ich ihn. Und wenn ich will, kann ich ihn dann unkompliziert auf meinem eigenen Label Jiaolong veröffentlichen.
Stream: Daphni – Ye Ye
Wenn du diese Freiheit und Schnelligkeit so genießt, warum erscheinen die Daphni-Tracks nun doch als Album?
Ich stellte fest, dass die Tracks gut zusammenpassen. Dass sie in ihrer Gesamtheit ein Album ergeben, das sich nicht wie eine Compilation anfühlt. Abgesehen davon denke ich, dass ich mit einem Album noch immer mehr Menschen erreichen kann. Ich merke das gerade jetzt, dass mich Leute darauf ansprechen. Leute, die keine Singles kaufen und wenig mit der Clubszene zu tun haben. Ein Album zieht einfach weitere Kreise.
Wie reagieren die Caribou-Fans eigentlich auf dein neues Projekt?
Bei meinen DJ-Gigs waren die Rückmeldungen sehr gut. Ich hatte auch nie das Gefühl, als Indie-Rocker wahrgenommen zu werden, der mal seine Lieblingssongs im Club auflegen will. Im Horst Krzbrg spielte ich vor einiger Zeit ein Neun-Stunden-Set. Ich wollte das so. Und es war eine der besten musikalischen Erfahrungen meines Lebens. Die Leute kamen früh und blieben bis zum Ende. Sie begaben sich mit mir auf diese musikalische Reise. Zwischen den Mixes bin ich dann selbst raus zum Tanzen. Ich hatte dieses Hochgefühl, das ich sonst nur bei Live-Konzerten verspüre.
Nach all den Jahren mit Band: Fühlt es komisch an, allein auf der Bühne zu stehen?
Am Live-Spielen liebe ich die Energie zwischen uns vieren, die sich auf der Bühne entspinnt. Wir sind alle voll involviert, wir improvisieren, ändern die Richtung der Songs spontan. Mal geht’s besser, mal schlechter. Aber am Ende spielen wir immer die gleichen Stücke. Als DJ versuche ich, mit den Leuten im Publikum zu kommunizieren. Rauszufinden, was sie hören wollen. Oder wofür sie bereit wären – auch wenn sie es nicht erwarten. Beim Auflegen geht es um die Interaktion mit dem Publikum, beim Live-Spielen mehr um die Interaktion auf der Bühne. Vereinfacht gesagt.
Arbeitest du parallel an beiden Projekten?
Das mache ich gerade im Moment. Und es ist perfekt: Wenn ich bei Caribou nicht weiterkomme, wechsele ich zu Daphni und umgekehrt.
Sampling war immer ein essenzielles Element deiner Arbeit. Aber die Ansätze sind bei Caribou und Daphni verschieden, oder?
Als Caribou verwende ich kurze Samples. Kleine Schnipsel, die ich als Einzelnoten verwende und daraus Melodien baue. Bei Daphni will ich Kollisionen erzeugen. Ich finde ein Soul-Sample, das mir gefällt. Ich loope es und schnalle eine Acid-Bassline dazu. Oder ein anderes Element, das man nicht erwartet. Fast so wie bei einem DJ-Set, wenn zwei Tracks ineinandergemixt werden.
Eines dieser Soul-Samples stammt von Buddy Miles, das du prominent in „Yes, I Know“ verwendest. Hast du die Samples auf der Platte rechtlich geklärt?
So gut wie möglich. Es gibt zum Beispiel einen Track auf dem Album, der als Remix ausgewiesen ist. Von einer Band namens Cos-Ber-Zam. Ich stieß auf einer Compilation des deutschen Labels Analog Africa auf das Stück. Die spezialisieren sich auf Re-Releases seltener afrikanischer Musik. Exzellente Auswahl, gut recherchiert, alle Stücke rechtlich abgeklärt. Ich verwendete also diesen Drum-Break und bastelte meinen Track darum herum. In diesem Fall konnte ich dank Analog Africa die Urheber des Stücks ausfindig machen. Auch wenn es am Ende als Remix gelistet ist, obwohl es kein Remix im klassischen Sinne war, fühlt es sich gut an, dass alles geklärt ist. Oft gelingt das nicht. Weil der Interpret nicht mehr auffindbar ist oder die Rechte an einen Verlag verkauft hat, der gar nicht an einer Zusammenarbeit interessiert ist, wenn du nicht Unsummen von Geld zahlst. In der Vergangenheit führten solche Fälle oft zu Stagnation. Ich konnte Platten nicht veröffentlichen, weil ich ein Mini-Sample nicht klären konnte.
Stream: Cos-Ber-Zam – Ne Noya (Daphni Mix)
Viele Produzenten starten ihre Karriere mit Sample-basierter Musik. Und machen sukzessive immer mehr selbst. Du gehst den umgekehrten Weg.
Das stimmt. Als Kind hatte ich Klavierunterricht. Ich lernte früh zu improvisieren, studierte Harmonielehre und Theorie. Trotzdem glaube ich, dass viele Produzenten einfach von Samples loskommen wollen, um zu zeigen, dass sie echte Musiker sind. Diese Angst hab ich schon lange abgelegt. Als Teenager stand ich auf Progressive Rock. Je schneller die Gitarren- und Keyboardsoli, desto besser. Bands wie Sonic Youth hielt ich für unfähige Dilettanten. Ich brauche diese Authentizitätsdebatte nicht, mir ist es egal, ob ein Stück aus Samples oder eingespielten Sounds besteht.
Was fasziniert dich am Sampling?
Wenn du am Keyboard eine Taste drückst, ist das Resultat recht steril und vorhersehbar. Anders ist es, wenn du einen Ton von einer Platte samplest. Du nimmst den Klang des Raums mit, du hörst ein leichtes Kratzen, wenn du von Vinyl aufnimmst. Der Sound ist reicher und komplexer, er hat Geschichte. Vielleicht bin ich da zu nostalgisch. Aber ich finde ältere Tracks des Wu-Tang Clan auch deshalb so toll, weil sie so verrauscht und dreckig klingen.
Wie bist du eigentlich zum Auflegen gekommen?
Lass mich kurz ausholen: Ich wuchs in einer Kleinstadt namens Dundas in Kanada auf. Einer meiner besten Freunde dort hieß Koushik. Ein kauziger Typ, der heute Platten auf Stones Throw veröffentlicht. Schon als Zwölfjähriger hatte er eine irre Plattensammlung, stand auf Hip-Hop und Soul und war bestens darüber informiert, was in London und Detroit abging. Von ihm habe ich viel über Musik gelernt.
Das heißt, er hat dich aus der Einbahnstraße des Progressive Rock befreit?
Genau. Eines Tages steckte er mir in der Schule eine Kassette zu. Ein Tape mit Ambient-Techno aus den mittleren neunziger Jahren. Black Dog, The Orb und so Zeug. Ich war baff. Damals hatte ich keine Ahnung von Clubmusik. Ich wusste nicht, dass die Typen in England dazu abgehen und Ecstasy schlucken. Es war eine Offenbarung.
War das nicht die Antithese zu der Musik, die du bis dahin gehört hast?
Total. Es hat alle meine Vorstellungen über den Haufen geworfen. Bis dahin glaubte ich: Wer die längsten Keyboardsoli spielen kann, ist der Beste. Die Musik auf dieser Kassette, das war gegen alles, woran ich glaubte. Aber es war so neu und faszinierend. Deshalb fing ich an, selbst Elektronik-Platten zu kaufen.
Dein erster DJ-Gig?
1997 zog ich nach Toronto. Dort veranstaltete ich mit Freunden meine ersten Partys. Einfach, weil wir unsere komische Musik auf einer guten Anlage hören wollten. Aber plötzlich waren da Hunderte von Menschen bei unseren Nächten. Es war die Zeit, als Ecstasy mit Verspätung in Nordamerika ankam. In Toronto gab’s damals jedes Wochenende Riesen-Raves. Wir hatten damit überhaupt nichts am Hut, aber die Leute kamen trotzdem zu uns. Einmal wollten wir uns einen Spaß erlauben und jemanden einladen, dessen Set wir lieben, das Publikum aber hassen würde: Four Tet.
Ihr kanntet euch damals schon?
Nicht richtig. Wir hatten uns einmal in London getroffen, ich war aber schon zu jener Zeit Fan seiner Musik. Damals als er noch seltsame Elektronik mit Free-Jazz-Loops machte. Das klang gar nicht nach Club. Aber er erzählte mir, er würde gelegentlich im Fabric mit Gilles Peterson auflegen. Also buchte ich ihn. Es war sein erster DJ-Gig im Ausland und er blieb eine Woche. Wir verstanden uns prächtig.
Wie war sein Set?
Ich dachte, er würde Pharoah Sanders-Platten spielen und den Dancefloor leeren. Aber er tat genau das Gegenteil: Er legte „Intergalactic“ von den Beastie Boys auf und Sachen wie „Koochy“ von Armand van Helden. Ein totales Party-Set! Ziemlich das Gegenteil von dem, was ich erwartet hätte. Aber es war super.
Was hast du damals aufgelegt?
Ich war ein Snob. Ich spielte viel Zeug, das ich aus Gilles Petersons „Worldwide“-Radioshow kannte. Broken Beats aus England, Platten von Compost Records.
„Ich hab schon früh beschlossen, nicht zu trinken. Ich wollte einfach anders sein. Bis heute habe ich noch nie Drogen genommen.“
Du sagst, dass es damals mit Ecstasy losging. Hat dich das nie gereizt?
Irgendwie nicht. In unserer Kleinstadt gab’s ohnehin keine Pillen. Es war eine Hippie-Hochburg, alle hörten Grateful Dead. Schon damals beschloss ich, nicht zu trinken. Ich wollte einfach anders sein. Bis heute habe ich noch nie Drogen genommen.
Jetzt wär’s wohl auch etwas spät damit anzufangen, oder?
Es wäre ein großes Ding. Ich müsste so viele Freunde anrufen. Sie würden nach London fliegen, nur um zu sehen, wie ich meinen ersten Joint rauche. Ich wollte damals einfach anders sein. Und dann traf ich Kieran, der war sehr ähnlich drauf. Wenn ich so darüber nachdenke, nimmt heute kaum einer meine Musiker-Freunde Drogen, zumindest nicht regelmäßig.
Fühlt man sich nüchtern zu später Stunde im Club manchmal allein?
Ich hänge schon mein ganzes Leben mit zugedröhnten Leuten ab. Und es macht eigentlich sehr viel Spaß, weil Leute auf Drogen ja oft lustiger sind. Ich fühle da keine Wand zwischen mir und den anderen.
Seit einem Jahr bist du als Profi-DJ unterwegs. Genießt du deine Nebenkarriere?
Als DJ führst du dieses zerrissene Leben. Am Wochenende legst du auf, dann sitzt du drei Tage zu Hause und machst Musik. Und am Freitag geht’s wieder zum Flughafen. Wenn ich mit Caribou unterwegs bin, spielen wir jede Nacht. Ich liebe das, aber momentan passt mir das DJ-Leben ganz gut. Weil ich mich auf die neue Caribou-Platte konzentrieren will. Und wenn ich dann am Wochenende mal rauskomme, ist das eine schöne Abwechslung.
Aber Caribou ist doch auch recht aktiv momentan. Zurzeit tourt ihr mit Radiohead, beim Melt!-Festival habt ihr als einer der Headliner gespielt. Dabei liegt das aktuelle Album schon drei Jahre zurück.
Das ist schon verrückt. Eigentlich wollten wir mit Caribou dieses Jahr live pausieren. Dann klopften Radiohead an. Und da sagst du einfach nicht Nein. Am Anfang dachte ich, wir müssten unsere Show ändern, unsere Songs umarrangieren, weil wir mit Swim ja schon ausgiebig auf Tour waren. Und dann realisierte ich: Den Leuten ist das total egal. Im Gegenteil, sie wollen genau diese Songs noch einmal hören. Trotzdem will ich das neue Caribou-Album bald fertig kriegen. Weil es toll ist, neue Songs zu spielen.
Wo du ja nun beide Seiten kennst: Bevorzugst du den Bandbus oder das Flugzeug mit DJ-Koffer?
Schwer zu sagen. Nordamerikanische Bands setzen sich ja einfach in den Van und fahren los. Sie schlafen auf dem Fußboden und verdienen fast nichts. Das hat Tradition, es ist dort Teil der Kultur. Ich erinnere mich selbst daran, dass wir auf Tour oft nicht sicher waren, ob das Benzingeld bis zur nächsten Stadt reicht. Und das ist schon toll, ich liebe diese Romantik. Als DJ ist das natürlich anders. Du wirst vom Flughafen abgeholt, dinierst in feinen Restaurants. Und vor deinem Set legst du dich noch einmal ins gemachte Hotelbett, weil der Flug ja auch so anstrengend war. Vor zwei Jahren prophezeite mir ein Freund: „Dieser DJ-Lebensstil wird dich verderben. Du wirst zu einem arroganten Arschloch, das Leute anschreit: Wo bleibt der Champagner?!“
Du wärst nicht der Erste …
Kann sein. Letztens erzählte mir der Veranstalter auf einem Festival in Kroatien, dass ein DJ danach verlangte, mit einem Mercedes abgeholt zu werden. Das Problem war nur, dass es in dem kleinen Nest gar keinen Mercedes gab. Zum Glück sind die Leute in meinem Umfeld anders. Ziemlich das Gegenteil der Swedish House Mafia.
Obwohl du diese Welt schon mitbekommst, oder? Nächste Woche spielst du auf einem spanischen Festival an der Seite von Steve Aoki und Tiësto …
Das stimmt. Aber nicht auf der gleichen Bühne. James (Holden, Anm. d. A.), Kieran und ich spielen abseits der Mainstage.
Erwartet das Publikum eigentlich andere Musik auf solchen Riesen-Raves?
Kieran und ich wagen im Sommer mit unseren gemeinsamen DJ-Sets ein Experiment. Wir wollen testen, ob wir mit unserer Musik auch auf großen Festivalbühnen bestehen können – ohne wie Tiësto Müll aufzulegen. Und wir sind bis jetzt sehr positiv überrascht. Mein Ziel als DJ ist es, mit Überzeugung zu spielen, nur Tracks, die ich wirklich auflegen will. Und wenn das eine Disco-Platte mit 100 BPM zur Hauptzeit ist. Weil es das ist, was ich von Leuten wie DJ Harvey oder Theo Parrish gelernt habe. Es waren diese genialen Momente, wenn sie etwas total Unerwartetes aufgelegt haben – und die Leute gerade deswegen ausgeflippt sind. Auf dem neuen Album gibt’s diesen Track, „Light“, der beginnt mit einem Flöten-Arpeggio. Und jedes Mal, wenn ich ihn auflege, flippt das Publikum aus. Weil es das Letzte ist, was sie in dieser Situation erwarten.
Du legst äthiopische Jazz-Platten genauso auf wie Disco- und Garage-Platten. Strukturierst du deine DJ-Sets?
Ich bereite meine Sets nicht vor. Aber durch Erfahrung lernst du, eine Dramaturgie aufzubauen, die sich über Stunden zieht. Bei Caribou ist das anders. Wenn wir anderthalb Stunden spielen, fühlt sich das sehr lang an. Es ist schwer, als Band die Spannung so lange aufrechtzuerhalten. Als DJ kannst du deinen Erzählstrang viel komplexer anlegen.
In welchem Moment im Set mixt man am besten eine Jazz-Platte rein?
Verschieden. Natürlich kannst du sie am Anfang spielen. Aber ich glaube, du kannst sie auch am Höhepunkt auflegen. Gleich nach deiner fettesten Techno-Nummer. Und es ist erstaunlich, wie oft das aufgeht. Deswegen macht mir das DJing so viel Spaß. Du kannst bei jedem Set Neues ausprobieren. Du kannst mehr machen als nur deine Mix-CD zu starten, so wie die Swedish House Mafia.
Spielst du eigentlich mit Vinyl?
Ich kaufe zwar sehr viele Schallplatten, aber ich lege mit USB-Stick auf. Ich bin in der Sache etwas gespalten. Das Vinyl-Sammeln ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Die ersten Daphni-Platten waren nur auf limitiertem Vinyl erhältlich. Ich finde es auch toll, dass junge Londoner Produzenten wie Floating Points oder die Hessle Audio-Jungs ausschließlich Platten spielen. Auf der anderen Seite finde ich nicht, dass Vinyl besser klingt als eine digitale Datei. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Unterschied zwischen einer Schallplatte und einem 24-Bit-Wave- File hören kann. Von allen DJs der Welt hätte ich am allerliebsten einmal Ron Hardy beim Auflegen erlebt. Und der spielte alles: Reel2Reel-Tapes, Kassetten, Vinyl. Wenn die Musik gut war, hat er sie gespielt. Leute, die Vinyl für das einzig Wahre halten, leben in der Vergangenheit. Sie sind erzkonservativ.
Aber hast du nicht gerade gesagt, die ersten Daphni-Platten wären nur auf Vinyl erschienen?
Wie gesagt, ich bin da gespalten. Natürlich kenne ich diese Faszination für das physische Objekt nur allzu gut. Als Teenager flog ich oft nach London und kramte stundenlang im Plattenladen Black Market. Es ist dieses Gefühl: Die Lieferung ist gerade gekommen, alle stürzen sich auf das pressfrische Vinyl. Das fehlt bei Digital- Veröffentlichungen.
Womit legt denn Four Tet auf?
Vorwiegend mit Vinyl. Aber in Clubs wird er damit immer mehr zum Kuriosum, gerade in den USA. Dort hört er oft: „Wow, schau, der legt mit schwarzen, großen Scheiben auf!“
Ist es eigentlich ein Zufall, dass eure beiden letzten Alben fast zeitgleich erschienen sind? Und dass sie bis dato eure elektronischsten waren?
Kein Zufall, nein. Weil wir zu der Zeit eine Entwicklung teilten. Wir waren beide oft bei Theo Parrishs DJ-Sets im Plastic People, wir entdeckten viel Musik gemeinsam. Deshalb passen unsere Platten so gut zusammen, wir sind musikalisch verbunden.
Wenn ihr gemeinsam auflegt, kommt es da vor, dass die Veranstalter das Wörtchen „DJ-Set“ absichtlich klein am Plakat verstecken?
Eigentlich nicht. Ich bin da auch sehr vorsichtig. Es muss klar, sein: Das ist ein DJ-Set. Weil ich nicht will, dass Leute auftauchen und glauben, dass sei ein Caribou-Konzert. In Zukunft will ich die Dinge trennen: Caribou bedeutet live, Daphni dagegen DJ-Set.
Obwohl du als Caribou sicher mehr Geld verlangen könntest, oder?
Aber darum geht’s mir nicht. Zu den meisten meiner Gigs fliege ich mit Ryanair. Von selbstverliebten DJs mit ihren Privatjets halte ich nichts, ich möchte mich da klar distanzieren. Bei Gigs ist mir wichtig: Die Anlage muss gut klingen und die Leute sollen nicht ausgenommen werden. Diese ganzen Superstars schauen doch nur auf sich selbst: „Wie kann ich noch mehr Geld verdienen?“ Sie sehen nicht, dass sie eine bessere Anlage mieten könnten, wenn sie auf ihren Business-Class-Flug verzichten würden.
Gibt’s im Rockgeschäft weniger solcher Typen?
Es ist das Gleiche. Wenn wir mit Caribou auf einem Festival spielen, kommen wir mit ein paar Koffern Equipment an. Die Band nach uns dagegen rollt mit zehn Trucks an. Und während deren Konzert denkst du dir, warum haben die all diese lächerlichen Gimmicks auf der Bühne? Der Gitarrist hat 15 Verstärker – und es klingt furchtbar. Mittlerweile gibt es viele Star-DJs, die mit einer Mega-Lichtshow aufwarten. Genau das ist die Falle, in die viele Star-DJs tappen. Sie erreichen ihr Limit. „Ich bin Tiësto, ich kriege eine Million pro Gig. Aber mehr als 500 Euro kann ich für einen USB-Controller einfach nicht ausgeben. Was kann ich tun, damit sich die Leute nicht verarscht fühlen, wenn sie 70 Euro für ihr Ticket bezahlen? Ich ziehe die größte Lichtshow der Welt auf.“ Und ich glaube, das ist ein Fehler. Weil man damit die Musik in den Hintergrund rückt. Ich würde sagen: „Tiësto, warum machst du nicht eine Show für 100.000 Leute und verkaufst die Tickets für zwei Euro? Dann hättest du keinen Druck und könntest dir trotzdem deinen Ferrari leisten.“
Mit Four Tet hast du im November genau das vor. Ihr schmeißt eine große Party mit prominenten DJ-Freunden in der Brixton Academy in London – für nur fünf Euro Eintritt.
Die Idee hatte Kieran während eines DJ-Sets von Steve Aoki. Wir standen an der Bühnenseite und schüttelten schmunzelnd die Köpfe als er sein Publikum mit Torten bewarf. Es ist natürlich nichts Falsches daran, dem Publikum eine Show zu bieten, aber die Musik darf dabei nicht untergehen. Beim Four-Tet-All-Nighter wird’s keinen Schnickschnack geben. Kieran will sogar im Dunkeln auflegen. Das wird lustig.