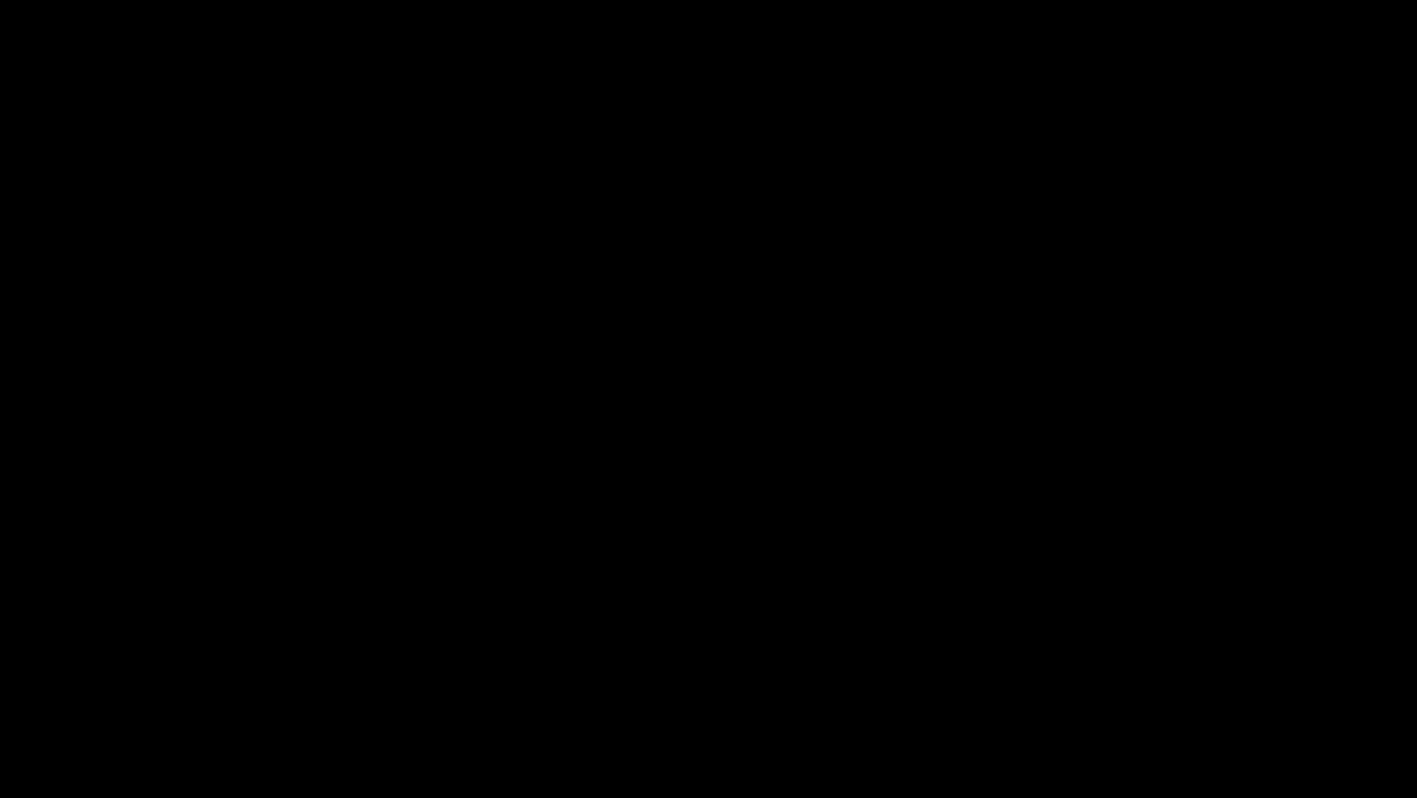Am 25. Mai wurde in Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd von Polizisten der Stadt vor laufender Kamera auf grausame Weise ermordet. Unmittelbar danach brach eine beispiellose Welle des Protests gegen den Rassismus der US-amerikanischen Polizei aus, der sich schnell in große Teile des Landes und viele Länder der Welt ausbreitete.
Zu Recht: Zwar wurde heute vor 145 Jahren die Sklaverei in Texas als dem letzten Bundesstaat der USA abgeschafft. Dennoch sind People of Color Weißen noch nicht gleichgestellt: Sie sind ihrem Alltag einem ständigen Rassismus ausgesetzt, sie haben weniger attraktive Jobs und sogar eine wesentlich kürzere Lebenserwartung. Eine weiße Familie besitzt im Durchschnitt zehnmal (!) mehr als eine schwarze. Wie bedingungslos sich diese Kluft durch sämtliche Lebensbereiche zieht, unterstrich der Coronavirus: für Schwarze war die Gefahr, an dem Virus zu sterben, dreimal so groß wie für Weiße.
Dass der Protest von Black Lives Matter auch international so stark aufgenommen wird, zeugt von einer Solidarität, der wir uns bedingungslos anschließen. Wir versuchen zu begreifen, was der institutionalisierte Rassismus der USA mit seinen dunkelhäutigen Opfern macht und wie rassistische Gewalt dort funktioniert. Dabei ist uns besonders wichtig, nicht allein von den Verhältnissen in den USA zu sprechen, sondern auch vom Rassismus hierzulande, der vielleicht oftmals etwas leiser daherkommt, aber nicht weniger zerstörerisch ist. Rassismus ist überall eine Herausforderung, die sich in jeder Gesellschaft anders stellt. Rassismus in Europa wird oft von der Kolonialgeschichte der betreffenden Länder geprägt und von Antisemitismus. Die Afroamerikaner*innen haben ein besonderes Schicksal: Sie wurden gezwungen, als Sklav*innen auf einem anderen Kontinent zu leben, und sie haben bis heute unter den Folgen der Sklaverei zu leiden. Zum Schweigen ließen sie sich nicht bringen: Afroamerikaner*innen prägten vom Beginn des 20. Jahrhunderts an bis heute die globale Popkultur. Auch deshalb ist ihr Kampf Vorbild und Bezugspunkt für alle unterdrückten Minderheiten.
Die Solidarität mit den Unterdrückten in den USA darf aber nicht dazu führen, dass wir den Rassismus in unserem eigenen Land übersehen oder weniger stark thematisieren. Für uns als Deutsche ist die Solidarität mit George Floyd und den anderen Opfern von Polizeigewalt und Rassismus in den USA genauso wichtig wie die Erinnerung daran, dass hierzulande PoC einem vergleichbaren strukturellen Rassismus ausgesetzt sind. Uns sollten die Namen der am 19. Februar dieses Jahres in Hanau Ermordeten genauso geläufig sein wie der von George Floyd (auch wenn wir aufgrund des Opferschutzes ihre Nachnamen nicht kennen). Sie hießen Ferhat U., Mercedes K., Sedat G., Gökhan G., Hamza K. Kaloyan V., Vili P., Said H. und Fatih S.
Wo steht da die GROOVE als Magazin für elektronische Musik und Clubkultur? Was hat Techno mit Rassismus zu tun, die GROOVE mit Black Lives Matter? Ohne afroamerikanische Musik, ohne House aus New York und Chicago, ohne Techno aus Detroit, ohne Breakbeats aus Großbritannien gäbe es unser Magazin nicht. Marshall Jefferson, Juan Atkins oder 4Hero erlaubten uns, ein Glück zu erleben, das ihnen in ihren eigenen Leben oft verwehrt war. Entsprechend präsent waren schwarze Musiker*innen in den 1990ern auf dem Cover der GROOVE. In diesem Jahrzehnt blickten unter anderem Carl Craig, Grooverider, Monette Evans, IG Culture, Dego, Massive Attack oder Derrick Carter den Leser*innen entgegen.
Techno und House wurden von der US-amerikanischen Musikindustrie komplett ignoriert. Die europäische Technoszene hingeben stellte sie ins Zentrum ihrer Bewegung. Einfach war die Beziehung zwischen den Musiker*innen, die aus kleinen, dicht gewebten Communitys stammten, und der explodierenden Szene in Europa, in der innerhalb von kürzester Zeit ein gigantisches Netzwerk aus Clubs, Raves, Plattenläden, Vertrieben und Magazinen entstand, dennoch nicht. Zum einen sorgte der enorme Erfolg einzelner DJs für Verwerfungen in ihren Communitys, oft irreparabler Natur. Zum anderen entstanden wenige nachhaltige Verbindungen, die über Bookings hinausgingen. Kollaborationen wie 3MB („3 Men in Berlin”) zwischen Musikern aus Detroit und Berlin blieben die Ausnahme. In den 2000ern entfernte sich die europäische Szene von ihren Wurzeln und wurde weiß, mittelständig und sehr unpolitisch. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf den Covern unseres Heftes wider. So hatten wir in den 2000ern gerade mal vier People of Color auf unserem Cover: Flying Lotus, Theo Parrish, Danger Mouse und Ibrahim Alfa.
Haben wir uns das vorzuwerfen? Zum Teil: Zum einen sind wir als Magazin verpflichtet, die Szene zu spiegeln. Wir können Künstler*innen nicht eine Relevanz attestieren, die sie nicht haben. Dennoch treffen wir natürlich eine Auswahl, setzen Akzente und weisen auf Missstände hin. Dass Techno nun auf einmal mehr den Mainstream als die Minderheiten repräsentiert, haben wir in dieser Zeit nicht direkt genug kritisiert.
In den 2010ern wurde zusammen mit der Geschlechtergerechtigkeit die ethnische Diversität zum großen Thema in der Szene. Zwar ist dieser Anspruch noch längst nicht erfüllt, aber immerhin muss sich jede*r Veranstalter*in heutzutage damit befassen. Gleichzeitig wurden Techno und elektronische Musik zu einem globalen Phänomen. Diese Entwicklungen beeinflussten auch unsere Cover: In den 2010ern tauchten dort mehr Frauen auf als je zuvor (wenn auch längst nicht 50 Prozent) und zum ersten Mal Künstler*innen aus Asien (Peggy Gou), Afrika (Portable) und Südamerika (Arca). Davor wurde Techno, der nicht aus Nordamerika oder Europa stammte, nämlich so gut wie gar nicht wahrgenommen.
Wo stehen wir heute? Wie wirkt sich die Aktivität von Black Lives Matter auf unsere Arbeit aus? Zum einen erinnert die Bewegung uns an unsere musikalischen Wurzeln. Wie können wir die Beziehung zu den afroamerikanischen Künstler*innen so gestalten, dass wir sie und ihre Musik nicht ausbeuten? Als ersten Schritt werden wir eine Reihe von Interviews, die wir mit Marshall Jefferson, Todd Terry, Green Velvet, David Morales, Robert Owens, Nile Rodgers, Afrika Bambaataa und DJ Pierre für das Heft geführt haben, digitalisieren. Wir arbeiten an einem Artikel darüber, wie US-amerikanische Elektronik-Künstler*innen die Ereignisse der letzten vier Wochen einschätzen. Generell wollen wir stärker darauf achten, dass bei uns so viele PoC-Artists wie möglich vorkommen, die relevante elektronische Musik produzieren. Darüber hinaus wollen wir den Rassismus in der Clubszene häufiger direkt thematisieren.
Dunkelhäutige Menschen werden in Deutschland Opfer von verbaler und physischer Gewalt, sie haben nicht dieselben Karrierechancen, sind in vielen Aspekten des Lebens benachteiligt, etwa bei der Wohnungssuche. Bis zur Einwanderungswelle nach Berlin in den 2000ern und 2010ern war elektronische Musik in Deutschland eine ziemlich weiße Angelegenheit. Dennoch prägten eine ganze Reihe Musiker*innen mit nichtdeutschen Wurzeln die Szene, Cem und Can Oral, Ata, Ricardo Villalobos, Virginia, &Me oder Len Faki zum Beispiel. Faki hat in unserer letzten Printausgabe davon berichtet, dass für ihn als Jugendlichen in Stuttgart mit türkischen Eltern die Technoszene unter anderem so reizvoll war, weil dort seine Herkunft nicht thematisiert wurde. Die Geschichten dieser Musiker*innen wollen wir erzählen. Wir wollen wissen, welchen Repressalien sie ausgesetzt waren, wie sie sich dagegen gewehrt haben und wie sie die Musik und unsere Szene zu dem machten, was sie ist. Natürlich wollen wir dabei ihren Status als deutsche Musiker*innen nicht relativieren, sondern ihnen in einem rassistischen Umfeld den Rücken stärken.
Berlin schmückt sich damit, eine der freiesten Städte der Welt zu sein. Das gilt vor allem für Weiße und Expats aus anderen Industrieländern. Aber nicht für Berliner*innen mit türkischen, arabischen und afrikanischen Wurzeln, zusammen etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Sie werden an den Türen der Clubs der Stadt meistens abgewiesen. Wir wollen erforschen, wie dieser Aspekt von strukturellem Rassismus funktioniert und wie wir ihn beseitigen können – in der Hoffnung, dass unsere Utopie von Peace, Love & Unity eines Tages für alle Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe Wirklichkeit wird. Und vielleicht vertieft diese Auseinandersetzung mit Rassismus unsere Beziehung zu den afroamerikanischen Musiker*innen so, dass wir sie bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit auf eine Weise unterstützen können, die nicht bloß ein Lippenbekenntnis ist.