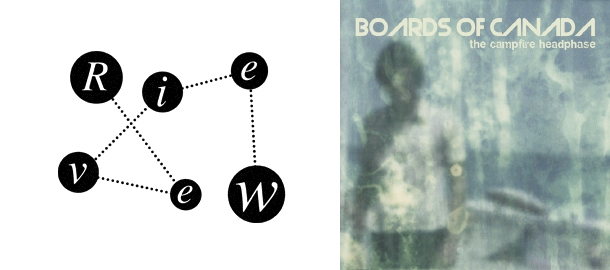„Wie Headphase? Kommt die nächste Platte jetzt mit Kinderliedern?? Das darf nicht sein, man kann die letzten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, doch nicht einfach so für ein schreiendes Balg wegwerfen! Wir haben uns doch zusammen etwas aufgebaut, sind ein Stück des Weges gemeinsam gegangen. Und jetzt soll das alles vorbei sein…“
So oder ähnlich kann man sich die Topics vorstellen, die in den Monaten seit Bekanntgabe des Release-Termins gewisse Messageboards in Windeseile zuwucherten. Sinngemäß auch so zusammengefasst: Boards of Canada gehören mir und ich habe ein Recht darauf, dass sie das tun was ich erwarte. Sich nicht verändern vor allem.
Eine regelrechte Hysterie kam auf, die man bisher in dieser elektronischen Musikszene nicht kannte, selbst Richard James hätte auf dem Zenit seiner Karriere arge Schwierigkeiten gehabt da mitzuhalten. Doch woran liegts? Bestimmt nicht an klassischer Promotion, die gab es nämlich in der Vergangenheit weniger als nicht – das Interview in diesem Heft war bestimmt so manchen Redakteurs feuchter Traum. Dann schon eher die Masche mit „sich rar machen und dann um so begehrter sein“. Aber auch die funktioniert ja eigentlich nur, als Masche zumindest, wenn man zumindest minimalen Kontakt hält und zum Beispiel mal von dem Panzer erzählt, den man sich gerade gekauft hat. Auch das haben die Sandisons nicht getan. Nein, wahrscheinlich ist das Ganze so banal wie einleuchtend. Für mich zumindest. Es liegt an der Qualität ihres Sounds, noch unterstützt durch ihr Geschick mit Covern und Artwork Stimmungen zu festigen. Und Boards of Canada sind Perfektionisten. Dass sie alleine ein halbes Jahr an der Postproduktion dieses Albums gesessen haben um den Tracks virtuelle Patina, quasi Pro-Aging zu verschaffen, diese typische BoCsche Note von Erinnerung und Vergänglichkeit, die mehr durch Emotionen als klare gedankliche Struktur gehalten wird, spricht Bände.
Die Tracks scheinen bereits gelebt und gestorben zu sein, bevor sie veröffentlicht wurden, Artefakte die teilhaben lassen an gleichzeitig persönlicher wie interpretierbarer Geschichte. So was will man natürlich nicht verlieren. Und musikalisch, nun ja, die Gitarre hat einen zentralen Platz in dem bis dato streng elektronisch gehaltenen Ensemble erhalten, auch wenn es mehr die Mimikry einer Gitarre nach unzähliger Prozessualisierung und Bearbeitung ist. Ansonsten ist die Basis den bisherigen Veröffentlichungen sehr ähnlich, vielleicht ein wenig leichter und heller als bisher. Schleppende, deepdowne Beats, bittersüße Atmosphäre und Naturnähe, gepaart mit einer unglaublichen kompositorischen Dichte und Detailreichheit, die bei jedem Hören neue Entdeckungen zulässt und immer wieder flasht. Und so pathetisch es ist, beim Titel des Albums denke ich auch irgendwie ständig „Love will tear us apart“.