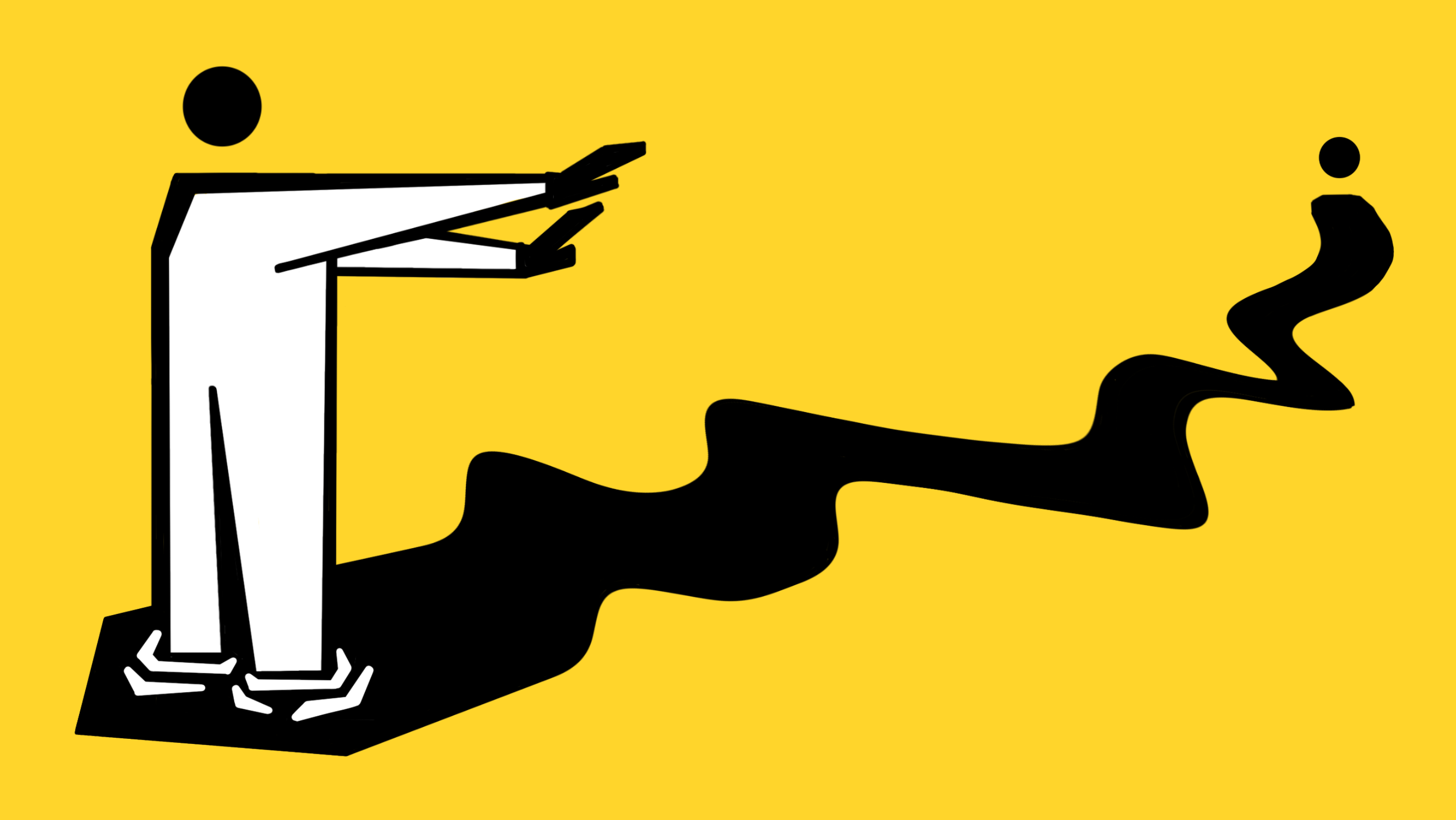In der Krise selbst ging es mir, wie vielen, streckenweise nicht so gut, sagt Panthera Krause. (Illustration: Dominika Huber)
Psychische Gesundheit, mental health, Work-Life-Balance – wichtige Konzepte, wichtige Themen. Und: leere Buzzwords? Je öfter wir diese Begriffe lesen und hören, desto mehr glauben wir, zu wissen, was sie bedeuten. Aber: Was ist eigentlich mentale Gesundheit? Was ist gesundheitsförderlich, was macht uns krank – psychisch?
Und sind Techno, das Feiern und die Community des Nachtlebens heilsam – oder doch eher das Gegenteil? Welche Rolle spielt Corona für Akteur*innen der Szene, für ihre psychische Gesundheit, bis heute? GROOVE-Autorin Nastassja von der Weiden hat sich mit zwei DJs aus Leipzig und Berlin und einer Psychologin über das Thema unterhalten.
Mentale oder psychische Gesundheit ist ein Dauerthema. „Mental gesund” bedeutet dabei nichts anderes als die Abwesenheit psychischer Krankheiten. Mentale Gesundheit und Krankheit bestehen dabei aber aus einem Spektrum mit vielen, vielen Zwischentönen – kein schwarz-weiß-binäres System, bei dem Null gesund und Eins krank bedeutet. Einerseits wird über diese Art von Gesundheit viel gesprochen, zum Beispiel über Grenzen setzen, auf sich achten – interdisziplinär, durch alle Kreise hindurch, auf allen Plattformen.
Corona hat viele Menschen, besonders im Kultursektor, stark verunsichert; ihnen den Boden unter den Füßen entrissen, ihnen Ausgleichsmöglichkeiten und safer spaces weggenommen.
Andererseits sind Stigmatisierung und Scham Schlagworte, die wie ein schwarzer Schatten an allen Themen, die mit psychischen Problemen zu tun haben, kleben und es weiterhin schwer machen, darüber frei und offen zu sprechen. Denn wer psychische Probleme hat, folgt man dem gängigen Stigma, der- oder diejenige weicht von der Norm ab, ist weniger produktiv, weniger leistungsfähig – und damit ungewollt, irrelevant oder unsichtbar in unserer neoliberalen Leistungsgesellschaft.
Corona als Tiefpunkt
Shaleen, DJ und Produzentin bei BPitch, setzt sich dem entgegen. Sie redet offen darüber, dass sie vor allem in der Coronazeit zu kämpfen hatte, und möchte damit Awareness schaffen. Shaleen ist als DJ viel unterwegs, lebt von und für Techno. Der erste Lockdown war für sie ein Schock: „Ich fand die Ungewissheit am schlimmsten. Nicht zu wissen, ob und wie es weitergeht – das hat mich fertig gemacht. Musik machen, Partys und Kultur, das alles ist mein Lebensinhalt, dafür lebe ich. Und das war plötzlich alles weg”, erinnert sie sich im Gespräch am Telefon.
Ihre Situation klingt typisch für Kulturschaffende. Sie bekam zwar finanzielle Künstler*innenhilfe, aber als die aufgebraucht war, musste sie sich umorientieren: „Ich habe erst mal alle möglichen Jobs gemacht, habe bei Edeka und im Hotel gearbeitet – und habe mich da sehr fehl am Platz gefühlt.” Zeitgleich habe sie sich aus einer toxischen Beziehung befreit. „Die Coronazeit war also wirklich furchtbar und extrem belastend für mich”, sagt sie.

Genau solch eine Situation oder eine plötzliche Veränderung, wie Shaleen sie erlebt hat, können die psychische Gesundheit aus dem Lot bringen. Das können Gründe wie Todesfälle, Unfälle, Krankheit, Jobverlust, Flucht und Vertreibung oder andere traumatische Erlebnisse sein. Aber auch das Ende eines Studiums, der Einstieg ins Berufsleben oder die Geburt eines Kindes können Auslöser für eine Überlastung oder eine psychische Talfahrt sein.
Corona hat als globale Krise, aber auch als persönliche Krise viele Menschen, besonders im Kultursektor, stark verunsichert; ihnen den Boden unter den Füßen entrissen, ihnen Ausgleichsmöglichkeiten und safer spaces weggenommen. Die Nachtkultur ist dabei als Ort zu begreifen, der einerseits Raum für Gemeinschaft und progressive, soziale, politische, intersektionale Entwicklung und gleichzeitig ein Ort der Grenzüberschreitung, Ausbeutung und Selbstsausbeutung sein kann. Also ein komplexer Ort, der vielen, auf Künstler*innen- und Publikumsseite, die Möglichkeit zum Tanzen, stundenlangen Bewegen und Loslassen gegeben hat.
Wir sollten uns fragen: Was tut uns gut? Und wir sollten versuchen, das unabhängig von dem, was uns als „gesunder Lifestyle” und „mental health care” verkauft wird, zu beantworten.
Manchen aus der Branche wird erst in der Nachbetrachtung klar, wie viel Belastung sie in dieser Zeit ausgehalten haben. Welche Ängste sie hatten, wie sehr sie die Community in Clubs vermisst haben – oder auch nicht. Manche haben an den Nachwirkungen bis heute zu leiden, auch weil die Unsicherheit bis heute weiter bestehen bleibt.
Shaleen hat fest daran geglaubt, dass ihr altes Leben und ihr Optimismus wieder zurückkehren werden. Und sie hatte Recht – im Sommer tourte sie wieder durch Deutschland und kann mit schwierigen Phasen nun besser umgehen. Sie hat in der Coronazeit eine persönliche Strategie für sich entwickelt: „Yoga hat für mich einen großen Teil dazu beigetragen, mental gesund zu bleiben. Dazu habe mich jeden Tag mit mir auseinandergesetzt. Und auch das Nachtleben, die Kreativität dort und die Begegnungen im Club, die jetzt wieder möglich sind, sind wichtig für mich.”
Strategien, um gesund zu bleiben
Was sind weitere Strategien, um mental gesund zu sein und zu bleiben? Diese Frage kann Paula Kittelmann genauer beantworten. Paula ist Psychologin und macht eine Ausbildung zur Psychotherapeutin im Verfahren Tiefenpsychologie, sie beschäftigt sich also beruflich mit mentaler Gesundheit und psychischen Erkrankungen. Im Rahmen der politischen Bildungsarbeit, die Paula macht, setzt sie sich speziell mit der gesellschaftskritischen Perspektive auf das Thema auseinander.

Kittelmann empfiehlt, sich zu fragen: Was ist meine Vulnerabilität, meine Anfälligkeit? Womit habe ich Schwierigkeiten, was ist für mich besonders stressauslösend – und warum? Dafür brauche es Zeit und Ruhe, sich wirklich mit sich und den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Manchmal gelänge es uns selbst, diese Bedürfnisse hinsichtlich mentaler und emotionaler Gesundheit zu erkennen, manchmal bräuchten wir dabei die Unterstützung von Therapeut*innen. Wir sollten uns fragen: Was tut uns gut? Und wir sollten versuchen, das unabhängig von dem, was uns als „gesunder Lifestyle” und „mental health care” verkauft wird, zu beantworten.
Wir treffen uns für das Gespräch in einem Eiscafé im Leipziger Westen, zeigen unsere Impfzertifikate vor und bestellen Kaffee.
Denn Produkte, Seminare, Coachings, die viel Geld kosten, aber eben eher etwas mit Lifestyle und Konsum zu tun haben als mit Fürsorge für die eigene Psyche, seien weniger hilfreich. Nicht, dass sie nicht unterstützend wirken könnten. Doch wir sollten nicht unterschätzen, wie auch dort versucht wird, mit unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden Profit zu machen: „Zum anderen trägt es zur Stigmatisierung bei. Psychisch krank, das ist eine Abweichung von der Norm, das ist ‚verrückt’, das ist nicht leistungsfähig, das ist etwas, was vermieden werden sollte”, erklärt Paula.
Der Don’t-worry-be-happy!-Lifestyle bagatellisiere dabei psychische Erkrankungen. Die mentale Gesundheit, wie sie oft auch auf Social Media zelebriert werde, brauche meistens entweder viel Zeit oder viel Geld – und es gibt genug Betroffene, die von beidem wenig haben.
Instagram: Hinterherlaufen, aber nie ankommen
„Das Thema hat mehr Transparenz und Einblicke verdient”, sagt Robert Krause alias Panthera Krause, DJ, Mitbetreiber von Riotvan und Produzent aus Leipzig. Er hat sich, genau wie Shaleen, auf einen Aufruf bei Instagram, wer aus der Szene über mentale Gesundheit sprechen möchte, gemeldet. Wir treffen uns für das Gespräch in einem Eiscafé im Leipziger Westen, zeigen unsere Impfzertifikate vor und bestellen Kaffee. Wir kommen als Erstes auf die App zu sprechen, über die wir für dieses Interview kommuniziert haben: Instagram. Und mit diesem Stichwort sind wir schon mitten im Thema.

Denn gerade Instagram kann für Akteur*innen der Nachtkultur, zum Beispiel für DJs, Veranstalter*innen und Producer*innen, zu einer großen psychischen Belastung werden. Instagram ist als Teil der sozialen Medien in den letzten Jahren immer mehr zum Imagepflege- und Marketingtool geworden. Alle sind dort, alle machen mit, all good, um nicht zu sagen brillant, überall Superlative, die Realität wird einseitig gut und verzerrt wiedergekäut. Die Grenze zwischen Privat- und Künstler*innenpersona verschwimmt dort stark.
„Es ist ja offensichtlich: Man vergleicht sich ununterbrochen mit anderen. Wo andere DJs spielen, zum Beispiel. Das hat teilweise richtig Panik und Stress bei mir ausgelöst. Gleichzeitig ist es natürlich auch Teil des Business, sich als Künstler zu präsentieren. Und man bekommt ja auch etwas, das einen bei der Stange hält: Likes und Dopamin.” Durch Corona hat sich seine Beziehung zu Instagram verändert: „Durch den Corona-Stillstand fand ich Instagram nicht mehr so interessant. In der Krise selbst ging es mir, wie vielen, streckenweise nicht so gut. Ich habe mich dann von diesem Druck, bei Instagram dabei zu sein und zu posten, etwas lösen können.”
Wer gehofft hat, fünf Tipps zur mentalen Gesundheit in diesem Text zu lesen, wird jetzt vielleicht enttäuscht sein.
Eine wichtige Erkenntnis war für Krause: „Wenn man einmal in diesem Vergleichen drin ist, läuft man ja nur hinterher und kommt nie an.” Er habe gelernt, mehr auf sich zu schauen, mehr bei sich zu sein. Und das beschreibt in Teilen schon gut, was mentale Gesundheit für Robert bedeutet: Die Möglichkeit, sich wahrnehmen und spüren zu können, also mit sich umgehen zu können. Zeit und Freund*innenschaften sind für ihn dabei wichtige Faktoren bei der Reflexion. Und: „Eine Mischung aus Struktur und Loslassen ist dabei für mich auch wichtig. Kleine Aufgaben zu erledigen zum Beispiel hilft mir, um ein Gefühl von Kontrolle zu haben”, sagt er.
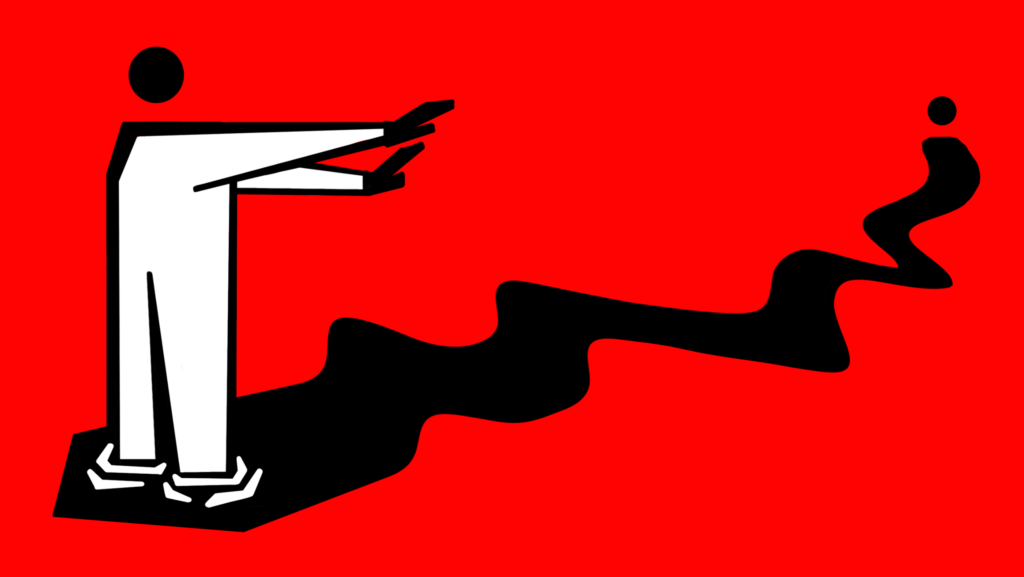
Die Ansätze, um an der eigenen psychischen Gesundheit zu arbeiten, sind also individuell und vielseitig. Wer gehofft hat, fünf Tipps zur mentalen Gesundheit in diesem Text zu lesen, wird jetzt vielleicht enttäuscht sein. Aber: Diese fünf Tipps gibt es nicht, nirgends. Es gibt keine allgemeingültigen Wunder-Tipps für eine stabile mental health. Für manche funktionieren Reflexion, Gespräche mit Freund*innen, Yoga, Sport und Bewegung, eine feste Tagesstruktur, Listen zum Abhaken führen, Tanzen; ja, auch in Clubs gehen kann wichtig, gut und heilsam sein – und für manche funktioniert eben genau das nicht, nicht mehr oder diese Strategien sind nicht ausreichend. Jede Person sollte die Möglichkeit haben, das für sich herausfinden zu können. Und manchmal kann bei der Suche nach Strategien ein*e Therapeut*in helfen – nicht alles müssen wir mit uns selbst oder unseren Freund*innen ausmachen und bearbeiten.
Unsere Autorin Nastassja von der Weiden hat kürzlich unter dem Pseudonym Antoinette Blume gemeinsam mit Leipziger Illustrator*innen ein Buch herausgebracht. Die zweite Auflage von Das Geräusch des Gurgelns/Fadenland erscheint Mitte Dezember im Verlag Marian Arnd.