Nach über fünf Jahren Funkstille reanimiert Luke Slater seine L.B. Dub Corp, um mit Saturn To Home ein fulminantes Album zu veröffentlichen. Es glänzt nicht nur durch seine ausgezeichneten Gastbeiträge (unter anderem von Robert Owens, Paul St. Hilaire und Baal & Mortimer), sondern liefert auch einen beeindruckenden Querschnitt durch die unterschiedlichen Produktionstechniken des englischen DJs und Produzenten. Wir haben den aktuellen Release zum Anlass genommen, um mit Slater über die Interna seiner Produktion zu plaudern.
Der geradezu unvermeidliche Einstieg in ein Gespräch mit Luke Slater über seine Musik ist die Frage, warum er sein neues Album Saturn to Home als L. B. Dub Corp und nicht unter einem seiner anderen Moniker – etwa Planetary Assault Systems, The 7th Plain, Translucent, Krispy Krouton, Deputy Dawg – veröffentlicht.
Slater nimmt die Frage ernst und antwortet ausführlich. „Das mit der Namensgebung war immer schon knifflig, seit ich 1993 zunächst als Luke Slater angefangen habe, Musik zu machen. Schnell kam das Pseudonym Planetary Assault Systems für meine etwas technoidere Seite dazu. Wenn ich als DJ auflege, kennt mich natürlich jeder als Luke Slater. Auch wenn das, was ich auflege, eher mit Planetary Assault Systems zu tun hat. Saturn To Home wollte ich eigentlich Luke Slater zuordnen. Es knüpft für mich musikalisch an Freek Funk aus den Neunzigern an. Aber der Name steht inzwischen für etwas anderes. Und wenn ich auf einem großen Festival als Luke Slater spiele, wissen die Leute genau, was sie bekommen. Ich wollte diese Fans nicht irritieren. Deswegen fühlte sich L.B. Dub Corp am Ende wie ein gutes Zuhause für diese Musik an.”

Höfliche Anarchie
Gefragt, wie es denn zu dem Pseudonym gekommen sei, berichtet der juvenil wirkende Brite, dass er vor vielen Jahren in einer Wohnung in der Nähe der London Bridge lebte. „Einer wirklich hübsche Straße namens Burnaby Street, die allerdings damals schon ziemlich gentrifiziert war. Das hat mich wahnsinnig deprimierte, weil es keine kulturelle Vielfalt gab. Ich liebe es aber, an Orten zu sein, die bunt und abwechslungsreich sind. In einem Anflug von höflicher Anarchie beschloss ich, dass wenigstens mein Dub-beeinflusster Techno in dieser Straße hergestellt wird. Von der London Bridge Dub Cooperation”, gibt er lachend zu Protokoll.
Viele Jahre ist das her, heute lebt der Musiker mit seiner Familie in der Grafschaft Sussex im Süden Englands. Hier hat er sich in einem ländlich gelegenen Haus einen komfortablen Studioraum eingerichtet, den er liebevoll „Spacestation Zero” nennt. Als ich mich nach dem deutlichsten Unterschied zwischen dem Leben in London und auf dem Land erkundige, entgegnet Slater schmunzelnd, dass es viele Vögel gibt. „Sehr viele Vögel”, ergänzt er. „Es haut einen förmlich um. Manchmal muss ich um vier Uhr morgens aufstehen, um ein Flugzeug zu einem Gig zu nehmen. Plötzlich ist da dieser gigantische Chor, fast wie eine Wand vor einem. Er singt ‚Hey, wir sind da, wir leben!’”
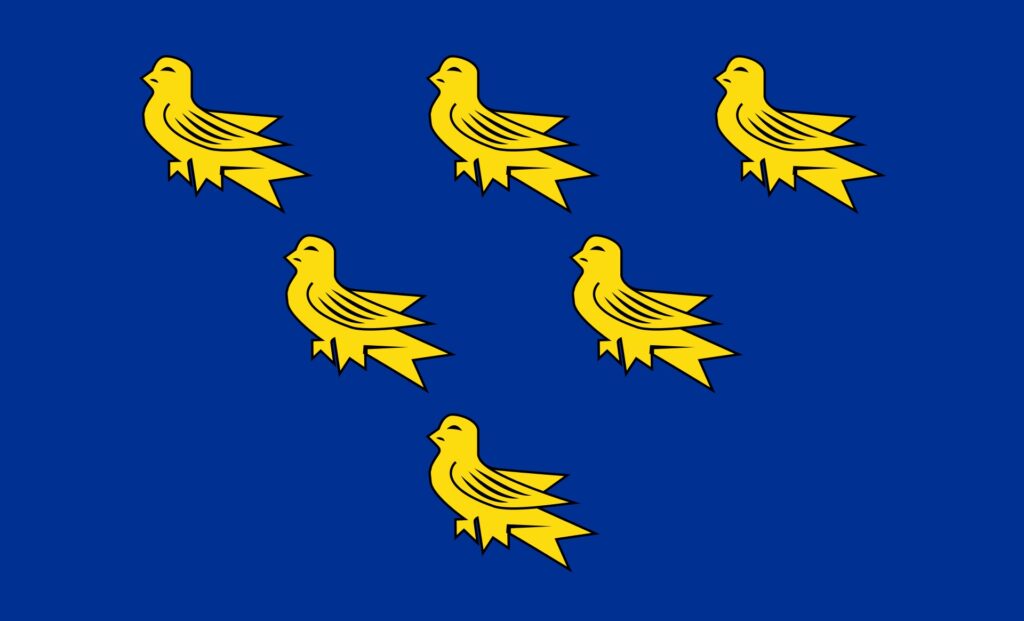
Hinter Slaters Studiotür sorgt eine umfangreiche akustische Behandlung des Raums mit Absorbern, Bassfallen und Diffusoren dafür, dass weder Federvieh noch unerwünschte Raumanteile hörbar sind. Und spätestens, wenn er das gigantische MasterStack12-System von der High-End-Monitorschmiede Barefoot in Betrieb nimmt, das aus insgesamt zehn einzelnen Lautsprechern besteht und eine Gesamtleistung von 3500 Watt entfalten kann, ist der Raum ohnehin erfüllt mit Klang.
Obwohl die Barefoots einen ausgesprochen neutralen Klang haben, geht das Ausgangssignal direkt hinter dem Pult noch in einen seltenen Trinnov Audio ST2 Pro – eine Raumentzerrungs DSP-Einheit. „Wenn ich will, kann ich den Klang hier absolut flat machen”, sagt Slater. Das sei aber völliger Blödsinn. „Studios sind nur Kaninchenlöcher, in denen man versucht, eine Wahrheit aus den Lautsprechern herauszuholen, die es gar nicht gibt. In der realen Welt gibt es keine Referenz. Wenn man einen Track macht und ihn in einem Club spielt, ist das anders, als wenn die Leute ihn im Radio hören. Die Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen”.

Dabei ist im Studio eine klare Zweiteilung erkennbar. Der Mixbereich, mit einer ausgezeichneten Origin-Analogkonsole von SSL, ist flankiert von Racks, die mit so ziemlich allem bestückt sind, was die letzten 60 Jahre Studiotechnik hervorgebracht haben. Das Arsenal reicht hier von klassischen Neve-Preamps, über (sehr viele) API-500-Serie-Kassetten, Chandler (Curve Bender), Eventide (DSP4000), Mäag (EQ4M), Pultec (EQP1S) bis hin zu einem Roland Space Echo (RE-201) und dem Modular Channel 8755 von Overstayer. Letzterer sei die vielleicht wichtigste Klangfarbe in der bunten Outboard-Palette von Slater.

Rückseitig ist das Experimentierfeld des Produzenten angesiedelt. Dort befindet sich nicht nur ein Rack mit einer wunderbaren Sammlung ikonosonischer Synthesizer (Roland JD-800, Jupiter-6, Alesis Andromeda, Oberheim OB-X). Auch ein Colossus-Modularsystem von Analogue Solutions, das eine aktuelle Inkarnation des legendären EMS Synthi 100 ist, hat hier Platz. Quer im ganzen Raum verteilt finden sich außerdem unzählige kleine Grooveboxen, Controller und Synthesizer. Und gerade diese sind für Slater die eigentlichen Keimzellen seiner Musik. Denn er liebt es, sich mit nur einem einzigen Gerät über Stunden auseinanderzusetzen. „Du kannst dir Tonnen von Equipment kaufen. Wenn es darauf ankommt, zählt das, was man mit dem macht, was man im Moment vor sich hat”, so Slater.

Vor diesem Hintergrund sieht Slater seine großen Colossus-Synthesizer und sein kleines, portables Modularsystem von ALM Busy Circuits weniger als Synthese-Stationen, sondern mehr wie große Grooveboxen. Er glaubt, dass es an seinem Alter liegt, dass er sich im Prinzip nicht wirklich für Modularsynthesizer interessiert. Schließlich habe er das Ende der ursprünglichen Modular-Ära noch erlebt. Seine beiden Modularsysteme empfinde er nur deshalb inspirierend, weil alles in einem einzigen Gerät passiert. Über das ALM-Case sagt Slater: „Es ist zwar durch und durch ein Modularsystem, hat aber alles, was eine Groovebox ausmacht. Du hast einen Sequenzer (ASQ-1), einen Sampler (Squid Salmple – der schreibt sich wirklich so), Oszillatoren (Tazm-O), Mixer (Mega-Tang), Filter (MCFx2) und einige Effekte (MFX) drin.”

Track-Wurzeln
Die konzentrierte Arbeit mit nur einem Gerät – sei es Modularsystem, Drumcomputer oder Synthesizer – bezeichnet Slater als das Setzen einer Wurzel. „Ich mache gewissermaßen einen Live-Jam über sechs oder acht Minuten und lege den Grundstein. Es geht immer um diese erste spontane Aufnahme, aus der sich alles entwickelt. Manchmal probiere ich dabei stundenlang rum, und es kommt nur Blödsinn raus. Manchmal ist die Root nach vier oder fünf Minuten gesetzt. Dann denke ich, ‚Okay, ja – ja, da habe ich etwas gemacht.’”
Slater arbeitet überaus fleißig an neuen Ideen. Alles hält er als Audioschnipsel fest. Deshalb hat sich im Lauf der Jahrzehnte ein großes Audio-Archiv angesammelt. Er sagt, dass er das von Daniel Miller, dem Begründer von Mute, gelernt habe. Er habe er ihn einst ernst dazu ermahnt, alles zu sichern – „einfach alles, immer”, so Slater.
„Deshalb besitze er Aufnahmen seit Ende der Neunziger, die er jederzeit recyclen könne. Wichtigstes Werkzeug dabei sei die App AudioFinder von Iced Audio. Sie ermöglicht es, verschiedene Laufwerke gleichzeitig zu scannen. Um die darauf befindlichen Sounds zu indexieren, sodass man sie jederzeit suchen und – vor allen Dingen – vorhören kann.
Bedroom-Producer für immer
Trotz seines luxuriösen Studios fühle sich Slater immer noch ganz und gar der ersten Generation der Bedroom-Producer zugehörig. Er erinnert sich, dass es für ihn und die Clubmusik-Szene eine technische und stilistische Revolution war, bei der Realisation der Musik nicht mehr auf große Player und Studios angewiesen zu sein. „Wir sind die Generation, die das Homerecording erfunden hat. Die mit Atari und Samplern angefangen haben, Tracks zu bauen. Die Ersten, die brauchbare Ergebnisse erzielen konnten, weil unsere Musik anders war”, so Slater. Er ergänzt, dass es auch Bands gab, die mit den ersten Consumer-Vierspur-Rekordern (Stichwort: Tascam Portastudio) versuchten, professionellen Bandsound zu erzielen. „Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass dabei etwas wirklich Erstaunliches rausgekommen ist. Bandmusik und Homerecording funktionierte damals technisch noch nicht. Im Grunde mussten wir erst einen neuen Musikstil erfinden, der zu dem beschränkten Equipment passte, herauskam: Dance Music.”

Entstanden sei sie am Anfang mit wenig Equipment, so Slater. „Ein lieber Kumpel, Alan Sage, hatte allerdings schon ein kleines Homestudio. Ich erinnere mich noch gut an die frühen Produktionen, die ich mit ihm dort gemacht habe. Er hatte einen Analogsequencer, einen Alesis HR-16 Drumcomputer, ein Roland SH-101, einen Akai S700-Sampler und ein Tascam-Portastudio. Dazu lief ein Notator auf dem Atari. Es war wirklich unfassbar mühevoll, damit Musik zu machen.”
Sei erstes eigenes Studio habe er sich ab 1993 eingerichtet. „Man muss dazu wissen, dass ich nicht aus einer Familie komme, wo ich mir das alles hätte kaufen können. Ich betrieb damals aber einen Plattenladen in Brighton. So hatte ich tatsächlich Geld, um einen Akai S950 und zwei Alesis-Effekte, den Quadra- und Midi-Verb, zu kaufen”, sagt Slater. „Zuvor hatte ich mir bereits einen Yamaha DX-7 geholt und ein Studiomaster-Pult. Irgendwer hat mir einen coolen Korg Monopoly für freundliche 80 Pfund verkauft. Das stand in meinem Kinderzimmer, wo noch eine Tapete mit Karpfen-Motiven an der Wand war und Bären in der Ecke rumlagen”, erinnert sich Slater lachend. Überhaupt ist der 55-jährige Brite im Gespräch – anders als es seine oft ernsten und nachdenklichen Pressefotos suggerieren – durchgängig humorvoll, mit einem guten Sinn für ironische Untertöne, und lacht ausgesprochen viel und gern.
Musikfreunde
Angesprochen auf die Motivation, einen Plattenladen zu eröffnen, erinnert sich Slater an eine Kindheit. Musik habe eine elementare Rolle gespielt: „Mein Vater spielte mit seiner Bigband ja alle möglichen Jazz-Standards. So kam ich schon als Kind ziemlich reichhaltig mit Musik in Berührung. Außerdem hatte er eine riesige Plattensammlung, was dazu führte, dass ich total vernarrt in Schallplatten war. Nach all den Jahren eröffnet sich aber immer noch eine Welt, wenn ich die Nadel in die Rille setze.”
Dass er DJ wurde, hängt aber auch mit seiner Mutter zusammen. Sie kaufte ihm damals einen portablen Plattenspieler mit integriertem Lautsprecher – „der Beginn meiner DJ-Karriere”, so Slater. Schließlich habe von da an alles in seinem Leben irgendwie mit Musik zu tun gehabt, sogar die Freundschaften. „Jeder Freund, den ich je hatte, war irgendwie über Musik mit mir verbunden, sei es wegen Platten oder Bands.”
Auf das Konto der frühen Sozialisation mit der vielschichtigen Bigband- und Jazz-Rhythmik in der Musik seines Vaters geht wohl auch Slaters Vorliebe für komplexe und organische Drumgrooves. Exemplarisch ist das bei „Cloak And Dagger” zu hören, dem letzten Stück auf Saturn To Home. Die Ghostnoten (die Schläge zwischen den schweren Hauptschlägen) betonender Groove von Slater selbst getrommelt wurde.
Ghostnotes
„Cloak And Dagger” sei ein gutes Beispiel dafür, wie er Grooves programmiert, oder – in diesem Fall – einspielt, so Slater. „Als ich anfing, Techno zu produzieren, durchlief ich einen Prozess – ich produzierte zunächst Tracks, die wie andere Platten klangen. Ich kam an einen Punkt, an dem meine Stücke im Club wirklich spielbar waren”, resümiert er schmunzelnd. An einem gewissen Punkt wollte er aber darüber hinausgehen. Und Elemente einbringen, die nicht aus dem geraden Metrum kommen.

Dabei erwies sich der Umstand, dass er das Schlagzeugspielen gelernt hat, als wichtige Inspiration. „Wenn du ein reales Schlagzeug spielst, erhältst du von jeder Trommel eine Reaktion. Wenn Du eine Tom anschlägst, erhältst du eine von der Snare. Und mit der Zeit kommt es zu seltsamen Wechselwirkungen und seltsamen Geräuschen zwischen den Beats und den Dingen. Genau das passiert klanglich auch bei Techno. Der Raum um den Beat herum liefert eine Reaktion auf den Beat.”
Musik und Essen
Angesprochen auf die hörbare Vielschichtigkeit des Albums mit seinen unterschiedlichen Kollaborationen scheint Slater sichtlich zufrieden. Saturn To Home fühle sich für ihn – nach viel Mühe – wie ein komplettes Album an. „Es ist vollgepackt mit allem, was ich liebe”, sagt er. „Für mich ist es wirklich eine Art spirituelle Verbindung vieler verschiedener Dinge aus dem frühen House wie beispielsweise Robert Owens. Er ist für mich so etwas wie der Prince des House.”
Slater empfinde es als Ehre, seine musikalischen Anfänge in der Rave-Zeit mit den Gastmusiker:innen und der Gegenwart zu verknüpfen. Er hofft, dass viele Hörer die historischen Bezüge zu Rave und den Energien dieser Zeit nachvollziehen können. „Ich vergleiche das immer mit Essen. Jeder kann leckeres Essen genießen, aber je mehr man über den Prozess des Kochens weiß, desto mehr Freude hat man. Leider koche ich momentan nicht viel, aber der gesamte Vorgang des Kochens ist dem des Produzierens von Musik ziemlich ähnlich. Du gibst immer deinen aktuellen Wissensstand hinein. Natürlich kannst du dir ein einfaches Mac and Cheese machen, und es ist lecker. Richtig spannend wird es erst, wenn du deiner Kreativität freien Lauf lässt und ein Gericht von Grund auf gestaltest.”

Künstliche Intelligenz
Am Ende des Gesprächs stellt sich die aktuell geradezu unvermeidliche Frage, ob sich Slater schon mit dem omnipräsenten Thema KI in der Musik auseinandergesetzt hat. Er entgegnet ohne zu zögern mit seiner Theorie. „Elektronische Musik war schon immer ein Stück weit automatisiert. Egal ob du einen Drumcomputer oder einen Sequenzer benutzt – nicht du spielst, sondern die Maschine spielt für dich”, so Slater.
Dennoch seien die aktuellen KI-Entwicklungen eine massive Eskalation. Kommerzielle Popmusik könne schnell davon überrannt werden. „Wenn das passiert, wird es Kids geben, die wirklich begreifen, dass eine Maschine das einfach aus dem Nichts erschaffen hat. Sie werden denken: Mann, ich will wieder was Echtes. Also werden sie eine Gegenkultur mit offener Ablehnung von KI-Musik einleiten. Und weil die Underground-Kultur traditionell vom Mainstream kopiert wird, sobald sie populär geworden ist, wird auch diese Strömung wieder im Overground ankommen. Schon gibt es keine KI-Musik mehr in den Charts”, sagt Slater lächelnd.